Wer arbeitet heute noch unter 40 Stunden in der Woche? Ganz sicher nicht die Lehrer, die den ganzen Nachmittag zu Hause ihren Unterricht planen. Nicht die Elektriker, die regelmäßig zu Zwangsüberstunden verdonnert werden. Nicht die Politiker, deren Jobbeschreibung den Begriff Freizeit ganz bewusst unterschlagen hat. Und nicht die Anwälte in John Grishams Romanen, die jeden Tag 18 Stunden lang ihren Idealen hinterher rennen.
Unangefochten an der Spitze sind aus meiner (recht subjektiven) Sicht aber die Biologiestudenten. Da vergeht keine Minute, in der man nicht an die eigene Forschung denkt. Und das drei oder fünf Jahre lang. Ohne Pause. Sowas ist nichts für jeden, weshalb ich mich hier mit ein paar weisen Tipps an Studierende der Biologie richten will – Tipps, die mir einst ein Professor aus Frankreich beim Mittagessen gegeben hat und die meine Sicht der Wissenschaft nachhaltig geprägt haben.
Ist eine wissenschaftliche Karriere etwas für mich?
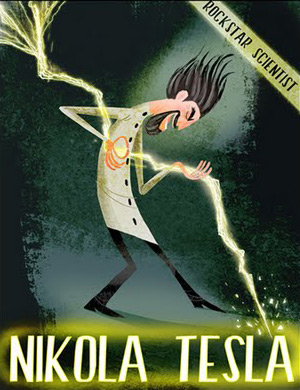 Dies ist die große, alles entscheidende Frage. Man beginnt sein Studium, ohne eine klare Vorstellung des Jobs, den man eines Tages ausüben wird. Als Biologe kann man quasi überall landen. Dies kann ein Vorteil sein, denn am Ende der eigenen Ausbildung stehen einem viele Türen offen. Die Mehrzahl meiner Kollegen sieht aber eher den Nachteil, dass man mit Diplom, Master oder Doktortitel keine Ahnung hat, was man eigentlich damit anfangen will. „So what are you going to do with that?“ fragt ein großartiger Ratgeber von Susan Basalla und Maggie Debelius, der sich genau an das Klientel der unentschiedenen Studierenden richtet.
Dies ist die große, alles entscheidende Frage. Man beginnt sein Studium, ohne eine klare Vorstellung des Jobs, den man eines Tages ausüben wird. Als Biologe kann man quasi überall landen. Dies kann ein Vorteil sein, denn am Ende der eigenen Ausbildung stehen einem viele Türen offen. Die Mehrzahl meiner Kollegen sieht aber eher den Nachteil, dass man mit Diplom, Master oder Doktortitel keine Ahnung hat, was man eigentlich damit anfangen will. „So what are you going to do with that?“ fragt ein großartiger Ratgeber von Susan Basalla und Maggie Debelius, der sich genau an das Klientel der unentschiedenen Studierenden richtet.
Das größte Problem der Biologen des 21. Jahrhunderts ist eine fortwährende Jobunsicherheit. Nicht nur steht man eines Tages vor dem Problem zwischen Post-doc oder Pharmakonzern. Selbst wenn man weiß, dass man in der Wissenschaft bleiben möchte, wird man kaum Aussicht auf eine Stelle haben, die länger als 3 Jahre eine feste Finanzierung garantiert. Dazu kommt, dass man in Deutschlands Universitäten maximal 12 Jahre arbeiten kann, bevor erwartet wird, dass man den nächsten Schritt zur Habilitation unternimmt.
Die 12-Jahres-Regel besagt quasi, dass man als wissenschaftlicher Angestellter an einer Uni maximal 6 Jahre vor und 6 Jahre nach der Promotion arbeiten kann. Die Verträge werden somit auf maximal 6 Jahre befristet; mit wenigen Ausnahmen führt daran auch nichts vorbei. Studierenden der ersten Semester ist diese Herausforderung selten klar. Mir war sie es ganz sicher nicht. Erst als ich eine Kollegin kennen lernte, die sich im fünften Jahr nach ihrer Promotion befand, wurde für mich deutlich, wie unangenehm diese Jobunsicherheit in der Praxis tatsächlich ist.
Aber als Wissenschaftler gehört diese Unsicherheit dazu. Und mit ihr kommen viele Vorteile des akademischen Lebens, die den Wissenschaftler zu einem faszinierenden Beruf machen. Vorausgesetzt, man lässt sich darauf ein.
Wissenschaftler sind Rockstars
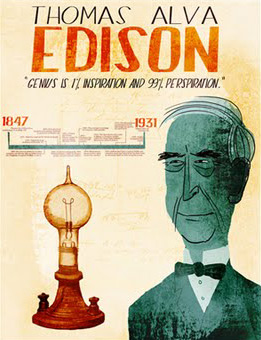 Professor Michael Greenfield, Entomologe aus den USA und mittlerweile zu Hause an der Universität Tours, hat mir beim Mittagessen beiläufig folgendes gesagt: „Als Wissenschaftler machst du die gleiche Karriere durch wie ein Musiker, der Rockstar werden will.“ Jahrelange schlechte Bezahlung, Sorgen um die eigene Zukunft, aber am Ende die Chance auf eine Bilderbuchkarriere in einem außerordentlich erfüllenden Beruf.
Professor Michael Greenfield, Entomologe aus den USA und mittlerweile zu Hause an der Universität Tours, hat mir beim Mittagessen beiläufig folgendes gesagt: „Als Wissenschaftler machst du die gleiche Karriere durch wie ein Musiker, der Rockstar werden will.“ Jahrelange schlechte Bezahlung, Sorgen um die eigene Zukunft, aber am Ende die Chance auf eine Bilderbuchkarriere in einem außerordentlich erfüllenden Beruf.
Die Analogie hört hier noch lange nicht auf. Nicht selten zweifelt man als Musiker und als Wissenschaftler an sich selbst und seinen Fähigkeiten, lernt aber Jahrzehnte lang die Methoden kennen, die einen eines Tages zu einem großen Star bzw. einem beachteten Forscher machen. Man braucht Talent für Musik, und man braucht Talent zur Wissenschaft. Die Fähigkeit, zu singen oder ein Musikinstrument zu spielen kann man lernen, aber hebt einen das genug ab von der Masse an konkurrierenden Möchtegernstars? Als Wissenschaftler muss man schreiben können, um seine Gedanken und Ergebnisse prägnant auf den Punkt zu bringen, und dennoch ist es schwer, seine Publikationen einem breiten Publikum zu „verkaufen“. Außerdem braucht man Kreativität. Der beste Musiker ist nichts ohne den großen Song; und ein Wissenschaftler ohne einen Schwerpunkt, eine Fähigkeit oder ein Wissensgebiet, in dem er auffällt, wird es selten über den Post-doc hinaus schaffen. Zu guter Letzt gibt es in beiden Jobs eine Masse an Leuten, die dir beim Scheitern applaudieren und sich freuen, dass sie einen Konkurrenten weniger um die paar begehrten Stellen haben.

Kommentare (2)