In der seltsamen Welt der Quantenmechanik können Teilchen an mehreren Orten zugleich sein, sie befinden sich in einer Überlagerung verschiedener Orte (oder anderer Zustände), beschrieben durch eine Wellenfunktion. Erst wenn jemand den Ort nachmisst, soll die Wellenfunktion zu dem Ort hin “kollabieren”, an dem das Teilchen auftaucht. Eine Theorie für diesen Kollaps gibt es nicht – die “Kopenhagener Deutung” der Quantenmechanik nach Bohr und Heisenberg postuliert dies einfach und trennt damit die Quantenwelt von der uns vertrauten makroskopischen Welt. Dabei gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Quantenwelt zwanglos mit der unsrigen in Einklang zu bringen: die Viele-Welten-Theorie von Hugh Everett III. Behauptet jedenfalls Sean Carroll in seinem neuen Buch “Something Deeply Hidden“. Ich habe mir das Buch besorgt und möchte im folgenden Artikel darüber berichten, warum Carroll Everetts Theorie für die plausibelste Erklärung Quanten-, aber auch der makroskopischen Physik hält.
Ein Quäntchen Licht
Die Quantenmechanik hat ihren Ursprung in der Beobachtung, dass Elektronen in Atomen keine beliebigen Energien annehmen können, sondern nur bestimmte diskrete Energieniveaus. Springen sie von einem Energieniveau auf ein anderes, dann geben sie ein Lichtquant ab, also eine gewisse Menge, lateinisch Quantum, von Licht. Dieses hat dann eine ganz bestimmte Frequenz f, die über die Plancksche Formel E=h·f die Energie des Quants bestimmt, wobei das Plancksche Wirkungsquantum h eine Naturkonstante ist. Ein anderes Wort für Lichtquanten sind Photonen.
Umgekehrt gilt, nur Licht oberhalb einer bestimmten Frequenz f kann etwa Elektronen aus einer Metallplatte lösen (in diesem Fall im Ultravioletten). Man kann noch soviel Licht geringerer Wellenlänge auf das Metall schießen, ohne großen Effekt. Nur wenn die Lichtquanten die Energie passend portioniert abliefern, können die Elektronen die Metallplatte verlassen. Für die Erklärung dieses Photoelektrischen Effekts (und nicht etwa für seine Relativitätstheorien) durch die Quantennatur des Lichts erhielt Albert Einstein 1921 den Nobelpreis. Damit hat Licht, dessen Wellennatur aus Versuchen mit engen Spalten längst bekannt war, auch einen Teilchencharakter.
Denn schickt man Licht einer bestimmten Frequenz durch zwei eng benachbarte Spalten, so entsteht auf einem Schirm dahinter ein Streifenmuster: Genau in der Mitte zwischen den Spalten haben die Lichtwellen aus beiden Spalten den gleichen Weg zurückgelegt und sie verstärken sich, weil stets Wellenberg mit Wellenberg und Wellental mit Wellental zusammentrifft. Links und rechts davon sind die Wege zu den Spalten nicht gleich lang, weil die Ebene der Spalten ein wenig verkippt erscheint, und dann treffen die Wellen gegeneinander versetzt ein – bei einer halben Wellenlänge Versatz treffen Wellenberge auf Wellentäler und löschen sich genau aus. Noch weiter von der Mitte entfernt treffen die Wellen dann wieder im Gleichtakt aufeinander und es gibt wieder einen hellen Streifen. Das Phänomen nennt sich Interferenz.

Ebene Lichtwellen laufen durch einen Doppelspalt und interferieren dahinter. Die Spalten erzeugen kreisförmige Wellen, die sich überlagern und dabei an solchen Orten verstärken, wo Wellenberge auf Wellenberge und -täler auf -täler treffen. Dazwischen treffen Wellenberge auf -täler und löschen sich aus. Die ortsabhängigen Verschiebungen ergeben sich aus den verschiedenen Abständen der beiden Spalte zum jeweiligen Ort auf dem Schirm. In der Mitte ist immer ein Maximum, weil beide Spalte dort gleich weit entfernt sind. Bild: Wikimedia Commons, Lookang, CC BY-SA 3.0.
Umgekehrt haben auch Teilchen Wellencharakter. Man kann Elektronen ebenfalls durch einen Doppelspalt schicken und erhält genau so ein Streifenmuster auf einem Leuchtschirm wie bei Lichtwellen. Versperrt man hingegen einen der Spalte, dann verschwindet das Streifenmuster und es landen einfach die meisten Elektronen in der Mitte und nach außen hin klingt die Anzahl allmählich ab. Gut, dann interferieren vielleicht Elektronen miteinander, die gleichzeitig nebeneinander durch die beiden Spalte gehen, könnte man annehmen. Dem ist aber nicht so: man kann den Versuch so abändern, dass immer nur ein einzelnes Elektron gleichzeitig auf den Doppelspalt abgefeuert wird. Wenn man die auf dem Schirm dahinter entstehenden Leuchtpunkte aufsummiert, kommt wieder das Streifenmuster heraus. Jedes Elektron geht irgendwie durch beide Spalte. Wie Lichtwellen.

Die Verteilung von Elektronen, die man durch einen Doppelspalt auf einen Leuchtschirm geschossen hat, zeigt ebenfalls ein Interferenzmuster. Die Einzelbilder zeigen die Spuren von 200, 6.000, 40.000 und 140.000 Elektronen. Bild: Wikimedia Commons, Dr. Tonomura and Belsazar, CC BY-SA 3.0.
Aber was passiert da genau? Wenn man näher hinschaut? Wenn man nachschaut, durch welchen Spalt das Elektron geht? Auch das lässt sich messen. Aber wenn man nachweist, durch welchen Spalt jedes Elektron geht, dann verschwindet das Streifenmuster und man erhält nur das Bild, das sich aus der Überlagerung von zwei Elektronenverteilungen durch zwei Einzelspalte ergibt.
Was ist das los? In der Quantenphysik erklärt man sich das so: mit dem Elektron verbunden ist eine Wellenfunktion Ψ (Psi). Die Welle, genauer gesagt, das Quadrat ihrer Amplitude Ψ², gibt an, wie wahrscheinlich man ein Elektron an einem bestimmten Ort misst, z.B. auf dem Schirm. Und diese Welle ist es, die durch den Doppelspalt geht und mit sich selbst interferiert. Nun ist das Elektron aber kein von der Welle separates Ding, es ist ja gerade nicht so, dass das Elektron gemäß der Wellenwahrscheinlichkeit abwechselnd mal durch den einen und mal durch den anderen Spalt geht, auch einzelne Elektronen gehen durch beide Spalte. Das Elektron ist die Welle. Aber wenn wir es messen, dann messen wir stets ein Teilchen an einem bestimmten Ort. Warum? Was passiert bei der Messung?
Die spinnen, die Elektronen…
Und noch ein Beispiel für die Merkwürdigkeit der Quantenmechanik: Elektronen haben ein magnetisches Moment, sie sind wie kleine Magneten mit Nord- und Südpol. Ein kreisender Strom (und Strom sind bekanntlich bewegte Elektronen) hat ebenfalls ein magnetisches Dipolmoment (wenn man mit den Fingern der rechten Hand in Richtung der Windung zeigt, dann zeigt der ausgestreckte Daumen in Richtung des magnetischen Nordpols) und daher nennt man das magnetische Moment der Elektronen “Spin”, also “Drehung”, so als ob das Elektron rotierte und so einen kreisenden Strom darstellte, der ein Magnetfeld hervorbrächte. Aber Elektronenspins nehmen keine beliebigen Werte an, sie sind gequantelt, wie ihre Energien im Atom. Im Experiment nach Stern und Gerlach (1922) schickt man neutrale Silberatome durch ein (inhomogenes) Magnetfeld, siehe Video. Silber hat die Eigenschaft, dass ein einzelnes Elektron das magnetische Moment des gesamten Atoms bestimmt, die Spins der anderen Elektronen heben sich gegenseitig auf. Aufgrund dieses überzähligen Elektronenspins wird die Hälfte der Atome in Richtung des Magnetfelds abgelenkt, die andere Hälfte in Gegenrichtung. Niemals in einem schrägen Winkel oder geradeaus, wie es bei zufällig ausgerichteten Drehachsen klassischer Magnete der Fall wäre (erster Teil des Videos). Dabei ist es völlig egal, in welcher Richtung das Magnetfeld ausgerichtet ist, die Ablenkung erfolgt immer zur Hälfte in der Richtung bzw. Gegenrichtung der Magnetfeldlinien. Der Spin ist gequantelt, aber offenbar nicht gemäß einer ursprünglichen Ausrichtung der Elektronenspins, sondern gemäß der Messung.
Dreht denn etwa das äußere Magnetfeld den Spin in seine Richtung? Lässt man die nach oben abgelenkten Atome noch einmal durch ein gleichartig ausgerichtetes Magnetfeld gehen (hier mit allerlei Bildern erläutert) , werden sie zu 100% wieder in die gleiche Richtung wie vorher abgelenkt, also die nach oben abgelenkten gehen nochmals nach oben (Fig. 9 im verlinkten Artikel), die nach unten abgelenkten in die Gegenrichtung. Wählt man hingegen für das zweite Feld eine um 90° gegen das erste verdrehte Ausrichtung, also von rechts nach links (Fig. 11), dann werden 50% der zuvor nach oben abgelenkten Atome nach links und 50% nach rechts abgelenkt (entsprechendes gilt für die zuvor nach unten abgelenkten Elektronen). Bei einem kleineren Winkel, etwa einer Ausrichtung des Feldes von links unten nach rechts oben, werden mehr Atome nach rechts oben abgelenkt als nach links unten (Fig. 13), und das Verhältnis wächst gegen 100%, je mehr man das zweite Feld in Richtung des ersten verdreht. Das äußere Magnetfeld dreht die Richtung also offenbar nicht nach Belieben, denn sonst müssten ja bei jeder Ausrichtung 50% der Atome nach oben und 50% nach unten abgelenkt werden.
Die Quantenmechanik besagt, dass die Elektronen sich in einem Überlagerungszustand befinden, aus dem sie durch die Messung befreit werden. Bevor sie in das Magnetfeld eintreten, sind sie zu 50% im Zustand Spin aufwärts und zu 50% im Zustand Spin abwärts. Das Magnetfeld erzwingt eine Entscheidung, wobei ein Elektron dann zufällig nach oben oder unten abgelenkt wird, mit 50% Wahrscheinlichkeit. Nach der Messung weiß man die Spinrichtung. Misst man noch einmal auf die gleiche Weise, bekommt man erwartungsgemäß das gleiche Ergebnis. Misst man aber um 90° verkippt, dann ist der zuvor eindeutig bestimmte Spin wieder völlig offen: die Ablenkung kann nur in Richtung oder Gegenrichtung des Magnetfelds erfolgen, das mit dem vorherigen keinen gemeinsamen Richtungsanteil teilt. Die Messung fragt jetzt eine andere Quantelung ab. Bei weniger als 90° Verkippung ist hingegen noch ein Anteil der ursprünglichen Richtung vorhanden und der beeinflusst die Statistik der Messung.
Kopenhagener Merkwürdigkeiten
Auch das zweite Experiment kann durch eine Wellenfunktion beschrieben werden, die die Unsicherheit des Spins mathematisch ausdrückt. Der Zustand des Spins ist vor der Messung unbestimmt, die Wellenfunktion weist jeder möglichen Richtung eine Wahrscheinlichkeit zu. Führt man jedoch eine Messung durch, dann sind auf einen Schlag alle vorher offenen Möglichkeiten bis auf eine verboten. Das Elektron taucht im Doppelspaltversuch an einer Stelle auf dem Schirm auf, obwohl es vorher durch zwei Spalte ging. Es hat einen bestimmten Spin, obwohl die Richtung vorher unbestimmt war (und die Messung erzwingt eine Entscheidung zwischen zwei Richtungen). Die Wellenfunktion verwandelt sich von einer breit über alle Möglichkeiten verteilten Funktion in eine scharfe Spitze an der Stelle des gemessenen Zustands und 0 überall sonst. Erwin Schrödinger stellte eine Gleichung auf, die das Verhalten der Wellenfunktion und ihre Entwicklung beschreibt. Er hatte die Hoffnung, dass aus der Gleichung folgen würde, warum sie sich bei einer Messung auf einen Punkt zusammenzieht, aber das tat sie nicht.
Kluge Köpfe wie Werner Heisenberg, Niels Bohr, und Wolfgang Pauli konnten sich darauf keinen besseren Reim machen als die “Kopenhagener Deutung”, die sie 1927 in Kopenhagen als Kompromisslösung formulierten, die sich allmählich etablierte und die heute allen Physikstudenten eingetrichtert wird. In der klassischen Mechanik gilt: kennt man den Anfangszustand eines Körpers (Masse, Geschwindigkeit mit Richtung) und die auf ihn wirkenden Kräfte, dann kann man genau berechnen, wie er sich weiter bewegen wird. In der Quantenmechanik kann man ebenso mit Hilfe von Schrödingers Gleichung berechnen, wie sich die Wellenfunktion ausgehend von einem Startzustand entwickeln wird. Die Wellenfunktion schließt dabei streng genommen die ganze Welt mit ein, nicht nur ein einzelnes Teilchen; wenn Quantenteilchen miteinander interagieren dann ist ihr Verhalten miteinander verknüpft; das berühmteste Beispiel sind verschränkte Teilchen, bei denen zwei zusammen entstandene, aber danach räumlich getrennte Teilchen voneinander “wissen”, wie der Zustand des jeweils anderen bei einer Messung ausfällt, und man kann zeigen, dass diese Information nicht schon bei der Trennung der beiden vorhanden war. Aber auch bei Teilchenkollisionen kann das Ergebnis nicht durch separate Wellenfunktionen der beteiligten Kollisionspartner beschrieben werden. Wenn ein Teilchen jedoch isoliert von Interaktionen mit der Umwelt ist, dann kann man seinen Teil der universalen Wellenfunktion näherungsweise für sich alleine betrachten.
Wenn man nun eine Messung des aktuellen Zustands der Wellenfunktion eines Teilchens durchführt, dann gelten laut Kopenhagener Deutung einige Zusatzbedingungen:
- Man kann sich aus einer Reihe von beobachtbaren Parametern einige wenige aussuchen, die man messen möchte (z.B. die Spinrichtung in Bezug auf eine frei wählbare Achse; bei Impuls und Ort muss man sich für eine der beiden Größen entscheiden, man kann nicht beide zusammen mit beliebiger Genauigkeit bestimmen).
- Die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Ergebnis zu messen, errechnet sich aus dem Quadrat der Wellenfunktion für dieses Ergebnis.
- Wenn die Messung durchgeführt wird, kollabiert die Wellenfunktion zum gemessenen Wert hin, egal wie weit gestreut sie vor der Messung war.
Einen Grund für diesen Kollaps kann die Quantenmechanik nicht nennen – ist eben so. Kann man nicht verstehen. Carroll kritisiert heftig, dass alle Versuche, eine sinnigere Interpretation zu entwickeln, bei den Physikern verpönt war und zum Karrierekiller mutieren konnten.

Kollaps der Wellenfunktion nach der Kopenhagener Deutung. Vor der Messung ist Wellenfunktion Ψ (Psi) räumlich (oder im Parameterraum, wie beim Spin) unbestimmt, es gibt lediglich Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für ein Quantenteilchen. Nach der Messung der Position kollabiert die Wellenfunktion aus nicht nachvollziehbarem Grund auf den Ort, an dem das Teilchen (oder sein Zustand, z.B. der Spin) gemessen wurde. Bild: Quora.
Die Physik kann auch nicht erklären, was denn nun eigentlich die Messung ausmacht, das sogenannte Messproblem der Quantenmechanik. Die Absurdität der Situation versuchte Schrödinger mit seiner berühmten Katze zu verdeutlichen: in einer verschlossenen Kiste befinde sich eine Katze, ein Geigerzähler, der radioaktive Zerfälle misst, und ein radioaktives Atom. Der Geigerzähler löse bei einem radioaktiven Zerfall einen Mechanismus aus, der Gift aus einer Flasche entlässt, das die Katze sofort tötet. Nach der Kopenhagener Deutung befindet sich der radioaktive Atomkern in einem Zustand der Überlagerung aus Zerfall und stabilem Zustand, solange niemand ihn misst. Beim Zerfall wird die Katze getötet, ansonsten bleibt sie am Leben. Wenn das Atom in einem überlagerten Zustand ist, dann müsste es auch die Katze sein, in einer Überlagerung von tot und lebendig – solange niemand nachschaut, die Kiste öffnet und die Wellenfunktion zum Kollaps bringt. Schrödinger meinte nicht ernsthaft, dass die Katze tot und lebendig zugleich sei, er wollte damit nur zum Ausdruck bringen, wie absurd das Messproblem ist.

Das Gedankenexperiment zu Schrödingers Katze: ein radioaktiver Zerfall löst über einen Mechanismus die Zerstörung einer Giftflasche aus, deren Inhalt die Katze tötet. Wenn das radioaktive Atom im Überlagerungszustand von Zerfall und Stabilität wäre, wäre dann auch die Katze im Überlagerungszustand von lebendig und tot? Solange niemand nachschaut und den Zustand misst? Bild: Wikimedia Commons, Dhatfield, CC BY-SA 3.0.
Das Standardargument ist, es brauche niemand in die Kiste hinein zu schauen, der Geigerzähler führe ja schon eine Messung aus. Es reiche aus, dass das radioaktive Atom in Kontakt mit hinreichend viel Materie der makroskopischen Welt käme, dann dekohäriere der überlagerte Zustand und entscheide sich für ein Ergebnis. Kohärent nennt man in der Quantenmechanik vereinfacht gesagt einen Zustand, in dem die Wellenfunktion weit ausgebreitet und maximal unbestimmt ist. Dekohärieren ist dann ein anderes Wort für das Kollabieren der Wellenfunktion zu einem bestimmten Wert. Aber was ist “hinreichend viel” Materie und warum macht das einen Unterschied? Was da genau passiert und warum, das kann die Quantenphysik nicht erklären.
Alles Quatsch!
“Nichts”, war die Antwort eines jungen Physikers namens Hugh Everett (dem Dritten), der darüber 1956 seine Doktorarbeit schrieb. Oder auch “alles”, je nach Standpunkt. Everetts Standpunkt war, man könne die oben genannten Zusatzbedingungen einfach vergessen. Die Wellenfunktion kollabiere nicht. Wenn der Zustand eines Teilchens dekohäriere, dann verschränke es sich lediglich mit seiner Umgebung, die dann mit in den Überlagerungszustand überginge. Es entstünden dann zwei (oder mehr) überlagerte Zustände der universalen (also die ganze Welt einschließenden) Wellenfunktion, einmal mit dem Teilchen in dem einen der überlagerten Zustände und einmal in dem anderen. Die Welt habe sich gewissermaßen in zwei überlagerte Zustände aufgeteilt. Schrödingers Katze existiere in zwei Kopien, die eine sei tot und die andere zugleich lebendig (siehe Titelbild). Das gelte dann aber eben auch für den Messapparat. Es gebe damit auch zwei Beobachter, die die Kiste öffneten, der eine sehe eine tote Katze und der andere eine lebendige. Jedesmal, wenn ein Teilchen (und davon gibt es verdammt viele, so um die 1088 im beobachtbaren Universum) in einen überlagerten Zustand übergehe, teile sich die globale Wellenfunktion auf. Gehe ein Elektron durch einen Doppelspalt, so teile sich die Welt in zahlreiche mögliche Pfade auf, die jeweils einem Endpunkt auf dem Schirm entsprächen. Es gebe nicht nur eine Welt, sondern eine gigantische Zahl sich ständig weiter teilender Pfade, in denen alles, was quantenmechanisch möglich ist, auch tatsächlich passiere.

Hugh Everett III. Bild: Wikimedia Commons, Fair Use.
Die mittlerweile älteren Recken der Kopenhagener Runde hielten das für ausgemachten Unsinn. Es sei ja offensichtlich, dass die makroskopische Welt sich in keiner Überlagerung befinde, alle makroskopischen Dinge hätten eindeutige Orte, seien entweder tot oder lebendig, das sehe man doch! Einer Anekdote gemäß wurde eine junge Physikerin von ihrem Professor einmal gefragt, warum man sage, es sei natürlich gewesen, davon auszugehen, dass die Sonne um die Erde kreise und nicht umgekehrt. Weil es so aussehe, antwortete sie. Ja schon, entgegnete er, aber wie hätte es denn anders herum ausgesehen?
Fühlt es sich irgendwie anders an, wenn sich die universale Wellenfunktion aufspaltet? Tatsächlich zeigte Everett, dass jeder Beobachter in einer der aufgespaltenen Welten genau dasselbe beobachten würde, wie bei der Kopenhagener Deutung. Die lässt jeweils nur ein Ergebnis eines Quantenexperiments zu, das vorher potenziell sehr viele mögliche Ausgänge hatte, und jeder Ausgang ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich. Bei Everett spalten sich die Welten so auf, dass die wahrscheinlicheren Ergebnisse häufiger auftreten und somit ein höheres Gewicht haben. Als Beobachter weiß man selbst nicht, in welchem Zweig man sich befindet, aber die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass man sich auf einem breiten Bündel mit wahrscheinlichen Ergebnissen befindet. 500mal eine 6 hintereinander würfeln? Passiert in irgendeiner Welt und irgendein Beobachter wird sich dort am Kopf kratzen und darüber grübeln, ob die Physik bei ihm verrückt spiele (und dann vermutlich die Schlussfolgerung ziehen, dass er zufällig Zeuge einer extrem seltenen statistischen Schwankung geworden sei). Eine überwältigende Zahl von Beobachtern wird hingegen eine mehr oder weniger gleichverteilt streuende Augenzahl der Würfelwürfe beobachten.
Dieser erste Teil war nur das Aufwärmprogramm mit der notwendigen Einführung in das Thema. Im zweiten Teil des Artikels will ich die Implikationen der Everettschen Idee gemäß Carrolls Buch erläutern. Ist die Idee wirklich so absurd? Wie genau erklärt die Viele-Welten-Theorie die Probleme der Quantenphysik? Wo sollen die ganzen Welten eigentlich Platz finden? Wie viele davon soll es überhaupt geben? Wie real sind sie? Kann man andere Welten nachweisen? Wenn sowieso alles eintritt, macht es dann noch Sinn, sich moralisch zu verhalten? Und ist das alles überhaupt noch Physik?
Mehr dazu im zweiten Teil.
Referenzen
[1] Sean Carroll, “Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime“, ISBN-13: 978-1524743017, 2019.
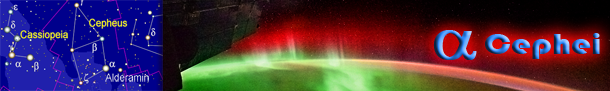


Kommentare (61)