Sieht man von den wenigen glücklichen Wissenschaftlern ab, die es geschafft haben, eine Festanstellung an deutschen Universitäten zu ergattern, dann kommt kein Forscher umhin, die wissenschaftliche Arbeit immer wieder zu unterbrechen um Forschungsanträge zu schreiben. Für viele Disziplinen, besonders wenn es um Grundlagenforschung ohne industrielle Anwendungen geht, ist das die einzige Möglichkeit, um an Geld zu kommen.
Forschungsgelder zu bekommen ist harte Arbeit und das ist prinzipiell ja auch ganz ok. Das Geld sollte nicht einfach wahllos und ohne Überprüfung in die Welt geschmissen werden. Aber dass das System, zumindest so wie es in Deutschland praktiziert wird, auch seine schlechten Seiten hat, habe ich hier im Blog schon oft genug thematisiert. Bei der Bewertung der Wissenschaftler und der Projekte zählen nur die Publikationen, hat man Erfolg, dann bekommt man oft nur eine halbe Stelle (auf der man aber natürlich trotzdem Vollzeit arbeitet und diese Stellen sind auch noch meistens absurd kurz befristet so dass eine längerfristige Lebensplanung bei Wissenschaftlern quasi nicht möglich ist.
Im Magazin der Deutschen Universitätszeitung (Ausgabe 10, September 2011) hat man sich ausführlich mit der Forschungsförderung beschäftigt und ich wollte euch ein paar der dort erschienenen – und sehr lesenswerten! – Artikel vorstellen. Da wäre zuerst das Interview mit dem Informatiker Norman Weiß, dass den passenden Titel “In gewisser Weise Antragsknechte” trägt. Weiß ist Vorsitzender von Thesis, einem Netzwerk für Promovierende und spricht über die weit verbreitete Praxis, die Projektanträge von Doktoranden schreiben zu lassen:
“[M]ittlerweile besteht das Hauptpersonal an den Lehrstühlen zur 75 Prozent oder mehr aus Doktoranden. Sonstige Mitarbeiter im Mittelbau gibt es ja kaum noch. Insofern ist klar, dass ein großer Anteil der Arbeit bei den Promovenden hängenbleibt und dazu gehört auch das Forschungsanträgeschreiben.”
Jetzt ist es ja prinzipiell nicht schlecht, wenn auch Doktoranden schon lernen, wie man Projektanträge verfasst. Wie schon gesagt, dass gehört mit zum Arbeitsalltag eines Wissenschaftlers. Allerdings ist ein Doktorand auch immer noch ein Student, der lernen und sich eigentlich auf seine Doktorarbeit konzentrieren sollte. Es sollte eigentlich nicht auch noch seine Aufgabe sein, Geld für die Forschungsgruppe auftreiben zu müssen. Das sagt auch Weiß:
“Ich finde es bedenklich, wenn man gerade das Unidiplom in der Tasche hat und einen relativ großen Teil des Forschungsmittelantrags selbst schreiben muss. Eigentlich sollten Anträge ja für Vorhaben geschrieben werden, die tatsächlich Neues bringen, die aber wissenschaftliche Erfahrung voraussetzen.”
Oft reicht einem beim Antragschreiben aber nichtmal ausreichend wissenschaftliche Erfahrung. Nämlich dann, wenn es nicht mehr um nationale Anträge geht, sondern um Forschungsförderung auf europäischen Niveau. Man schimpft ja oft und gerne über die EU-Bürokratie und ebenso oft ist die Kritik unangemessen. Aber nicht in diesem Fall. Wer schon einmal mit EU-Projekten zu tun hatte, wird wissen, was ich meine. Bei solchen Projekten sind meistens eigene Leute hauptberuflich angestellt, die nichts anderes tun, als das Projekt zu verwalten! Ich selbst hatte einmal das Vergnügen, im Rahmen eines EU-Projekts angestellt zu sein und der bürokratische Aufwand, den mich das gekostet hat, war absurd! Selbst jetzt, über ein Jahr nachdem das Projekt beendet ist, bekomme ich immer wieder mal Emails vom Projektverwalter der irgendwelche bürokratischen Informationen von mir haben will. Aber zuerst muss man so ein Projekt mal bekommen.
Im Artikel “Reich mir die Hand, mein Forscher” schreibt Johann Osel über die Schwierigkeiten, die Wissenschaftler bei der Antragstellung für EU-Projekten haben. Auch hier habe ich schon selbst Erfahrung gesammelt; ich habe 2007 einen Antrag für EU-Forschungsförderung gestellt. Und wenn ich mir den Artikel von Johann Osel so durchlesen, dann bin ich die Sache damals wohl ein wenig zu naiv angegangen. Osel berichtet von einer neuen Art von Dienstleistern: Firmen, die nichts anderes tun, als Wissenschaftlern bei der Erstellung von EU-Anträgen zu helfen. Brigitte Fuchs, die Geschäftsführerin einer dieser Firmen meint:
“‘Antragsstellung ist ein Vollzeitjob und kann nicht nebenbei erledigt werden.’ Manche Kunden würden erst einmal alleine mit dem Antrag beginnen und dann feststellen, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Die Firma werde dann ‘als eine Art Feuerwehr’ gerufen, um kurz vor Zwölf noch einzugreifen.”
Soweit ich mich noch an meinen damaligen Antrag erinnern kann (und ich probiere normalerweise, mich nicht zu oft an EU-Anträge zu erinnern 😉 ), war das alles tatsächlich ein ziemlicher Aufwand. Nachdem ich mittlerweile einige Leute aus der “EU-Antrags-Szene” kennengelernt habe, ist mir auch klar, dass es wirklich sehr schwer ist, so einen Antrag ohne professionelle Hilfe finanziert zu bekommen. Und das ist schon etwas seltsam, wie auch der Dresdner Forschungsdezernent Hannes Lehmann meint:
“Ein öffentliches System, also auch die EU, sollte eigentlich nicht so kompliziert beschaffen sein, dass seine Nutzung einen Dienstleistungsmarkt erforderlich macht. Da kann man sich durchaus fragen, ob nicht grundsätzlich etwas falsch läuft.”
Wer von all dem nun etwas deprimiert ist, den heitert vielleicht der dritte Artikel ein wenig auf. Er stammt von Bernhard Horsthemke, dem Direktor des Instituts für Humangenetik an der Universität Duisburg-Essen und trägt den Titel “Eine kurze Anleitung zum Neinsagen”. Horsthemke erklärt darin, wie man sich als Wissenschaftler verhalten soll, wenn man gebeten wird, einen Projektantrag zu begutachten:
“Zunächst fühlen Sie sich gebauchpinselt, dass man Sie um Rat fragt. Dann aber geraten Sie vielleicht in Panik, weil Sie nicht wissen, wie Sie überhaupt einen Antrag beurteilen sollen. Sie können es sich natürlich leicht machen, indem Sie die originelle Idee und das anspruchsvolle Arbeitsprogramm loben – und am Ende das Projekt zur Förderung in voller Höhe vorschlagen. Aber Achtung, das kann auch gravierende Nachteile haben: Die Referenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und Ihre Mitgutachter könnten meinen, Sie seien unkritisch. Außerdem verkleinern Sie mit Ihrer Förderempfehlung den DFG-Topf und haben eventuell am Ende des Jahres das Nachsehen, wenn für Ihren eigenen Antrag nicht mehr genug Geld da ist. Ein abgelehnter Antrag führt zwar leider dazu, dass der Antragsteller in nächster Zeit oder vielleicht nie wieder einen Antrag stellen wird, aber dafür können Sie ja nichts. Außerdem lassen Sie eventuell die Gelegenheit verstreichen, sich für eine negative Beurteilung Ihres eigenen Projekts, beispielsweise bei der Begutachtung eines Sonderforschungsbereichs, an einem nervigen Kollegen zu rächen.
Also: Sie müssen den Antrag ablehnen. Das Nein lässt Sie auch für kurze Zeit das berauschende Gefühl der Überlegenheit erleben, das Ihnen kurzzeitig auch über die Serie der misslungenen Experimente in Ihrem Labor hinweghelfen kann. Ach, Sie wissen nicht, wie man einen Antrag am besten ablehnt? Hier kommen ein paar Argumentationshilfen, die Sie fachübergreifend, einzeln oder in Kombination anwenden können.”
Wer schon ein wenig Erfahrung mit Gutachten und Gutachtern in der wissenschaftlichen Welt hat, der wird viele der von Horsthemke angeführten Argumentationshilfen zum Neinsagen schon kennengelernt haben. (Bei der Ablehnung meines letzten Projektantrags haben sich die Gutachter übrigens für “Suchen Sie das Haar in der Suppe und bohren Sie das kleine Problemchen zu großer Bedeutung auf. Sagen Sie, damit stünde oder besser fiele der Antrag.” entschieden.)
Dem letzten Absatz von Horsthemkes Artikel habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen:
“Wenn Sie diese Argumente einsetzen, wird Ihnen die Ablehnung eines Antrags keine Probleme mehr bereiten. Das Fachkollegium und die DFG-Referenten werden Ihrer Empfehlung mit Sicherheit folgen, denn die Gutachter haben immer Recht, der Antragsteller nie. Und außerdem ist die Ablehnung des Antrags ja nicht nur gut für Sie, sondern auch für die deutsche Forschung: Sie garantieren damit risikoarme Mainstream-Forschung und wissenschaftliche Monokulturen. Und das wollen wir doch alle, oder?”



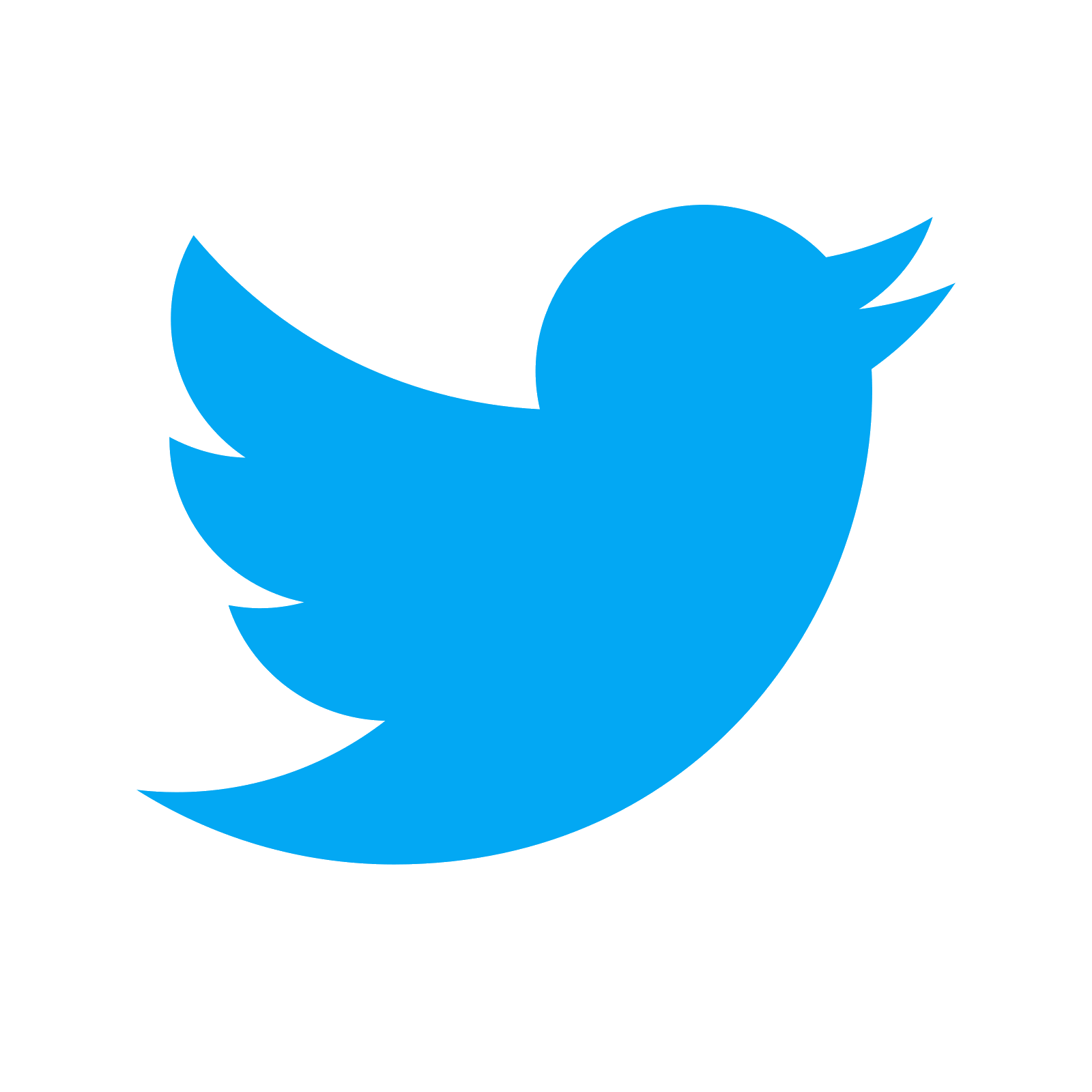







Kommentare (38)