Man kann die Planung von Forschung auf allgemeiner Ebene betrachten und sich überlegen, wie Regierungen und großer Förderorganisationen ihr Geld am besten verteilen um optimale Ergebnisse zu erreichen. Oder aber man geht zurück auf eine ganz individuelle Ebene. Denn egal welches Konzept zur Forschungsplanung und -förderung man sich ausgedacht hat: Man braucht immer auch noch Forscher, die in den entsprechenden Disziplinen ausgebildet sind und die Arbeit durchführen. Wie entscheiden die jungen Wissenschaftler sich aber für das Arbeitsgebiet, auf dem sie Experten werden wollen? Entscheiden sie sich überhaupt dafür – oder wird ihnen diese Entscheidung abgenommen?
Auf der Konferenz für Forschungsplanung in Berlin gab es heute Vormittag eine Reihe von Workshops (die aber eigentlich eher Podiumsdiskussionen waren). Ich habe mich für einen aus der Reihe “Identifying Demand” entschieden und zwar den mit dem Titel: “And Who Asks Us? – Students and Junior Researchers”. Es sollte also darum gehen, wie junge Wissenschaftler bzw. Studenten in den Prozess der Forschungsplanung und -förderung eingebunden sind. Meiner Meinung nach eine wichtige Frage, denn Forschungsplanung sollte idealerweise langfristig geschehen und das funktioniert nur dann, wenn man auch die jungen Forscher berücksichtigt, die ja dann später direkt betroffen sind. Unverständlicherweise war die Diskussion aber recht schlecht besucht – nur 37 Leute wollten sich anhören, was die Jungwissenschaftler zu sagen haben.
Obwohl die eigentlich nicht mehr so wirklich jung waren. Ich hätte mich gefreut, auch mal die Meinung von jemanden zu hören, der erst ganz am Anfang einer akademischen Laufbahn steht. Auf Christian Hackenberger, Professor am Institut für Chemie und Biochemie an der FU Berlin, trifft das sicher nicht zu. Was er im Rahmen der Diskussion gesagt hat, fand ich aber trotzdem sehr interessant. Er hat betont, dass es wichtig ist, dass junge Wissenschaftler die Möglichkeit haben, eigene Ideen zu entwickeln.
Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema und auch wenn es nicht das Hauptthema des Workshops war, lohnt es sich doch, es ein wenig ausführlicher zu betrachten. Als Wissenschaftler hat man ja eine wesentlich längere Ausbildungszeit als in anderen Berufen. Man macht Abitur, absolviert danach ein Grundstudium das einige Jahre dauert und im Anschluß daran folgen normalerweise noch ein paar Jahre Doktorat. Erst dann ist man Doktor und wenn andere schon seit langem im Berufsleben stehen, fängt der frischgebackene Doktor gerade erst an, seine akademische Karriere zu planen. Als Diplomand und auch noch als Doktorand ist es ganz selbstverständlich, dass es einen Betreuer gibt, der einen bei der Arbeit unterstützt und auf Fehler hinweist. Einen Lehrmeister quasi, der einem die Wissenschaft beibringt. Hat man dann alles gelernt und im Rahmen seiner Dissertation gezeigt, dass man zu selbstständiger wissenschaftlichen Arbeit fähig ist, ist man bereit, ein richtiger, freier Forscher zu werden. Idealerweise… manchmal bleibt man aber auch der ewige Assistent des Vorgesetzen.
Denn das Student/Betreuer-Verhältnis setzt sich oft noch bis weit nach dem Doktorat fort. Ich kenne viele PostDocs, die anstatt selbständig zu forschen, immer noch reine “Auftragsforscher” sind und nur das machen, was ihnen der Chef der Arbeitsgruppe vorgibt. Wenn das während des Diploms geschieht, ist das völlig ok. Hier hat man selbst noch keine Erfahrung und braucht vernünftige Anleitung. Während der Dissertation ist die Anleitung in gewissen Maße auch noch in Ordnung. Aber hier sollte man eigentlich schon selbst in der Lage sein, wissenschaftlich zu arbeiten, die wissenschaftlichen Methoden der eigenen Disziplin beherrschen und seine eigenen Entscheidungen über den Ablauf der Forschungsarbeit treffen. Der Betreuer sollte kontrollieren und unterstützen, aber nicht anschaffen, was zu machen ist. Trotzdem habe ich viele Arbeitsgruppen kennengelernt, wo es genau so abläuft. Der Betreuer hat sich das Thema der Dissertation ausgedacht, der Betreuer hat den Arbeitsplan aufgestellt, der Betreuer hat die Methoden ausgewählt und der Dissertant führt die Arbeit nur noch aus, lässt die Ergebnisse regelmäßig absegnen und holt sich ebenso regelmäßig neue Anweisungen. Das ist natürlich praktisch für den Betreuer: Er hat eine zusätzliche Arbeitskraft, die seine Forschungsvorhaben ausführt. Für den Dissertanten ist es aber fatal: Denn um ein guter Wissenschaftler zu werden, muss man selbstverständlich lernen, wie man eigenständig arbeitet und vor allem denkt. Wer das nicht lernt, dem fällt es dann auch nach der Dissertation schwer, ein “freier Forscher” zu sein und es nicht verwunderlich, wenn er als PostDoc weiter nur der Assistent des Chefs und kein freier Forscher ist.
Ich kann hier nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und möchte auf keinen Fall allgemeine Schlüsse ziehen. Aber ich habe immer wieder gesehen, dass diese “Forschung nach Anweisung” tatsächlich praktiziert wird. Öfter auf der Ebene der Doktoranden als bei den PostDocs, aber begegnet ist mir beides schon. Und es ist immer tragisch, denn Unselbstständigkeit ist fatal für die Wissenschaft. Neue Erkenntnisse und wissenschaftlichen Fortschritt kann es nur geben, wenn weiterhin genügend junge, kreative Menschen in die Reihen der Wissenschaftler nachrücken die fähig sind, sich eigene Gedanken zu machen und selbstständig zu arbeiten. Christian Hackenberger hat sich in dieser Frage durch seine vielen Aufenthalte in den USA inspirieren lassen. Wie er am Ende der Diskussion angemerkt hat, war es dort üblich, den Studenten schon möglichst früh beizubringen, fundamentale Fragen zu stellen. Hat man einen wissenschaftlichen Artikel durchgearbeitet, so sollte man danach nicht nur verstehen, worum es darin ging sondern wurde auch animiert, sich zu überlegen, wie denn die nächsten Schritte auf diesem Forschungsgebiet aussehen sollten.
Das klingt natürlich nach einer guten Idee – aber allein damit es natürlich nicht getan. Wie war es bei euch, liebe Leserinnen und Leser (zumindest bei denen, die eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen haben)? Wie habt ihr gelernt, selbstständig zu arbeiten? Hat es euch jemand beigebracht oder habt ihr es “von alleine” aufgeschnappt? Wie seid ihr in eurem Arbietsgebiet gelandet? War es eine bewusste Entscheidung, Zufall oder hat der Betreuer für euch entschieden? Wie viele “ewige Assistenten” kennt ihr?



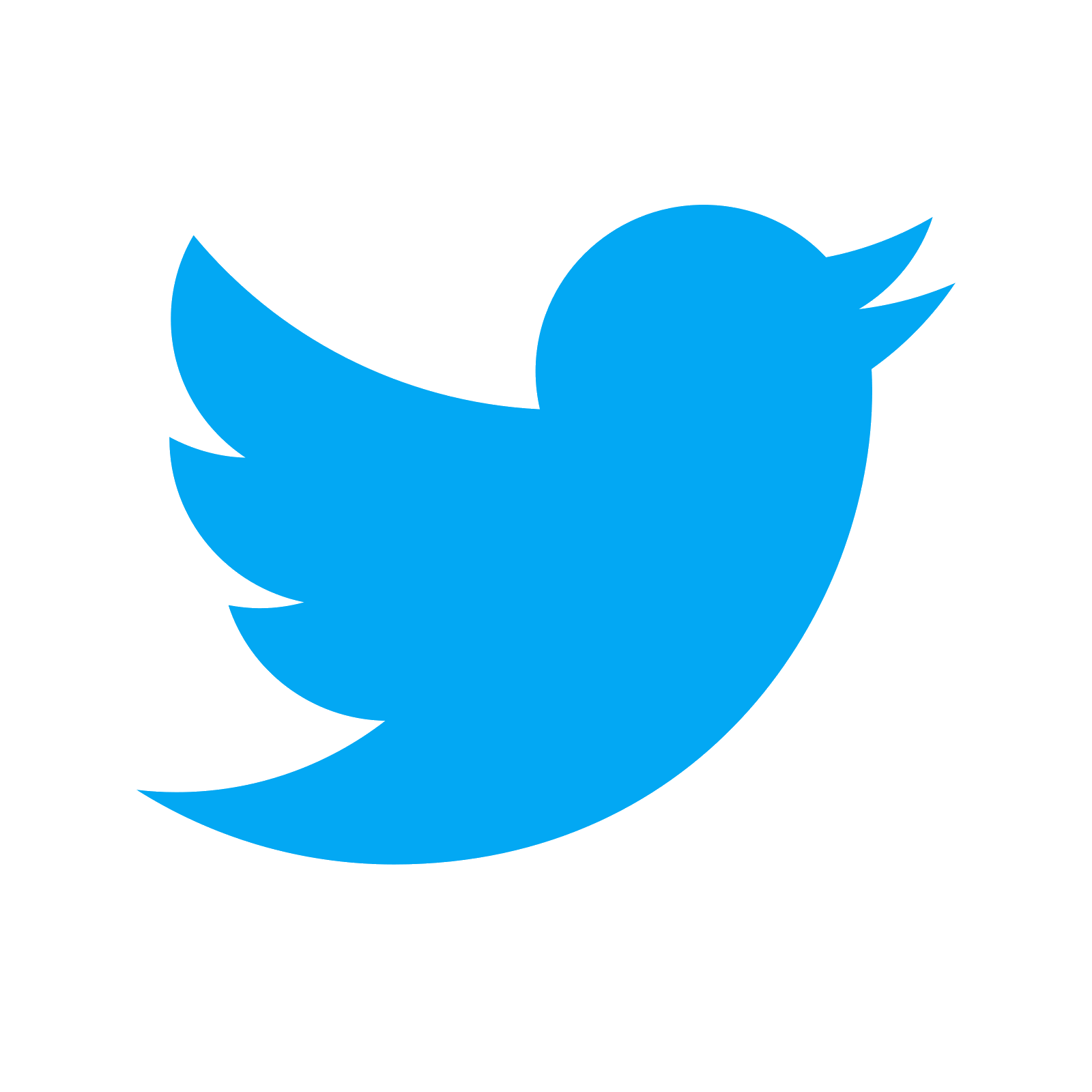







Kommentare (21)