In diesem Zusammenhang fällt zunehmend ein weiterer Begriff, welchen ursprünglich die verwirrenden Eigenschaften der Quantenphysik prägten: „Kontextualität“. Seit den 1920er-Jahren wissen die Physiker, dass Quantenobjekte keine eigenständige Form des Seins besitzen, zumindest keine, die sich veranschaulichen lässt. Erst durch Wechselwirkung mit einer Umgebung erhalten sie ihre konkrete Manifestation und Form. Mit anderen Worten, Quantenobjekte besitzen keine Realität an sich, sondern nur noch eine „kontextuell“, d.h. aus dem spezifischen Zusammenhang ihrer Umgebung, definierte Existenz. Biologen wiederum kennen die Phänomenologie von Emergenz und Kontextualität bereits seit längerem. Sie wissen, dass auf höheren Organisationsebenen Merkmale auftreten, die sich nicht aus Komponenten niedrigerer Ebenen hergeleitet lassen. So ist beispielsweise das Verhalten einer einzigen Ameise recht einfach. Sie folgt klaren, nahezu mechanischen Regeln der Nahrungssuche, Nestbau, Geruchsreaktionen, etc. Im Verbund (Kontext) vieler Ameisen entsteht allerdings eine Kolonie, die ein erstaunlich komplexes Verhalten aufweisen kann und sich sogar an veränderliche äussere Umstände anzupassen vermag.
Auch die Eigenschaften von lebenden Zellen sind nicht aus sich heraus, d.h. alleine aus den Eigenschaften ihrer selbst und ihrer Bestandteile, zu verstehen. Ohne die äusseren Umstände, den Kontext, in dem eine Zelle lebt, wie Nährumgebung, pH-Wert, andere Zellen, etc. kann das Verhalten einer Zelle kaum bestimmt werden. Wie die Genforscher unterdessen wissen, gilt das sogar auf Stufen unterhalb der Zelle. Sie vermögen unterdessen äussere, d.h. nicht in der DNA codierte Faktoren, zu bestimmen, welche die Aktivität von einzelnen Gens zu steuern vermögen. Mit andere Worten, ohne im Genotyp explizit vorzuliegen, beeinflussen diese ausserhalb der Genexpression wirkenden Faktoren den Phänotypen. Im Zusammenhang mit entsprechenden (erblichen) Veränderungen in der Genomfunktion, die zusätzlich zu den genetischen, d.h. direkt durch die mit der DNA-Sequenz gegebenen Bestimmungen wirken, und welche ihren Ursprung zumeist in Umwelteinflüssen haben, denen das Lebewesen ausgesetzt ist, sprechen Biologen von „Epigenetik“. Epigenetische Wirkungsmechanismen zeigen auf, was Psychologen, Pädagogen und Soziologen schon lange behaupten: Lebewesen sind weit mehr als das Ergebnisse ihrer Gene, sondern erhalten ihre Eigenschaften, Fähigkeiten und Möglichkeiten immer auch durch Wechselwirkung mit der Umgebung, in der sie leben.
So schwingt die Diskussion um Reduktionismus und Holismus heute in wesentlich differenzierteren Tönen. Doch auch im 21. Jahrhundert werden die Diskussionen um die Erfassung der Natur kaum, wie noch in der Romantik gefordert, unter dem Primat von Empfindungen, Gefühlen und mystischer Intuition geführt. Und das „kalte und künstliche Experiment“ bleibt von Seiten der Wissenschaft das Mittel der Wahl, um zu tieferen Wahrheiten des Lebens und der Welt zu gelangen. Zugleich haben die Naturwissenschaftler erkannt, dass ihre Untersuchungsgegenstände Erscheinungen und Prozesse hervorrufen können, die eigengesetzliche Dynamiken zeigen, welche sich nicht mehr alleine aus den Eigenschaften ihrer Bestandteile erfassen lassen. Und einzelne Systeme wiederum weisen je nach ihrem Umfeld, in welchem sie sich befinden, ein sehr spezifisches und idiosynkratrisches Verhalten auf. So kann ein physikalisches System auf ganz nicht-mystische Art und Weise „Bestandteil eines grösseren Ganzen“ sein.
Doch noch immer können Anti-Reduktionisten auf so einige Felder verweisen, die noch nicht wissenschaftlich erfassbar sind und wohl selbst von denen, die sie als grundsätzlich wissenschaftlich erfassbar halten, kaum dahingehend charakterisiert werden, dass sie sich auf einfache Einheiten und Prinzipien reduzieren lassen. So wird das Bewusstsein bzw. der Geist oft als ein Phänomen angesehen, das sich grundsätzlich einer rein naturwissenschaftlichen oder gar reduktionistischen Beschreibung entzieht. Philosophen sehen den Grund dafür darin, dass mentale Zustände die Eigenschaft haben, „auf bestimmte Weisen erlebt zu werden“. Wenn man seine Hand in heisses Wasser hält, so laufen nicht nur bestimmte biologische Prozesse ab, sondern es tut schlicht auch weh. Die biologischen Prozesse alleine machen es kaum oder vielleicht gar nicht verständlich, warum wir so etwas wie Schmerzen erleben. Auf einer noch höheren Ebene wiederum lässt sich die moralische Bewertung von Handlung kaum naturwissenschaftlich beschreiben. Denn moralische Begriffe sind normativ, ganz im Gegensatz zur deskriptiven Natur naturwissenschaftlicher Beschreibungen. Gleiches gilt für ästhetische Eigenschaften.



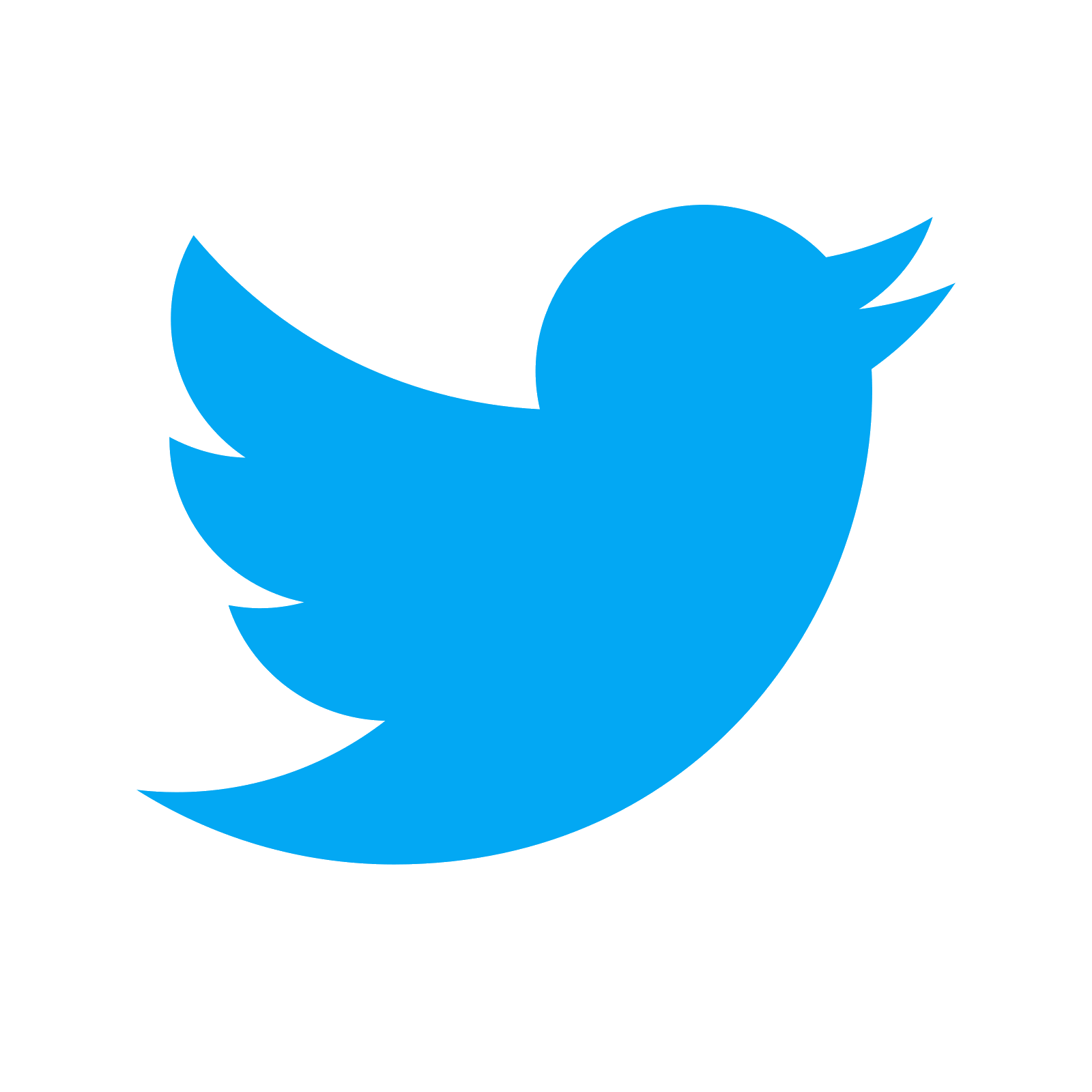







Kommentare (54)