 Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2017. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.
Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2017. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.
——————————————————————————————————————
Ach, das ganze Wein-Blabla… Kommt es denn nicht allein darauf an, wie es mir schmeckt?
Von 2xhinschauen
Ich habe schon viel geschrieben in meinem Leben, beruflich wie privat. Dies ist das erste Mal, dass ich etwas im engeren Sinne „veröffentliche“. Entsprechend groß ist meine Aufregung.
Wie vieles im Leben macht auch die Wissenschaft – hier im Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft, Wahrnehmungspsychologie und Önologie – am meisten Spaß, wenn es dabei was Anständiges zu trinken gibt. Die Sciencebusters machen das ja auch gern zum Thema auf der Bühne. „Kein schlechter Ansatz für Deinen ersten Wissenschaftsblogbeitrag,“ dachte ich mir. Die korrekte Antwort auf die Frage im Titel lautet nämlich „Äh, nun ja, also…“, und ich möchte versuchen, diese klar formulierte Hypothese wissenschaftlich proper zu begründen.
Ich beginne gleich mal mit einem Augenöffner-Experiment:
- Man durchmische etwas Kristallzucker und Zimtpulver
- Man halte sich die Nase fest(!) zu, gebe das Gemisch mit einem Kaffeelöffel auf die Zunge und prüfe ernst und konzentriert den Geschmack
- Man schließe nun die Augen und gebe danach die Nase frei
- Man versuche, beim jetzt eintretenden Erlebnis die Augen geschlossen zu halten

Zimt und Zucker dienen ja sonst eher dem Milchreis. Hier dienen sie einmal der Wissenschaft. (Bildquelle: Autor)
Führen Sie das Experiment durch, auch wenn ich gleich andeute, wie es ausgeht, Sie also dem Risiko der Voreingenommenheit (Bias) aussetze. Man soll eben nicht mit Annahmen arbeiten, wenn man Evidenz haben kann.
Und? Hat’s ordentlich geknallt im Kopf?
Die Zunge ist zur Unterscheidung von nur vier (manche sagen: fünf) Geschmackswahrnehmungen in der Lage: Süß, sauer, salzig, bitter (und, angeblich, „umami“). Die unglaublich vielen Nuancen, die wir zu unterscheiden vermögen, sind nämlich nicht Geschmack, sondern Geruch, der durch den Kanal zwischen Nasen- und Rachenraum zu den Riechzellen gelangt.
Dazu kommt die Textur, das ist die mechanische Wahrnehmung im Mund. Ein Apfel fühlt sich anders an als Schlagsahne und diese anders als Brot. Es ist wichtig für den Genuss, dass die Textur „stimmt“, und das gilt auch beim Wein. Der Gehalt an bitzelnder (Rest-)Kohlensäure mindert den Süßeeindruck (rühren Sie mal die Kohlensäure aus einem Glas „trockenem“ Sekt heraus), und sogar verschiedene Rebsorten weisen subtile Unterschiede auf. Burgundersorten werden z.B. bisweilen als „cremig“ beschrieben, was natürlich, wie manch anderes Weinwort, nur eine hilflose Umschreibung für das Gefühl ist, das man beim Probieren hatte.
Wenn Sie nun gefragt werden, wie das Zucker-Zimt-Gemisch denn geschmeckt hat, werden Sie bestimmt nichts Anderes sagen können als „nach Zucker und Zimt.“ Oder finden Sie andere Wörter für den Geschmack von Zimt?
Bei Farben ist das einfacher: Da können wir ein Spektrometer dranhalten, und bei einer Wellenlänge von 555 Nanometer wissen wir: Ah, ein schönes sattes Grün, auch ohne das Objekt selbst gesehen zu haben. Wir können zwar nicht wissen, wie „grün“ im Kopf einer anderen Person aussieht, doch ist die Wellenlänge ein objektives Maß für die Farbe. Komplexer, aber nicht unähnlich ist es beim Hörsinn.
Gesehene und gehörte Sachverhalte sind zu einem gewissen Grad objektiv mess- und beschreibbar. Was wir bei einer bestimmten Seh- oder Hörwahrnehmung empfinden, ist gleichwohl eine ganz andere Sache, und dahin ist sie wieder, die Objektivität.
Kann man Geschmack messen?
Nun funktionieren Geruch und Geschmack nicht optisch oder akustisch, sondern chemisch und mechanisch. Sie sind gewissermaßen eine stark differenzierte Schmerzwahrnehmung. Es gibt zudem viel mehr geschmacksrelevante Molekülvarianten und -mischungen, als es sinnvoll unterscheidbare Frequenzen im sicht- oder hörbaren Spektrum gibt, und es gibt auch keine lineare Skala. Das macht die „objektive“ Beschreibbarkeit schwierig. Beim Schmerz hat man immerhin, wenngleich wissenschaftlich folgenlos, versucht, seine Intensität zu messen und in einer Maßeinheit „dol“ auszudrücken.
Die Medizin weiß inzwischen, dass Schmerzen (naturgemäß viel mehr Empfindung als Wahrnehmung) keine immer und eindeutig bestimmbaren Ursache-/Wirkungsbeziehungen kennen, schon gar keine proportionalen, und dass sie das für Placebo-Behandlungen zugänglichste Symptom sind. Letzteres gilt demnach auch für Geruch und Geschmack, wie wir noch sehen werden.
Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen, genau das eine Molekül zu identifizieren, dass den typischen Zimtgeruch auslöst. Dann könnten wir einem Freund die Strukturformel mailen und er würde wissen, wie unser Experiment gerochen hat.
Beim Spargel ginge das sogar noch (Asparagusinsäure), aber viele andere Aromen sind dafür aus zu vielen verschiedenen Molekülen zusammengesetzt. Im Wein sind es hunderte, die entweder direkt aus der Beere stammen („primäre Aromen“) oder die bei der Gärung entstanden sind („sekundäre“) oder während der Reifeprozesse bei der Lagerung („tertiäre“). Man hat bisher nicht mal alle einzeln identifiziert. Und selbst wenn, wäre das vielleicht für Biologen und womöglich für Pharmakologen (Resveratrol) interessant, würde uns bei der mündlichen Beschreibung von Aroma und Geschmack aber nicht helfen. Denn dazu müssten alle Menschen für alle der meist schwachen Einzelaromen im Wein gleich empfindlich sein. Das ist aber nicht der Fall: Der eine nimmt einen zarten Pfirsichduft wahr, der andere eben nicht.
Grüner Wein
Und schon sind wir beim Hauptgrund dafür, dass die snobistisch anmutende Weinsprache überhaupt existiert: „Mhm, gelbe Früchte, etwas Limone, sehr mineralisch“ … wie bitte, fragen Sie? Ich dachte, das sei Wein? Aus Weintrauben?!
Doch, ist es. Aber wussten Sie denn, dass Rotwein auch grün schmecken kann?
Weil man Geschmack und Geruch nicht objektiv darstellen kann, muss man eben einen Beschreibungswortschatz vereinbaren, unter dem alle möglichst dasselbe verstehen. Das Wort „mineralisch“ ist so eine Konvention. Es hat nichts mit Steinchen oder einem hohen Mineralstoffgehalt zu tun, sondern nur mit einer Einigung in der Fachwelt: Man probiert gemeinsam, und wenn alle finden, dass das jetzt „mineralisch“ schmeckt, dann weiß man irgendwann mit diesem Wort umzugehen. Aktuelle Forschung korreliert diese „Mineralität“ mit dem Vorhandensein bestimmter Substanzen, aber der sensorische Zusammenhang ist noch unbekannt.
Die Natur hilft uns allerdings bei der Beschreibung, weil die Evolution für neue Herausforderungen immer gern auf schon vorhandene Fähigkeiten zurückgegriffen hat. Was etwa im Weißwein wie Apfel oder Aprikose riecht, sind tatsächlich dieselben Moleküle wie in Äpfeln und Aprikosen, nur sind es im Wein jeweils viel weniger, und es kommen viel mehr verschiedene Aroma-Moleküle vor.
Restzucker, Säure und Fruchtaromen sind aber längst nicht alles, was im Wein riecht und schmeckt. Eine Substanz, die zum Süße- und Fruchteindruck beiträgt, ist beispielsweise Glycerin. Ferner rundet eine Gruppe von Phenolen das Bild ab, die so genannten Tannine.
Tannine (Gerbstoffe) im Wein stammen aus den Schalen und Kernen der Weinbeeren und aus dem Holz des Fasses, in dem viele Weine nach der Gärung gelagert werden. Nicht nur, aber besonders bei manchen Rotweinen wählt man dafür kleine Fässer (Barriques), um dem Wein dank der größeren Kontaktfläche pro Volumeneinheit mehr Tannin mitzugeben. Das „gibt ihm Struktur“ als Gegengewicht zur auch im trockensten Wein vorhandenen Fruchtsüße.
Gerbstoffmoleküle sind anfangs eher klein und in Geschmack (oft adstringierend = die Zunge leicht betäubend) und Geruch (erinnert an Vanille) leicht erkennbar. Im Zuge der Reifung verbinden sich die kurzen zu längeren Molekülen und sind dann weniger deutlich wahrnehmbar, dienen aber weiterhin der Verlangsamung der übrigen Reifeprozesse und damit der Lagerfähigkeit. Diese Reaktion tritt auch beim Sauerstoffkontakt nach dem Öffnen der Flasche auf, weshalb man „tanninige“ Rotweine eine Weile vor dem Trinken in eine Karaffe umfüllt (dekantiert).
Junge Rotweine mit hohem Tanningehalt enthalten also „unreife“ Tannine und schmecken folglich, daher die Wortwahl, „grün“.
Nun wird’s empfindsam
Ok, sagen Sie, der Geschmack ist also schwer beschreibbar, das habe ich verstanden. Dann nehme ich einfach einen Schluck, und dann weiß ich doch Bescheid?
Leider nein. Denn nun kommen wir von den Faktoren, die die Sinneswahrnehmung ausmachen, zu denen, die die Empfindung beeinflussen. Wir Menschen sind ganz schlecht darin, das zu unterscheiden, also intuitiv die Einflüsse dingfest zu machen, die sich nicht mit dem chemischen und mechanischen Kontakt auf der Zunge und in der Nase erklären lassen.
Ein Beispiel für einen solchen Parameter ist das Ambiente. Viele von Ihnen sind gewiss Biertrinker und haben schon die Erfahrung gemacht, dass Sie in dem einen Lokal die eine und im anderen die andere Marke oder Sorte bevorzugen. Dazu kommen verschiedene Anlässe wie Grillen oder Fußballgucken, und man trinkt sein Bier mal aus Tulpen, mal aus bauchigen Gläsen und mal aus der Flasche, und immer fühlt sich das in dem Moment richtig an.
Letzteres lässt sich in einem einfachen Experiment testen, damit wir nicht vollends im Theoretischen bleiben. Besorgen Sie sich einen Wein, der ein deutliches Aroma hat. Das gilt nicht für jeden Wein, und jeder Tester nimmt ja gleiche Geruchsreize unterschiedlich stark wahr, das hatten wir oben schon. Bei Weißwein wäre z.B. die Rebsorte Sauvignon Blanc eine gute Wahl, deren oft recht kräftiges Aroma gerne mit „grasig, kräutrig, hollundrig“ beschrieben wird. Auch andere Sorten mit ausgeprägtem Bukett wie Gewürztraminer (Rosenduft!) und Muskateller kommen infrage.
Schenken Sie den kühlschrankkalten Weißwein in ein kleines Probierglas (Kontrollgruppe, Nullhypothese) und in ein möglichst großes Weinglas ein (Verumgruppe). Verkosten Sie die Proben genau so, wie es die Profis tun, mit viel Schwenken und Schnuppern. Was beobachten Sie?
Die Sache mit den verschiedenen Gläsern ist offenbar weder Esoterik noch Snobismus, wenn man es nicht wie im Bild gezeigt übertreibt. Das Geschmacksempfinden ist, wie es scheint, auch vom Glas abhängig, obwohl Moleküle und Sinnesorgane doch jedesmal dieselben sind. Man kann zwar sagen, dass der Hohlraum im Glas und die Größe der Oberfläche der Flüssigkeit in Relation zum Volumen es dem Tester leichter machen, das Aroma wahrzunehmen, aber gewiss wirkt hier zusätzlich das Placebo einer positiven Erwartungshaltung bei edel aussehenden Gläsern.
Denn auch Anmutung und Gewicht des Glases spielen eine Rolle, also ob es ihnen leichter oder schwerer in der Hand liegt. Das überträgt sich auf die Wahrnehmung des Glasinhalts. Edle Gläser sind nicht dünnwandig und zierlich, um edel zu sein, sondern um leicht zu sein.
Und das war nur das Glas, ein gut isolierbarer Einzelfaktor. Die Wissenschaft macht das ja so: einzelne Einflussgrößen isolieren und getrennt untersuchen. Erweitern wir unsere Forschung nun auf die gesamte Umgebung. Und auf Bier. Damit Sie sehen, dass das hier kein reines Weinblabla ist. Sondern auch Bierblabla.
Das ist nicht mein Bier!
Vor Jahren habe ich von einem Experiment gelesen (ich bin nicht gut darin, mir systematisch Quellen zu notieren), bei dem man Probanden verschiedene Biersorten verkosten ließ, und zwar wortwörtlich unter Laborbedingungen: Neonlicht, Kacheln, Laborkittel, Plastikbecher, Fragebögen. Zum Abschluss hat man die Teilnehmer nach einem Tag strenger Wissenschaft zur Belohnung noch in ein nahegelegenes Lokal eingeladen, das viele Sorten auf der Karte hatte.
Der entscheidende Test fand in Wirklichkeit hier statt, aber das wussten die Teilnehmer natürlich nicht. Man hat ihre Bestellungen notiert und sich entspannt über die jeweiligen geschmacklichen Vorlieben beim Bier, dem Thema des Tages, ausgetauscht. Kaum einer der Probanden hatte unter Neon- statt Kneipenlicht, zwischen Kacheln statt dunklem Holz dieselben Präferenzen, und ich meine mich zu erinnern, dass sie tagsüber im Durchschnitt eher herbe und am Abend eher etwas süffigere Sorten bevorzugten.
Sie können diesen Versuch zu Hause durchaus replizieren. Auch das kritische Nachstellen von Experimenten ist elementare Wissenschaft. Überlegen Sie sich ein Setup zur Verblindung Ihrer Studie und zur Täuschung Ihrer Versuchskaninchen bezüglich der eigentlichen Forschungsfrage. Einen gekachelten Raum werden sie zuhause sicher irgendwo finden. Hauptsache, Sie haben Spaß!
Eine halbe Stunde Urlaub
Man mag hier einwenden, dass das obige Studiendesign nicht allein die Umgebungsabhängigkeit des Geschmacksempfindens testet, weil der Faktor „Stimmung“ (hier: Konzentration im Labor vs. Entspannung in der Kneipe) nicht herausgehalten wurde.
Es ist in der Tat evident, dass sich das, was wir „Befinden“ und „Stimmung“ nennen, vermittels Hormonen auf die Körperchemie auswirkt – und umgekehrt, man denke an entsprechende Medikamente. Und es ist plausibel anzunehmen, dass sich die Körperchemie ihrerseits auf das Geschmacksempfinden, die Genussfähigkeit und die entsprechenden Vorlieben auswirkt: Wir wissen alle, dass die nicht jeden Tag gleich sind.
Hierzu hätte ich einen Selbstversuch anzubieten, wissenschaftlich von geringem Wert, aber für Sie persönlich vielleicht ganz nützlich. Wer hat noch nicht erlebt, dass ein landestypisches Getränk im Urlaub wunderbar war und zuhause gar nicht mehr schmecken wollte? Was ist da los?
Nun, das lässt sich reparieren. Haben Sie ein solches Mitbringsel noch da? Natürlich mit der richtigen Temperatur und nicht aus einer schon lange angebrochenen Flasche. Nehmen wir einen trockenen Sherry als Beispiel, den Sie im Spanienurlaub gerne als Aperitif hatten und der Ihnen zuhause nur noch kratzig und bitter vorkommt. Natürlich funktioniert das ganze auch mit Genever vom holländischen Nordseestrand, einem Obstler aus den Alpen, einer Kräuterlikörspezialität aus Zypern usw.
Waren Sie zu zweit unterwegs? Dann machen Sie es sich mit Ihrem Lieblingsmenschen auf dem Sofa, im Garten oder an einem Ufer gemütlich. Kommen Sie zur Ruhe, machen Sie eine halbe Stunde Urlaub. Erinnern Sie sich daran, wo und wie Sie den Sherry genossen haben, sagen wir (wo sonst) an der Costa de la Luz auf der Hotel- oder Strandterasse mit Blick nach Westen auf den nahenden Sonnenuntergang (die rötliche Lichtfärbung wird uns auch noch beschäftigen). Haben Sie Fotos? Natürlich haben Sie welche. Kramen Sie sie heraus.
War es warm? Windig? Erinnern Sie sich an die Umgebungsgeräusche, die Gerüche in der Luft, das Gefühl auf der Haut! Was gab es zu sehen? Haben Sie sich mit netten Menschen unterhalten? Versinken Sie mit allen Sinnen in dieser schönen Urlaubserinnerung. Nehmen Sie nun einen Schluck. Wie schmeckt es Ihnen jetzt?
Der Geschmack bringt Ihnen die Stimmung ja offenbar nicht zurück. Aber die Stimmung bringt den Geschmack zurück!
Wir ersetzen hier die tatsächliche Umgebung durch die Erinnerung daran, äußere Einflüsse durch eine Stimmung, in der Hoffnung auf denselben neurologischen Effekt. Das Gehirn kann nicht so gut zwischen Erlebtem, Erinnertem, Eingebildetem und Eingeredetem unterscheiden, wie wir glauben, ein großes Problem in der Rechtswissenschaft und Gegenstand der Forschung.
Ein versierter Winzer wird Ihnen Blumiges über seine Produkte berichten, von allerlei Früchten, der Arbeit seiner Vorfahren und von leckeren Gerichten, die zu seinem Wein passen. In der Autowerbung sind die Fahrzeuge immer ganz allein auf der Straße. Außer einigen Brauereien hat niemand mehr grüne Natur in seiner Werbung als die Hersteller von Gesundheits- und Kosmetikprodukten. Alle, die Ihnen etwas verkaufen wollen, auch Politiker, pflanzen Ihnen Bilder in den Kopf, entweder unmittelbar oder durch Assoziationen, geschickte Wortwahl usw. Man nennt das „Anker setzen“, die Erzeugung einer gewissen Voreingenommenheit zugunsten oder zulasten einer bestimmten Sache. Bilder sind ein sehr wirkmächtiger Mechanismus, mehr als Worte je sein können.
Wenn Sie diesen Selbstversuch ein paarmal wie beschrieben machen, konditionieren Sie sich. Dann wird der Sherry zum Anker, holt das Urlaubsfeeling zurück und schmeckt prima, ohne dass Sie sich dafür noch groß anstrengen müssten. Nur dass Sie wahrscheinlich nicht genug davon mitgebracht haben. Genießen Sie, was Sie haben, solange Sie es haben.
Mehr Licht
Haben Sie meine Andeutungen bemerkt, dass die Art der Beleuchtung für sich alleine betrachtet einen Einfluss auf das Geschmacksempfinden haben könnte? Kneipenlicht, Sonnenuntergang? Das war natürlich Absicht als Hinführung zu dem folgenden, wie ich finde, ziemlich schrägen Versuch. Diesmal ist es eine Beobachtungsstudie, die trotz Verzicht auf die Kontrollgruppe eine einzelne Einflussgröße herausarbeitet.
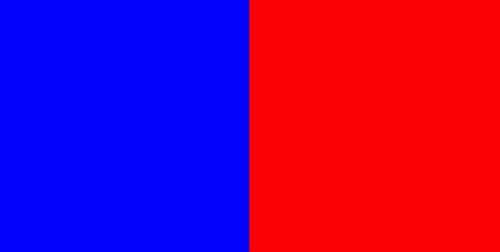
Auch wenn Sie kein Synästhet sind, können Sie feststellen, wie Farben schmecken. (Bildquelle: Autor)
Was Sie brauchen: Ein paar Freunde, einen Raum mit weißen Wänden (als Reflektionsfläche), Deckenleuchten oder besser Stehlampen, jeweils möglichst hell, die man abhängen kann, und einen geeigneten Weißwein mit nicht zu geringer Säure. Die beste Wahl ist hier ein Riesling Classic. „Classic“ bezeichnet Gutsweine (keine bestimmte Lage) aus einer für das Anbaugebiet typischen Rebsorte (Riesling ist mittlerweile fast überall „typisch“), der „fruchtig trocken“ schmecken soll und daher einen Restzuckergehalt zwischen trocken und halbtrocken hat. Wein, der ohne Blabla einfach nur wie Wein schmeckt, das ist der Anspruch.
Weiters brauchen Sie rote und blaue Tücher, Lampionpapier o.ä. Optimal wären Moodlights, wenn der Raum damit hinreichend hell ausgeleuchtet werden kann. Sorgen Sie für eine stark rotstichige Beleuchtung, schenken Sie ein und lassen Sie Ihre Gäste den Wein beschreiben. Wechseln Sie nun auf blaues Licht, und schauen Sie in die Gesichter, wenn sie den nächsten Schluck probieren. Nehmen Sie ruhig selbst an dem Versuch teil.
Der Effekt, den Sie erleben werden, ist in einer Studie an der Uni Mainz bestätigt worden. Er ist real und steht im Einklang mit anderen Untersuchungen des Einflusses von Gegenstands- und Umgebungsfarben auf die Stimmung (z.B. diese aus 2017 – der Abstract enthält eine lange Literaturliste zu verwandten Studien), die wie gesehen mit dem Geschmacksempfinden interagiert.
Blaue Lichtquellen kommt in der Natur nicht vor. Es lässt sich evolutionspsychologisch spekulieren, dass eine blauleuchtende Umgebung den älteren Hirnarealen suspekt vorkommt und sie ihren Eigentümer mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhöhter Vorsicht mahnen. Da schmecken dann auch Süßigkeiten sauer oder bitter – als Warnsignal: Iss hier besser nichts! Diese Deutung passt zu aktuellen Ergebnissen, dass uns blaustichiges Licht von Smartphones und Tablets beim Lesen im Bett am Einschlafen hindert. Unserem Hirn ist Schlaf unter solchen Bedingungen vielleicht einfach zu gefährlich.
Zu guter Letzt noch ein paar Placebos: Auch die Erwartungshaltung beeinflusst das Geschmacksempfinden. Es hilft, wenn Ihnen das Etikett gut gefällt. Wein schmeckt auch besser, wenn man ihn für teuer hält. Das ist in Studien gezeigt worden, die man auch zuhause leicht reproduzieren kann, sofern man den Versuch ordentlich verblindet.
Finden Sie einen Winzer, bei dem Sie einen Tag lang als Lesehelfer arbeiten können. Nicht einen, der das gegen Geld als Event anbietet, sondern einer, der das unter Anleitung zur Kundenbindung einsetzt und Ihnen Leselohn in Naturalien mitgibt. Kein Wein schmeckt besser als der, den Sie im Vorjahr selbst geerntet haben.
Und, ja, auch Vorwissen hilft. So wie man sich statt eines anonymen Kunstdrucks lieber ein Originalwerk ins Zimmer hängt, dessen Urheber man kennt und mit dem man über Farben, Komposition, Technik und Intention diskutiert hat, so trinkt man lieber einen Wein, den man beim Winzer selbst abgeholt und der einem die Rebsorte, die Lage und die Jahrgangsbesonderheiten auseinandergesetzt hat.
Fazite
Ist es nicht faszinierend, welchen Manipulationen Ihre Sinneswahrnehmungen auf den paar Zentimetern Transportweg unterliegen, bevor sie Ihrem Bewusstsein zugänglich sind? Und wie man den Genuss durch analytische Betrachtung sogar noch steigern kann? Naturwissenschaftler haben das sogar zu ihrem Beruf gemacht.
Beim Wein (und manch anderem) zählt der reine Geschmack weniger als der letztendliche Genuss – das, was tatsächlich im Bewusstsein ankommt. Wie Wein „wirklich“ schmeckt, ist objektiv kaum feststellbar und, wie gesehen, strenggenommen der unwichtigste Faktor überhaupt, sofern die allgemeine Richtung für Sie halbwegs passt, also Süße, Säure, Gerbstoffe und Textur. Inwieweit man mit Kant die Erkennbarkeit des „Dings an sich“ oder mit den Idealisten dessen Existenz gleich ganz in Zweifel ziehen muss, bleibe hier mal dahingestellt.
Die Eingangsfrage („Kommt es nicht allein darauf an, wie es mir schmeckt?“) kann also nur dann bejaht werden, wenn sie auf den Moment und die Umstände bezogen ist. Nichts schmeckt Ihnen immer gleich.
Wenn Sie mithin auf wissenschaftlich fundierte Weise selbst dafür sorgen wollen, dass Ihnen der Wein, den Sie ohnehin gerade vor sich haben, besser schmeckt, dann:
- Trinken Sie ihn aus dem richtigen Glas.
- Sorgen Sie für ein angenehmes Ambiente.
- Informieren Sie sich über den Wein oder zumindest über ein paar der Wörter, die auf dem Etikett stehen, zur Not adhoc im Internet (Qualitätsstufe, Rebsorte, Herkunftsregion, Weingut, …)
- Fassen Sie Ihre Eindrücke in Worte. Dadurch genießen Sie bewusster, lernen dabei etwas Weinsprache und kommen ins Gespräch. Auch beim Wein gibt es keine „falschen“ Wörter zur Beschreibung der eigenen Eindrücke.
- Seien Sie guter Laune. Andernfalls sollten Sie sowieso nichts Alkoholisches trinken.
- Der allerbeste Rat ist, Wein im entspannten Familien- und Freundeskreis zu genießen.
Letzteres ist sowieso der beste Tip für mehr Lebensglück, auch ganz ohne gemeinsamen Drogenkonsum.




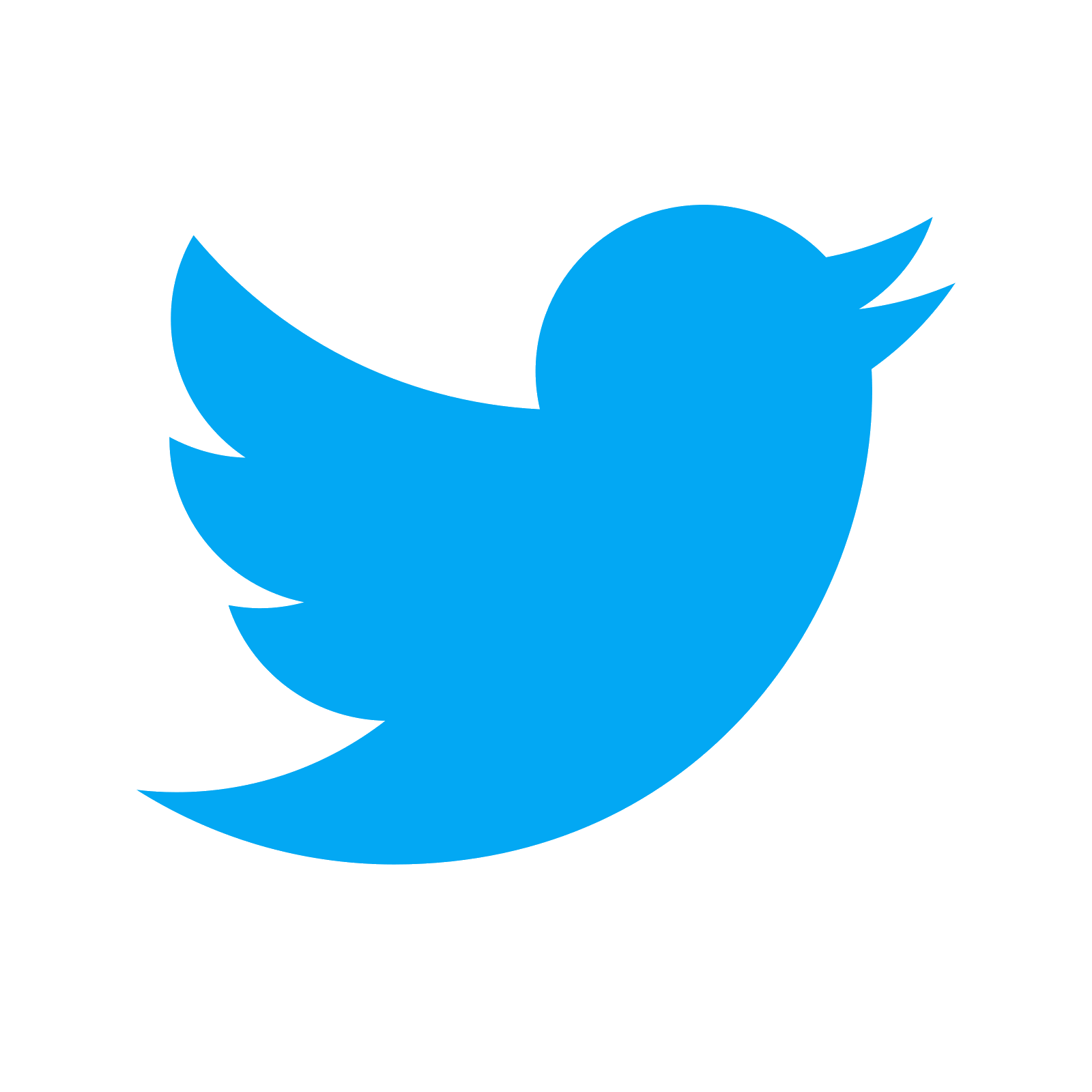







Kommentare (39)