Wie wir gesehen haben, gibt es ein Wechselspiel zwischen Energie und Entropie: Bei extrem niedrigen Temperaturen (am absoluten Nullpunkt) gewinnt immer die Energie und jedes System befindet sich im Energieminimum, also in dem Zustand mit der kleinstmöglichen Energie. Deshalb gefriert Wasser irgendwann zu Eis (weil im Eiskristall die Moleküle stärker gebunden sind und deshalb weniger Energie haben – man muss Schmelzwärme reinstecken, um das Eis aufzutauen), deshalb löst sich in Gold bei niedrigen Temperaturen kein Nickel usw.
Erhöht man die Temperatur, ergibt sich eine Konkurrenz zwischen Energie und Entropie: Je höher die Temperatur ist, desto eher finden wir ein System in einem Makrozustand, der nicht die niedrigste Energie hat (obwohl der Mikrozustand mit der niedrigsten Energie immer der Wahrscheinlichste bleibt), weil es für die anderen Makrozustände mehr Mikrozustände gibt – und genau dafür war die Entropie ja ein Maß. (Zur Erinnerung: Makrozustände sind die, die sich makroskopisch durch Messungen von Größen wie Druck, Volumen etc. beschreiben lassen, bei Mikrozuständen wird dagegen das Verhalten jedes einzelnen Atoms exakt beschrieben. Deshalb gehören zu einem Makrozustand oft sehr viele Mikrozustände.)
Dieses schöne Wechselspiel zwischen Energie und Entropie kann man in einer einfachen Beziehung ausdrücken: In einem System bei Temperatur T (und bei konstantem Volumen) betrachtet man folgende Größe:
F = U – TS
U ist dabei die Energie des Systems – bisher hatte ich dafür immer E genommen, aber bei den Thermodramatikern ist U einfach üblich, T ist die Temperatur und S die Entropie. Die Größe F heißt “Freie Energie” (bei den Chemikerinnen gern auch Helmholtz-Energie, die nehmen auch gern den Buchstaben “A” dafür). Sie wird im Gleichgewicht minimal.
Will man also wissen, welchen Zustand ein System bei Temperatur T annimmt, dann berechnet man für alle Zustände die Energie U und die Entropie S. Das System nimmt dann den Zustand niedrigster Freier Energie ein.
Zu abstrakt? Machen wir es doch konkreter: Nehmen wir Wasser und Eis. Die Energie U im Eis ist sicher niedriger als im flüssigen Wasser (weil da ja die Bindungen stärker sind). Die Entropie S ist im Eis sicher auch niedriger, weil es viel weniger Möglichkeiten gibt, die Eismoleküle in einem Kristall anzuordnen (wo sie nur ein bisschen schwingen dürfen), während sie im flüssigen Wasser wild herumpurzeln dürfen.
Jetzt zeichnen wir die Freie Energie als Funktion der Temperatur. Bei niedrigen Temperaturen spielt die Entropie keine Rolle (weil sie ja mit T multipliziert wird), hier muss also der Wert für Wasser über dem für Eis liegen. Wenn wir (vereinfacht) annehmen, dass die Entropie und die Energie selbst nicht von der Temperatur abhängen, dann haben wir wegen des Minuszeichens Linien, die nach rechts hin abfallen, und zwar um so steiler, je größer S ist:
Es gibt also einen Wert der Temperatur, bei dem sich beide Linien schneiden. Wenn wir die Freie Energie minimieren wollen, dann müssen wir unterhalb dieses Schnittpunkts Eis haben, oberhalb (also bei höheren Temperaturen) Wasser. Wir haben damit erklärt, warum Eis schmilzt.
Für die Gold-Nickel-Legierung vom letzten Mal geht die Erklärung qualitativ genauso, die genaue Berechnung verbanne ich mal wieder hinter ein Warnschild.
Den Zusammenhang zwischen Entropie und freier Energie können wir sehr schön auch am Beispiel der Nickel-Gold-Legierung vom letzten Mal sehen. Dort war die Entropie für ein gelöstes Goldatom ja S=k ln N^2 = 2 k ln N. Für den Fall getrennter Phasen hatten wir (vereinfacht) S=0 angesetzt. Der Energieunterschied war Em. Die Freie Energie für den Grundzustand ist also immer Null, die für den Zustand mit einem gelösten Atom ist
Fm = Em – T S = Em – T 2 k ln N .
Der Übergang findet (wie beim Wasser) bei der Temperatur statt, bei der sich die beiden Linien kreuzen – da die Freie Energie für den Grundzustand Null ist, also genau dann, wenn die Freie Energie des Mischzustandes gleich Null wird. Aus Fm=0 folgt mit der Formel oben für die Temperatur des Übergangs
T=Em/2k ln N ,
genau wie beim letzten Mal. Das demonstriert (für diesen Fall), dass die Freie-Energie-Minimierung genau die Wahrscheinlichkeiten und Mikrozustände aus der Boltzmanngleichung p=exp(-E/kT)/Z beinhaltet.
Wie man die Entropie misst
Unsere bisherige Definition von Entropie über die Höhe eines Papierstapels (Zahl der Mikrozustände) hat einen großen Nachteil: In der Praxis ist es ziemlich aufwändig, immer die Zahl aller denkbaren Mikrozustände für einen Makrozustand zu berechnen. Es wäre schon praktisch, wenn man die Entropie auch messen könnte.
Das geht tatsächlich – genauer gesagt, misst man normalerweise Entropiedifferenzen, also die Zu- oder Abnahme von Entropie in einem System.
Um das plausibel zu machen, schauen wir uns ein einfaches Experiment an. Wir nehmen ein Gas in einem Behälter, der auf der einen Seite einen beweglichen Kolben hat, so ähnlich, wie wir das neulich beim Maxwellschen Dämon gemacht haben (aber jetzt mit einem Gas aus vielen Atomen). Dieses Gas ist mit einem Wärmebad verbunden, hat also immer eine Temperatur von T.
Das Gas im Behälter hat natürlich einen gewissen Druck und drückt deshalb auf den Kolben. Wir lassen das Gas jetzt den Kolben verschieben, aber gaaaaaaanz langsam. Weil das Gas auf den Kolben drückt, leistet es dabei Arbeit. (Praktisch könnten wir da z.B. eine Feder am Kolben anbringen oder ein Gewicht hochziehen lassen.) Das Gas verliert also Energie. Wäre es von der Außenwelt isoliert, dann würde es sich dabei abkühlen, denn Moleküle verlieren ja Bewegungsenergie an den Kolben und werden dabei langsamer. Da das Gas aber mit unserem Wärmebad in Kontakt steht, entzieht es dem Wärmebad Energie.
Nachdem das Gas sich ausgedehnt hat, ist seine Energie U dieselbe wie vorher (es hat dieselbe Temperatur, also haben die Moleküle auch dieselbe Geschwindigkeitsverteilung). Da es jetzt aber ein größeres Volumen zur Verfügung hat, ist seine Entropie (Zahl der Mikrozustände) gestiegen.
Wir können den Prozess auch wieder umkehren – die Feder drückt unser Gas wieder gaaanz langsam zusammen, und wir nehmen an, dass es keine Reibungsverluste oder ähnlichen Ärger gibt. Das Gas erwärmt sich beim zusammendrücken (wie man an einer Luftpumpe ausprobieren kann), gibt diese Wärme aber ans Wärmebad ab. Dann haben wir am Ende wieder den Anfangszustand: Ein Wärmebad, eine entspannte Feder und ein gas bei Temperatur T mit dem ursprünglichen Volumen. Also muss die Entropie des Gases (und auch seine Freie Energie) wieder denselben Wert wie am Anfang haben. Man nennt solche Prozesse, die man wieder komplett umkehren kann, “reversibel”.
Aber Moment – irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Beim Ausdehnen des Gases hat sich seine Entropie erhöht und dann beim Komprimieren wieder verringert. Die Entropie soll aber doch immer nur zunehmen, niemals abnehmen (weil es zu den Zuständen mit hoher Entropie ja viiiieeeelll mehr Mikrozustände gibt). Wie kann das sein?
Die Antwort ist einfach: Wir müssen das Wärmebad berücksichtigen – die Aussage, dass die Entropie niemals abnehmen kann, gilt ja nur für abgeschlossene Systeme. Wir müssen also das System Wärmebad+Gas betrachten. Wenn die Entropie im Gas zunimmt, muss die im Wärmebad abnehmen. Da dem Wärmebad Wärme entzogen wurde, muss die Abnahme der Entropie proportional zu dieser Wärme sein. (Sie muss proportional sein, denn ich könnte den Prozess ja zweimal hintereinander machen und würde dann die doppelte Entropie und die doppelte Wärme entziehen.) Da wir unser Wärmbad als riesig groß ansehen, ändert sich dabei seine Temperatur allerdings nicht nennenswert – mathematisch sauber müsste man hier mit infinitesimalen Größen hantieren, aber wer das will, kann ja Physik studieren…
Entropieänderung und Wärmeänderung sind also zueinander proportional. Wir brauchen noch die Proportionalitätskonstante, die die Wärmeänderung in eine Entropie umrechnet. Da die Entropie als Einheit [Energie/Temperatur] hat, ist folgende Definition zumindest plausibel.
ΔS = ΔQrev/T
Dabei ist S die Entropie, Q die Wärme, der Index “rev” steht für “reversibel”, und die Δ’s sollen andeuten, dass wir hier über Änderungen der Größen reden.
Ich gebe zu, dass diese Erklärung, insbesondere was die Temperatur als Umrechnungsfaktor angeht, etwas schwammig ist. Man kann prinzipiell versuchen, wie oben über die Freie Energie zu arbeiten und die dem Wärmebad entzogene Energie direkt in Innere Energie des Gases umzusetzen, beispielsweise über eine chemische Reaktion. Dann sieht man, dass die entzogene Wärme direkt in innere Energie übergeht. Wenn man den Prozess dann reversibel führt, dann ist im Gas immer ΔF=0 (denn es ist ein System bei konstanter Temperatur und konstantem Volumen). Wenn die innere Energie U um ΔQ zunimmt, dann muss entsprechend auch TS um denselben Wert zunehmen, damit F konstant bleibt. Das einzige Problem dabei ist, dass man sich eine Reaktion vorstellen muss, die Innere Energie im Gas speichert, zumindest prinzipiell reversibel ist und die die Entropie nicht ändert (das schließt Reaktionen der Art A+B→AB aus, weil sich dabei die Zahl der Moleküle ändert). Das kann man prinzipiell machen, ist aber wenig anschaulich. Wie man chemische Reaktionen reversibel führt, ist z.B. im Buch von Becker “Theorie der Wärme” erklärt.
Diese Definition der Entropieänderung gilt für reversible Prozesse; wird zusätzlich noch Energie z.B. durch Reibung im System in Wärme umgewandelt (so dass Entropie produziert wird), muss man diese zur Wärmeenergie hinzuschlagen (die Energie habe ich mit ΔW bezeichnet):
ΔS = (ΔQrev + ΔW) / T
Warum Kraftwerke nie perfekt sein können
Und mit dieser Definition können wir jetzt auch noch etwas ganz Praktisches verstehen: Warum ist der Wirkungsgrad von Kraftwerken eigentlich nie 100%?
Ein Kraftwerk (beispielsweise ein Kohle- oder Öl- oder Kernkraftwerk, aber auch ein Automotor) erzeugt ja Wärme, um damit einen Motor (oder eine Turbine) anzutreiben. Wir können die Wärme nicht einfach aus dem heißen Gas entziehen und mit dieser Wärme direkt einen Motor betreiben, denn das würde die Entropie im Wärmebad verringern (und ein idealer Motor ohne Reibung hätte ja auch keine Entropie). Dies ist die berühmte Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik (der sagt, dass die Entropie eines abgeschlossenen Systems nie abnehmen kann), die ich neulich schon verwendet habe:
Es gibt keine Maschine, die nichts tut als einem Wärmebad Energie zu entziehen und dabei mechanische Arbeit zu leisten.
Wenn wir also die Wärme der Verbrennung nutzen wollen, müssen wir die Entropie ΔS = ΔQ/T irgendwo lassen. Weil hier durch T geteilt wird, sieht man, dass man bei niedriger Temperatur weniger Wärme braucht, um die gleiche Entropiemenge zu bekommen. Wir können also unserem heißen Gas in der Brennkammer bei hoher Temperatur Tb (Index “b” wie “brenn”) die Wärmemenge ΔQ entnehmen, entziehen ihm dabei aber eine Entropie ΔS= ΔQ/Tb.
Damit wir diese Entropie loswerden, brauchen wir jetzt ein zweites Wärmebad bei einer niedrigeren Temperatur – das ist meistens die Umwelt, in die die Abwärme des Kraftwerks hineingepumpt wird. Diese hat eine Temperatur TU (“U” wie “Umwelt”). Um unsere Entropiemenge von oben loszuwerden, müssen wir jetzt eine bestimmte Wärmemenge ΔQ2 in dieses Wärmebad mit der niedrigeren Temperatur übertragen:
ΔQ2 = TU ΔS = TU ΔQ / Tb
Diese Energie können wir also nicht nutzen, um unseren Motor zu betreiben. Die nutzbare Energie für den Motor ist also nur ΔQ – ΔQ2. Wenn wir wissen wollen, wie groß der Anteil der nutzbaren Energie an der gesamten entzogenen Wärmeenergie ist, dann berechnen wir entsprechend
(ΔQ – ΔQ2) / ΔQ.
Diese Größe wird auch als Wirkungsgrad η (griechisches “eta”) bezeichnet. Mit der Gleichung oben lässt sich der Wirkungsgrad leicht ausrechnen:
η = (ΔQ – ΔQ2) / ΔQ= 1 – ΔQ2/ ΔQ = 1- TU/Tb
Um den Wirkungsgrad möglichst hoch zu machen, muss also das Verhältnis von Brenntemperatur und Umwelttemperatur möglichst groß sein. Man könnte einen perfekten Wirkungsgrad bekommen, wenn man ein Wärmebad beim absoluten Nullpunkt (Null Kelvin) hätte, das aber leider nicht existiert. (Und falls jetzt jemand auf die brillante Idee kommt, die Abwärme einer Turbine in einen Kühlschrank zu pumpen, um den Wirkungsgrad zu erhöhen – klappt leider nicht, weil der Kühlschrank mehr Energie – genauer gesagt, freie Energie – frisst als man so gewinnen könnte.) Dass es kein thermodynamisches System bei exakt Null Kelvin geben kann, wird übrigens auch als Dritter Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet.
Entsprechend möchte man die Temperatur in der Brennkammer möglichst hoch machen. In Gasturbinen erreicht man da heutzutage so etwa 1400°C (oder ein bisschen mehr, so genau verraten die Hersteller das nicht), was dann aber auch die Grenze ist, weil dann die Materialien, aus denen man die Turbinen baut, nicht mehr mitspielen (deshalb brauchen Turbinen ja auch “Topflappen”).
Falls ihr oben in die Formel Zahlen einsetzt, seht ihr, dass der theoretische Wirkungsgrad einer Turbine, die zwischen 1400°C (also 1673K) und Raumtemperatur (etwa 300K) arbeiten würde, etwas über 80% liegt. Real ist das so nicht mal annähernd umsetzbar – wenn das Gas die Turbine verlässt, ist es noch viel heißer als das. Wer sich davon überzeugen will, muss sich nur mal die Finger an einem Auspuffrohr verbrennen. In großen Kraftwerken schaltet man deshalb oft noch eine zweite Turbine, eine Dampfturbine, hinterher, die das immer noch ziemlich heiße Gas aus der Gasturbine weiter nutzt.
Eine andere Möglichkeit, den Wirkungsgrad effektiv zu erhöhen, besteht darin, die Abwärme selbst zu nutzen. Das ist das Geheimnis hinter der “Kraft-Wärme-Kopplung”. Hier kann man mit der Abwärme zusätzlich Häuser über Fernwärme heizen und so aus der Not eine Tugend machen. Entsprechend haben solche Kraftwerke eine sehr gute Energiebilanz, allerdings braucht man natürlich Fernwärmeleitungen.
Auch an diesem Kraftwerksbeispiel sieht man wieder, dass die Entropie unser Leben in vieler Hinsicht bestimmt. Nicht schlecht für eine Größe, die ja eigentlich nur die Höhe eines Papierstapels misst, oder?
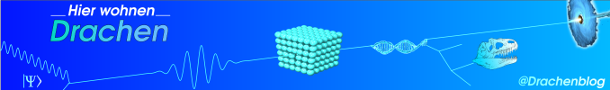

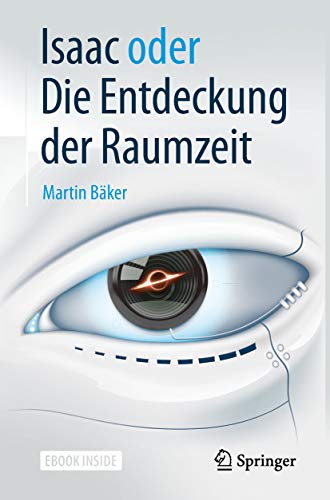



Kommentare (137)