Schwimmen ist ja eine ziemlich energieeffiziente Fortbewegungsweise – große Schiffe haben eine gute Umweltbilanz. Trotzdem müssen sie natürlich den Wasserwiderstand überwinden. Könnte man den reduzieren, ließen sich Unmengen an Schiffstreibstoff sparen. Ein möglicher Trick hierzu wurde kürzlich gleich auf zwei unterschiedliche Arten ausprobiert.
Die Reibung beim Schwimmen kommt daher, dass die Wassermoleküle direkt an der Oberfläche des Schwimmers anhaften, dort ist ihre Geschwindigkeit also Null. Da das Wasser weit weg vom Schwimmer an diesem vorbeifließt, muss sich ein Geschwindigkeitsprofil ausbilden, das typischerweise so aussieht:

By Mandavi – Own work, CC BY-SA 3.0, Link
Hier gleiten also Flüssigkeitsschichten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aneinander ab. Das aber kostet Energie – Wasser besitzt eine Viskosität.
Dass die unterste Flüssigkeitsschicht direkt an der Oberfläche ruht, ist eins der Grundprinzipien der Strömungsmechanik, dagegen ist nichts zu machen. Insofern scheint es erst einmal, als könne man nichts gegen diesen Effekt tun. Weiter weg von Schwimmer muss die Strömung eine bestimmte Geschwindigkeit haben (in der Strömungsmechanik ist es üblich, den Schwimmer als ortsfest anzusehen und die Strömung an ihm vorbeizuführen – physikalisch ist das dasselbe, aber mathematisch leichter zu handhaben), direkt am Schwimmer muss die Geschwindigkeit Null sein, also gibt es dazwischen einen Änderung der Geschwindigkeit, also ist wegen der Viskosität eine Kraft hierfür notwendig. Und an der Viskosität des Wassers kann man ja beim Schwimmen nicht drehen.
Oder vielleicht doch?
Wasser ist ja nicht das einzige Medium, durch das man schwimmen kann. Ein anderes Medium mit wesentlich kleinerer Viskosität ist Luft. (O.k., Luft ist ein Gas, aber für die Strömungseigenschaften ist das relativ egal; deswegen fassen Strömungsmechanikerinnen Gase und Flüssigkeiten unter dem Oberbegriff “Fluide” zusammen.)
Man müsste sich also mit einem Luftfilm umgeben – dann könnte die Änderung der Geschwindigkeit im wesentlichen in diesem Luftfilm passieren, wo die Viskosität klein ist. Also: Man umgibt sich mit einer Luftblase und schwimmt dann darin – ganz einfach, nicht wahr?
Wenn ihr mir das so abkauft, dann hätte ich gleich die passende Tüte Luft günstig abzugeben…
Ernsthaft: Die Luftblase hat sicher andere Ideen, als euch brav einzuhüllen und wird sich natürlich ziemlich schnell ablösen. Man bräuchte einen Trick, um die Luftblase (oder besser einen dünnen Luftfilm) direkt am Schwimmer anhaften zu lassen. Dazu müsste man das Wasser daran hindern, die Luft zu verdrängen und so den Schwimmer zu benetzen.
Wahrscheinlich haben die meisten schon einmal vom Lotuseffekt gehört. Der sorgt dafür, dass Wassertropfen von Lotusblättern abperlen, so wie hier (wieder bei Wikipedia geklaut, ohne Wiki wäre mein Blog ganz schön arm an Bildern, das Bild stammt von Wikipedianutzer ArchiKat):

By ArchiKat – Own work, CC BY 3.0, Link
In der Mitte seht ihr die Tropfen auf den Lotus- (oder Lotos-) Blättern, unten handelsübliche Seerosenblätter, auf denen die Tropfen nicht so gut abperlen.
Der Lotuseffekt funktioniert dadurch, dass die Oberfläche des Blattes mit winzigen Rauigkeiten versehen ist. Außerdem ist sie hydrophob, das heißt, dass Wasser sich nur ungern dort anlagert. Auch dazu gibt es ein schickes Bild bei Wikipedia:

By William Thielicke website: More pictures and bionics. Hamburg, Germany., GFDL, Link
Dass die Oberfläche hydrophob ist, bedeutet, dass es Energie kostet, Wasser in Kontakt mit der Oberfläche zu bringen. Und wegen der Mikrorauigkeiten ist das ziemlich viel Oberfläche (je rauer, desto mehr Fläche) – deswegen ist es energetisch günstiger, wenn das Wasser die Oberfläche möglichst gar nicht benetzt. Man nennt diese Eigenschaft deshalb auch “superhydrophob”.
Beim Lotusblatt klappt das prima, und auch technisch nutzt man den Effekt beispielsweise für selbstreinigende Oberflächen. (Die berühmten Hightech-Schwimmanzüge, die ja jetzt verboten werden, beruhen nicht auf diesem Effekt, soweit ich das verstehe, sondern auf dem “Haifischhaut-Effekt”. Dabei sorgen Mikrorauigkeiten für eine optimierte Bildung von kleinsten Wirbeln, die den Widerstand herabsetzen. Ludmilla hat sich dazu vor einiger Zeit mal schlaugemacht.)
Für unseren Schwimmer aber reicht der Lotoseffekt so noch nicht. Der Schwimmer ist ja vollkommen von Wasser umgeben (nicht nur von ein paar Wassertropfen). Beim Schwimmen übt dieses Wasser einen höheren Druck aus als ein Regentropfen auf einem Blatt. Selbst wenn wir also einen Luftfilm auf der Oberfläche haben, der in “Taschen” an den Mikrorauigkeiten liegt, wird der Druck das Wasser in die Mikrorauigkeiten hineinpressen, den Luftfilm herausdrücken, und wenn der erst einmal weg ist, dann ist es vorbei mit dem widerstandsarmen Schwimmen.
Das folgende Bild (aus dem paper von Lee und Kim) illustriert das sehr schön:
Bei (a) seht ihr die Anfangskonfiguration: Das Wasser strömt um die Lufttaschen herum, die zwischen kleinen Stegen festsitzen, und hat an der Oberfläche der Lufttaschen noch eine hohe Geschwindigkeit, so dass die Reibungsverluste durch Viskosität klein sind. Bei (b) werden einige der Lufttaschen zugedrückt, bei (c) sind sie alle verschwunden, und das war’s dann mit der Superhydrophobie.
Wer’s lieber “in echt” sieht statt auf ner Schemazeichnung, der mag vielleicht dieses Bild (adaptiert aus dem paper von Carlborg & van der Wijngaart) lieber:
Hier ist jeweils oben der Strömungskanal zu sehen, unten eine Detailaufnahme mit den Stegen, die die Lufttaschen festhalten sollen. Der Druck nimmt dabei von oben nach unten zu. Die Stellen, an denen der Gasfilm verdrängt wurde, sind mit Kreuzen markiert. man erkennt, dass bei hohem Druck vom Gasfilm nichts übrigbleibt.
Was wir brauchen ist ein Mechanismus (d), der die Luft wieder herstellt:
Und da gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Eine (Carlborg & van der Wijngaart) besteht darin, den Wasserdruck selbst dafür sorgen zu lassen, dass sich der Luffilm erneuert. Das sieht als Skizze etwa so aus:
Links seht ihr ein ähnliches Bild wie oben, bei dem der Flüssigkeitsdruck die Luftblasen links zugedrückt hat. Rechts die raffinierte Rückkopplung: Das Wasser drückt auf die Luft vorn am Feed-back-Kanal. Wenn der Wasserdruck dort steigt, dann wird die Luft weiter hinten an den Taschen ebenfalls komprimiert und so der Druck erhöht. Das verhindert, dass der Wasserdruck die Luft wegdrückt. Das ganze ist selbstregulierend: Nimmt der Druck am Feed-back-Kanal zu, dann auch an den Taschen; nimmt er wieder ab, dann nimmt er auch an den Taschen ab (sonst würde die Luft ja ins Wasser gedrückt werden, was auch nicht gewollt ist.).
So sieht das dann im Experiment (Carlborg & van der Wijngaart) aus:
Bei dem Wasserdruck, bei dem ohne die Rückkopplungschleife die Taschen schon vollkommen mit Wasser gefüllt sind, beginnt mit Rückkopplung das Wasser gerade erst, die Lufttaschen ein wenig einzudrücken, der strömungsgünstige Effekt ist also noch erhalten.
Allerdings hat das Design einen Nachteil: Luft ist wasserlöslich. Nach einer Weile nimmt deshalb das Gasvolumen ab. Man bräuchte also einen Mechanismus, um Gas “im Betrieb” nachzufüllen, und zwar möglichst immer genau soviel, dass die Taschen so gerade gefüllt sind.
Den Trick dazu haben Lee und Kim erfunden. Das Gas sollte dazu vom Boden der Taschen aus nachgefüllt werden, so wie in diesem Bild:
Der Trick, um Gas nachzuliefern, ist Elektrolyse. Vielleicht habt ihr in der Schule ja mal Knallgas (also Wasserstoffgas) hergestellt, indem ihr Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt habt. Dazu braucht man im wesentlichen nur eine elektrische Spannung zwischen zwei metallischen Flächen in der Flüssigkeit. Die eine metallische Fläche ist der Boden unserer Taschen, die andere ist einfach ein Draht, den wir in die Flüssigkeit hängen.
Damit der Taschenboden metallisch wird, muss man ihn entsprechend beschichten. Und damit das Gas sich schön von dort aus nach oben ausbreitet, sollte diese Beschichtung ziemlich rau sein, damit das Gas dort gut anhaftet. So sieht die Struktur im Elektronenmikroskop aus, die Lee und Kim gebaut haben:
Links seht ihr die kleinen Säulen (zum Größenvergleich: ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von etwa 80μm), die für die Superhydrophobie verantwortlich sind, rechts ein Detail der nanostrukturierten Oberfläche.
Das Praktische an diesem Design ist, dass auch hier der Prozess selbstregulierend ist: Solange die Gastaschen vorhanden sind, ist die nanostrukturierte Metallfläche nicht im Kontakt mit Wasser, es findet also auch keine Elektrolyse statt. Wird das Gas aus einer Tasche verdrängt, dann beginnt die Elektrolyse und neues Gas bildet sich nach. Lee und Kim haben auch experimentell geprüft, dass sich das Gas tatsächlich wieder nachbildet:
Links im Bild die Anfangssituation, in der die Oberfläche vollkommen benetzt ist, rechts der Zustand nach 97 Sekunden. Der Gasfilm hat sich wie gewollt neu gebildet.
Lee und Kim weisen auch darauf hin, dass sie das Verfahren bei Drücken bis zu 7 Atmosphären erfolgreich getestet haben, was oberhalb des typischen Drucks an einem Schiffsrumpf liegt. Vielleicht werden also eines Tages alle Schiffe mit solchen nanostrukturierten Oberflächen überzogen sein? Auf jeden Fall eine nette Idee – ob sie praxistauglich ist, wird sich zeigen.
Lee, C., & Kim, C. (2011). Underwater Restoration and Retention of Gases on Superhydrophobic Surfaces for Drag Reduction Physical Review Letters, 106 (1) DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.014502
Carl Fredrik Carlborg, Wouter van der Wijngaart
Sustained Superhydrophobic Friction Reduction at High Liquid Pressures and Large Flows, Langmuir 2011, 27(1), 487-493
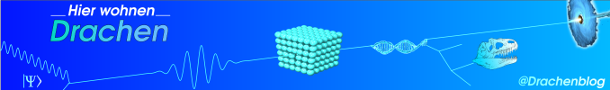

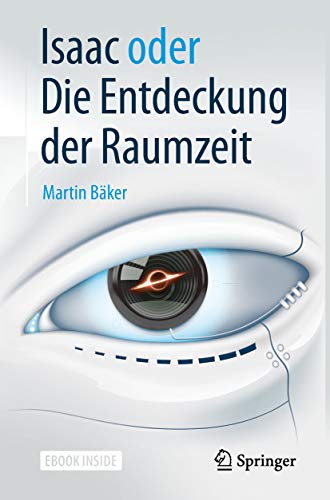



Kommentare (24)