Bei wissenschaftlichen Revolutionen denkt man (gerade als Physiker) ja meist an das heliozentrische Weltbild, die Relativitätstheorie oder die Quantenmechanik, vielleicht auch an die Evolutionstheorie. Die meisten Revolutionen in der Wissenschaft sind weniger auffällig, krempeln aber auch Wissensgebiete um. Ein Beispiel dafür ist die Kladistik, die sich mit der Frage beschäftigt, wie man am besten die evolutionären Stammbäume entschlüsselt.
Stammbäume und Kladogramme
Wer – wie ich – schon ein bisschen älter ist und als Kind oder Jugendlicher Dinosaurierbücher liebte, der kennt sicher “klassische” Stammbäume wie zum Beispiel diesen hier (zum Vergrößern klicken):
(Aus R. Moody, “A Natural history of Dinosaurs”)
Sie zeigen Hypothesen darüber, wie unterschiedliche Dinosaurier (hier die sogenannten Ornithopoden, meist zweibeinige pflanzenfressende Dinosaurier, zu denen der berühmte Iguanodon und die Entenschnabeldinosaurier gehören) miteinander verwandt waren. Aus dem Fabrosaurus entwickelte sich (vermutlich, deshalb gestrichelt gezeichnet) der Camptosaurus, der wiederum ein Vorfahr des Iguanodon war, von dem sich dann die Hadrosaurier abzweigten.
Solche Stammbäume findet man in älteren Büchern über ausgestorbene Tiere ziemlich häufig. Schlägt man dagegen neuere Bücher oder Veröffentlichungen auf, sieht man meist ein etwas anderes Bild:
Diese Diagramme werden als “Kladogramme” bezeichnet. Gegenüber den klassischen Stammbäumen erkennt man zwei wichtige Unterschiede (mal abgesehen davon, dass hier keine hübschen Bildchen drin sind): Während bei Stammbäumen (ich benutze das Wort ab jetzt ausschließlich für die erste Art von Diagrammen) Namen von Dinosaurierarten direkt auf den Linien stehen können, findet man sie bei Kladogrammen immer nur an den Enden. Iguanodon steht also zwischen Camptosaurus und Ouranosaurus (und den späteren Hadrosauriern), er wird aber nicht ihr direkter Vorfahr dargestellt.
Der zweite Unterschied ist die Zeitachse – Stammbäume haben eine, Kladogramme meist nicht. (Es gibt auch Ausnahmen, die sind aber eher selten, und auch in diesen geht die Zeitachse nicht in die zu Grunde liegende Analyse ein. Nachtrag: Kommentator Rainer weist zurecht darauf hin, dass Kladogramme, die auf molekularbiologischen Untersuchungen beruhen, meist mit einer Zeitachse kalibriert werden.)
“Wie aufregend!”, sagt da vermutlich irgendeine sarkastische Stimme, “die Paläontologen zeichnen ihre Diagramme jetzt ein bisschen anders als früher. Ist das eine Revolution?” “Nein, das ist nicht mal eine Revolte.” (Entschuldigung an Herzog Liancourt…)
Aber hinter dieser scheinbar kleinen Änderung steckt mehr, als man auf den ersten Blick ahnt.
Stammbaumerstellen als Kunst
Um die “klassischen” Stammbäume zu erstellen, ging man früher wie folgt vor: Man betrachtete die Fossilien, die man klassifizieren wollte, und suchte nach Ähnlichkeiten und Unterschieden. Je ähnlicher sich zwei Tiere waren, desto enger waren sie vermutlich verwandt. Hatte ein Tier ein Merkmal, das bei anderen, älteren Tieren nicht vorhanden war, dann hatte es dieses irgendwann entwickelt – Tiere, die mehrere solcher Merkmale teilten, waren also vermutlich ebenfalls verwandt. Man berücksichtigte zusätzlich auch die Zeit, zu der die Tiere lebten – ein später lebendes Tier mit sehr “primitiven” Merkmalen konnte natürlich kein Vorfahr eines früher lebenden Tieres mit “fortschrittlichen” Merkmalen sein. (Die Anführungsstriche verwende ich hier, weil diese Sprechweise zwar früher üblich war, heute aber wegen ihres implizit wertenden Klangs nicht mehr so gern gesehen ist.)
Bei dieser Art der Stammbaumerstellung findet man oft Gruppen, die die Vorfahren sehr vieler späterer Arten waren. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Thecodonten – eine Gruppe von Reptilien, unter denen man die Vorfahren der Krokodile, Flugsaurier, Dinosaurier und Vögel vermutete, hier als Beispiel Euparkeria (wie üblich von Wikipedia):

By Nobu Tamura (https://spinops.blogspot.com) – Own work, CC BY 2.5, Link
Die Thecodonten ähnelten einander in vieler Hinsicht, insbesondere verfügten sie über viele gemeinsame Merkmale, die sie ihrerseits von ihren Vorfahren geerbt hatten. Man fasste sie deshalb als eine Gruppe zusammen, aus der sich dann viele andere abzweigten. Die Thecodonten verfügen aber über keine Merkmale, die nur ihnen gemeinsam sind und sind deshalb keine evolutionär einheitliche Gruppe – heutzutage sieht man sie eher als “wastebasket taxon” (Mülleimer-Gruppe) an, also als ein Sammelsurium von nur lose miteinander verwandten Arten.
Unterschiedliche Forscher kamen beim Aufstellen von Stammbäumen oft zu unterschiedlichen Ergebnissen – ein Merkmal, das der eine für sehr wichtig hielt, fand eine andere vielleicht eher unwichtig und berücksichtigte es deshalb weniger als ihr persönliches Lieblingsmerkmal. Das Erstellen von Stammbäumen auf diese Art war also in gewisser Weise eine Kunst – es gab keine klaren Regeln dafür, und wenn zwei Forscher unterschiedliche Stammbäume aufstellten, war es eigentlich unmöglich zu entscheiden, wer von beiden recht hatte.
Und noch ein weiteres Problem machte den Forscherinnen Kopfzerbrechen: Wenn man eine Art irgendwo auf eine Linie des Stammbaums setzt (wie den Iguanodon im Bild oben), dann impliziert das ja, dass diese Art ein Vorfahr der nachfolgenden Arten ist. So ziemlich alle Tierarten, die man plausibel auf solche Verbindungslinien setzen konnte, hatten aber auch spezielle Merkmale, die weder die vermutlichen Vorfahren, noch ihre Nachkommen hatten, Merkmale, über die diese Art allein verfügte.
Iguanodon hatte beispielsweise nur zwei Fingerglieder am vierten Finger, während sowohl Camptosaurus als auch Ouranosaurus drei hatten. Wäre Iguanodon also ein direkter Nachfahre von Camptosaurus und ein Vorfahre von Ouranosaurus, dann wäre zunächst ein Fingerglied verloren gegangen und hätte sich dann wieder entwickelt. Das ist zwar möglich, macht es aber ein bisschen unwahrscheinlich, dass es tatsächlich diese Art war, die genau auf der Verbindungslinie im Stammbaum lag. Wahrscheinlicher ist, dass es eine noch unbekannte iguanodon-ähnliche Art gab, die noch drei Fingerglieder hatte und aus der sich dann sowohl Iguanodon als auch Ouranosaurus entwickelten. Auf einigen Stammbäumen sieht man deshalb die Arten nicht genau auf den Verbindungslinien sitzen, sondern an kurzen Seitenästen.
Die Evolution ernst nehmen
Die Kladistik versucht, diese Probleme zu lösen und das Erstellen von “Stammbäumen” (genauer gesagt, “Kladogrammen”) auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Nach meinem Verständnis beruht sie letztlich darauf, die Evolution in gewisser Weise ernster zu nehmen, als man es vorher tat. Dazu verwendet man folgende Grundprinzipien:
1. Plesiomorphien können nicht zur Gruppierung dienen
Eine “Plesiomorphie” ist ein Merkmal, das die Vorfahren der gerade untersuchten Tiergruppe auch schon besaßen. Untersuchen wir zum Beispiel die Säugetiere, dann ist das Vorhandensein von 5 Zehen ein plesiomorphes (manchmal sagt man auch “primitives” oder “basales”, wobei “primitiv aber, wie schon erwähnt, nicht so gern gesehen ist) Merkmal. Will man deshalb beispielsweise die Verwandtschaft zwischen einem urtümlichen Säugetier wie Morganucodon, einem Pferd, einer Katze und einem Menschen klären, so ist es nicht hilfreich, den Menschen, die Katze und Morganucodon in eine gemeinsame Gruppe zu stecken, weil sie das basale Merkmal “5 Zehen” teilen. Es ist klar, dass die Pferde irgendwo auf dem Entwicklungsweg vom Morganucodon ihre Zehen verloren haben, aber ob sie das taten, bevor oder nachdem sich die Entwicklungslinie der Menschen oder Katzen abspaltete, lässt sich nicht sagen – beides ist möglich. In der Mitte des 20. Jahrhunderts verwendeten die Paläontologen häufig Klassifikationen, in denen Tiere aufgrund geteilter basaler Merkmale zusammengefasst wurden, wie beispielsweise die oben erwähnten “Thecodonten”, die in keinem älteren Dinobuch fehlen, aber in neueren höchstens noch als historische Fußnote vorkommen.
(Aber Achtung: Wenn man Kladistik mit dem Computer betreibt, dann werden zur Analyse alle Merkmale verwendet, auch Plesiomorphien. Das sehen wir weiter unten genauer.)
2. Zwischenformen können nie sicher identifiziert werden
Schon Darwin schrieb viel über die Spärlichkeit der Fossilien. Nur ein wirklich winziger Bruchteil aller Tiere wird als Fossil erhalten und auch tatsächlich gefunden. Das macht es unwahrscheinlich, dass man jemals einen genauen Vorfahren einer späteren Tiergruppe finden wird; normalerweise hat jede fossile Art irgendwelche speziellen Merkmale, die weder ihre Vorfahren noch ihre Nachfahren haben (sogenannte “Autapomorphien”, wie die Zahl der Fingerglieder beim Iguanodon). Das war ja auch der Grund, warum einige der klassischen Stammbäume die “Zwischenformen” eben nicht direkt auf die Verbindungslinien setzten. Natürlich kann es tatsächlich mal vorkommen, dass eine Art keine Autapomorphien hat und deswegen wirklich als exakter Vorfahr einer anderen in Frage kommt – man kann das aber natürlich niemals wissen, weil man die Abwesenheit von Autapomorphien schlecht beweisen kann (vielleicht hatte die Art ja rosa Punkte entwickelt). Man sollte deshalb niemals annehmen, dass man tatsächlich einen genauen Vorfahren gefunden hat, weil das letztlich keine wissenschaftlich überprüfbare Aussage ist.
3. Die Evolution ist kein linearer Prozess
Anders als bei naiven Kreationisten mit der berühmten Frage “Wenn der Mensch vom Affen abstammt, wieso gibt es dann heute noch Affen?” (grundsätzlich zu kontern mit der Gegenfrage: “Wenn die Amerikaner von den Engländern abstammen, warum gibt es heute noch Engländer?”) und auch anders als bei den üblichen Bildern der Evolution zum Beispiel des Menschen wie diesem hier:
(geklaut bei Weitergen)
ist die Evolution kein linearer Prozess.
Arten können sich aufspalten und dann in verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Insbesondere kann eine Entwicklungslinie neue Merkmale entwickeln (die heißen dann “Apomorphien”), während eine andere die basalen Plesiomorphien behält. Beispielsweise gibt es heute noch Menschen mit fünf Zehen, obwohl die Pferde mehrere Zehen verloren haben. Auch Schnabeltiere sind ein Beispiel – sie legen Eier wie urtümliche Säugetiere, obwohl die meisten heutigen Säugetiere das nicht tun. (Trotzdem ist es irreführend, Schnabeltiere als “lebende Fossilien” zu bezeichnen – sie haben sich seit der Kreidezeit genauso weiterentwickelt wie andere Arten auch.)
Für das Aufstellen von Stammbäumen heißt das insbesondere, dass man nicht zu sehr darauf achten sollte, wann die Tiere jeweils gelebt haben. Es kann durchaus sein, dass man eine Art mit einem basalen (plesiomorphen) Merkmal aus einer Zeit kennt, die nach der Entwicklung eines abgeleiteten (“fortschrittlichen”, apomorphen) Merkmals liegt. Ein klassisches Beispiel ist die Entwicklung der Vögel aus den Dinosauriern: Die meisten vogelähnlichen Dinosaurier kennt man aus der Zeit nach dem Archaeopteryx.
Damit ihr nicht in totale Verwirrung geratet wegen der unhandlichen Begriffe (Henning, der Erfinder der Kladistik, hatte anscheinend eine Vorliebe für solche Begriffe. Er hat die Methode übrigens ursprünglich zur Klassifikation von Insekten entwickelt, aber ich erkläre sie lieber an Dinos), hier noch mal eine kleine Übersicht:
Plesiomorphie: Ursprüngliches, basales Merkmal, dass bereits bei den Vorfahren der betrachteten Art vorhanden war. Beispiel: Fünf Zehen beim Menschen. Man spricht von einer
Symplesiomorphie, wenn mehrere Tiergruppen dasselbe Merkmal von ihren Vorfahren bekommen haben, so wie Mensch und Katze ihre fünf Zehen.
Apomorphie Abgeleitetes, weiter entwickeltes Merkmal, das bei den Vorfahren nicht vorhanden war. Man unterscheidet dabei
Autapomorphie Abgeleitetes Merkmal, über das nur die gerade betrachtete Art verfügt, beispielsweise die reduzierte Zahl der Zehenglieder beim Iguanodon. Autapomorphien sind zum Ableiten von Stammbäumen nutzlos, wie wir oben am Beispiel der Pferde gesehen haben.
SynapomorphieAbgeleitetes Merkmal, das mehrere Tierarten gemeinsam haben. Beispielsweise ist die Fähigkeit zum Sehen mit drei Grundfarben eine Synapomorphie der Primaten. Synapomorphien sind entscheidend, um Abstammungslinien zu rekonstruieren.
Wie man ein Kladogramm liest
An die Stelle der “klassischen” Stammbäume treten jetzt also Kladogramme wie das oben oder dieses hier:
Es zeigt direkt an, wie eng die jeweiligen Arten miteinander verwandt sind, hier die “primitiveren” Sauropodomorphen, also die Vorfahren der berühmten “Langhalsdinos”. (Mehr über dieses Kladogramm könnt ihr hier nachlesen.) Der engste Verwandte von Plateosaurus ist also Riojasaurus, diesen beiden steht der Coloradisaurus am nächsten, usw. Wichtig beim Lesen ist, dass die Reihenfolge der Einträge irrelevant ist, solange man an der Baumstruktur selbst nichts ändert – man kann das Kladogramm an jedem Verzweigungspunkt herumdrehen, ohne dass sich etwas ändert, und also beispielsweise Riojasaurus nach oben schreiben. Hier eine alternative Darstellung desselben Kladogramms:
Oft sortiert man die Arten so, dass “urtümliche” Arten tendenziell unten stehen und “fortschrittlichere” Arten, die sich also besonders stark von den “urtümlichen” unterscheiden, sehr weit oben. So wurde es auch hier in der oberen Variante gemacht – Saturnalia ist ein sehr urtümlicher Dinosaurier, Camarasaurus ein vergleichsweise fortgeschrittener. Durch diese Konvention kann man sich aber leicht in die Irre führen lassen, denn was gerade “urtümlich” und was “fortschrittlich” ist, ist letztlich keine wissenschaftliche Frage, sondern eher eine des jeweiligen Forschungskontextes. Beispielsweise sind – das hatten wir ja oben schon gesehen – Pferde fortschrittlicher als Menschen, was die Zahl ihrer Zehen angeht; Menschen dagegen sind in anderen Merkmalen weiter von den ersten Säugetieren entfernt als Pferde. Und wenn sich aus Plateosaurus-Verwandten eine andere Dino-Linie entwickelt hätte, dann würden wir vielleicht das Kladogramm so rotieren, dass die ganz oben stehen.
Wir erstellen ein Kladogramm
Und wie baut man nun so ein Kladogramm zusammen?
Zunächst muss man sich entscheiden, welche Tiergruppe man untersuchen will. Theoretisch könnte man natürlich alle Tiere gleichzeitig bearbeiten, aber angesichts von einigen Millionen Arten ist das vielleicht etwas mühsam. Also beschränkt man sich auf eine bestimmte Gruppe – möglichst eine, bei der man sich auch auskennt und Zugriff auf die entsprechenden Fossilien (oder Daten darüber) hat.
Nehmen wir also an, ich hätte euch mit meiner Begeisterung für den Plateosaurus angesteckt (als Physiker darf ich ja auch mal etwas weit hergeholte Annahmen machen), und wir wollten ein Kladogramm für die urtümlichen Sauropoden machen (die man oft als “Prosauropoden” bezeichnet – aber ob das zulässig ist, müssen wir noch diskutieren).
Als erstes überlegen wir also, welche Arten zu dieser Gruppe dazugehören – wie beispielsweise Plateosaurus, Riojasaurus usw.
Als zweites brauchen wir eine “Outgroup” (Im Deutschen Außengruppe – Dank an Rainer) – das ist eine (oder mehrere) fossile Art, die sehr gut bekannt ist und von der wir schon im Vorfeld sicher sind, dass sie den untersuchten Arten nahe verwandt ist, aber definitiv weiter unten am Kladogramm angesiedelt sein muss – so wie das oben im Beispielkladogramm zu sehen ist. In der gezeigten Analyse der “Prosauropoden” gehörten dazu Coelophysis (ein anderer meiner Lieblingsdinos), Eoraptor, Herrerasaurus und noch ein paar andere. Diese Outgroup dient sozusagen als Verankerung für die Analyse – die Art, die mit ihren Merkmalen am dichtesten an der Outgroup dran ist, ist mit ihr vermutlich am engsten verwandt und somit “basal”. Im Beispiel hier ist das Saturnalia.
Und jetzt beginnt die Arbeit: Man erstellt eine Liste mit Merkmalen, die bei den einzelnen Arten relevant erscheinen, die also zwischen ihnen variieren. Im gezeigten Cladogramm hier hat diese Liste 292 Merkmale – beispielsweise
Merkmal 1) Schädellänge mehr als halb so groß wie der Oberschenkel (0); weniger als halb so groß (1)
oder
Merkmal 236) Kleiner Trochanter (ein Muskelansatzpunkt) am Oberschenkel gut ausgeprägt (0) oder abwesend oder stark reduziert (1)
Diese Merkmale werden jetzt für alle untersuchten Arten (im Beispiel 38) untersucht – macht also schlappe 292*38=11096 Einzelmerkmale. Plateosaurus bekommt beispielsweise bei Merkmal 1) eine 1, weil der Schädel eben kürzer als die halbe Oberschenkellänge ist usw. Wenn man ein Merkmal nicht kennt – weil zum Beispiel ein Knochen nicht fossil erhalten ist, bekommt der Wert ein Fragezeichen “?”. Am Ende landet man dann für jede Art bei einer Liste, die etwa so aussieht:
Riojasaurus
1011??1??0001111100111?011??0?00?1010?0000100000001100??100? 10101?0???10110010001110??10000100010001001100001100?10100000 10010010000001?1010001?10000?????001010111{01}0011101100000111 111??111011101100111?0?01001111010101200001010000101010100100 11011001101001001?0001??0000011111010110001000?10??
Wer genau aufgepasst hat, hat ein Merkmal mit dem Wert “2” gefunden – manchmal hat ein Merkmal mehrere mögliche Zustände, beispielsweise
144) Verhältnis von Rückenwirbellänge zu -höhe: > 1(0); 1-0.7 (1), <0.7 (2)
(Falls jemand fragt, was die geschweiften Klammern bedeuten – da bin ich leider überfragt. Falls jemand Bescheid weiß, bin ich wie immer für einen Kommentar dankbar.)
Diese riesige Matrix füttert man in einen Computer ein (wobei man sich möglichst nicht vertippen sollte). Der Computer verwendet jetzt ein Optimierungsverfahren, um die Arten so in einem Kladogramm anzuordnen, dass man möglichst wenige Veränderungen (sozusagen Evolutionsschritte) benötigt. Beispielsweise haben Riojasaurus und Plateosaurus bei den Merkmalen 1-4 die Werte 1011; Coloradisaurus dagegen hat ?001. Das Fragezeichen werten wir nicht, aber bei Merkmal Nummer 3 hat sich hier etwas geändert, das zählt dann als ein Evolutionsschritt. Massospondylus und Adeopapposaurus haben beide 1010, Lufengosaurus hat 10?1.
Der Übersicht halber hier nochmal in Tabellenform:
Plateo/Rioja: 1011
Coloradi: ?001
Adeop/Masso: 1010
Lufengo: 10?1
Aus dem ersten Merkmal lernen wir nichts, das ist bei allen gleich oder unbekannt, das zweite Merkmal ist ebenfalls bei allen gleich. Bei den Merkmalen 3 und 4 haben wir die Kombinationen 11, 01, 10 und ?1. Um im Kladogramm vom Lufengosaurus zum Massospondylus (und Adeopopposaurus) zu kommen, müssen wir ein Merkmal verändern, nämlich das Vierte von 1 auf 0 (also ein Schritt). Am Gabelungspunkt zwischen Adeo/Masso und Coloradi muss sich das dritte Merkmal so oder so einmal ändern, egal ob es beim Lufengo nun Null oder 1 war (2. Schritt). Bei Coloradi ist das dritte Merkmal auf Null, aber bei Plateo/Rioja ist es wieder auf 1, das gibt also noch einen Schritt (3. Schritt).
Um die Dinos so anzuordnen wie im Kladogramm, benötigt man insgesamt also 3 evolutionäre Veränderungen.
Der Computer geht natürlich andersherum vor – er hat ja kein Kladogramm vorliegen, sondern sucht jetzt dasjenige, bei dem die wenigsten evolutionären Schritte benötigt werden. (Wie wir am Beispiel gesehen haben, kann dabei ein Merkmal aber durchaus mehrfach verändert werden, das wird dann eben durch andere Merkmale kompensiert.) Dabei kommt man natürlich nicht mit wenigen Merkmalen aus – mit unseren vier Merkmalen oben würde man weniger Schritte brauchen, wenn man Plateo und Rioja neben Lufengo anordnet, dann einmal Merkmal 3 und einmal Merkmal 4 ändert. Wieviele Merkmale man benötigt, hängt von vielen Faktoren ab – generell sollte die Zahl der Merkmale deutlich höher sein als die der Arten (im Beispiel waren es ja 292 zu 38).
Am Ende spuckt der Computer ein (oder mehrere gleichwertige) Kladogramm aus – zusätzlich auch noch diverse statistische Größen, die angeben, wie “gut” das Kladogramm ist, also beispielsweise, ob man mit nur wenig mehr Schritten ein ganz anderes Bild erhalten könnte. Die dahinter steckenden Algorithmen und die Analyse der Qualität eines Kladogramms sind wieder eine Wissenschaft für sich (aber da kenne ich mich nicht gut genug aus, um das im Einzelnen zu erklären).
Das fertige Kladogramm ist eine evolutionäre Hypothese: Unter der Annahme, dass die Evolution möglichst einfach verlaufen ist (Parsimonie – letztlich eine Anwendung des berühmten Ockhamschen Bartentferners) stellt es die wahrscheinlichsten Verwandtschaftsbeziehungen dar.
Gegenüber der klassischen Methode hat es den Vorteil, dass jede Forscherin ihre Karten auf den Tisch legen muss – jeder kann sehen, welche Merkmale verwendet wurden und welche nicht und kann die Datenmatrix um weitere Merkmale erweitern oder ungeeignete Merkmale (dazu gleich mehr) entfernen.
Probleme
Dank der Kladistik wurde aus der Kunst des Stammbaumerstellens also eine Wissenschaft – jede Paläontologin kann die verwendeten Daten, die in die Matrix eingehen, nachprüfen und nachvollziehen, wie daraus das Kladogramm wurde. Ist damit also das Erstellen von Kladogrammen vollkommen objektiv?
Leider nein. Denn welche Merkmale in eine Matrix einfließen und wie diese Merkmale gezählt werden, bleibt der Paläontologin überlassen, die das Kladogramm erstellt. Beispielsweise haben Pferde nur einen Zeh, Menschen dagegen 5. Zählen wir das als ein Merkmal, das 5 Werte annehmen kann (Zahl der Zehen: 1,2,3,4,5)? Oder Zählen wir den Verlust jedes Zehs als ein eigenes Merkmal (1. Zeh verloren: ja/nein, 2. Zeh verloren: ja/nein)? Oder sollten wir vielleicht jeden Zehenknochen einzeln zählen (1. Glied 1. Zeh verloren: ja/nein usw?)
Manche Merkmale ändern sich häufig, beispielsweise die Zahl der Wirbel bei Dinosauriern. Soll man den Verlust jedes einzelnen Schwanzwirbels als eigenes Merkmal zählen? Dann würde man nahezu zwangsläufig alle Dinos mit kurzen Schwänzen in einer Gruppe wiederfinden, weil diesem Merkmal dann ein hohes Gewicht zukäme. Oder soll man – so wird es meistens gemacht – Merkmale so definieren: Zahl der Schwanzwirbel: 1-10 oder 11-15 oder 16-24 oder… Dann hat man ein Merkmal mit mehreren (geordneten) möglichen Werten. Aber wo soll man dann genau die Grenze ansetzen?
Auch eine ungünstige Wahl der betrachteten Fossilien kann das Bild verfälschen. Nehmen wir beispielsweise an, wir hätten vom Riojasaurus und von Efraasia nur Skelette von nicht ausgewachsenen Tieren. Dann wäre das Verhältnis Augengröße zu Schädelgröße kein gutes Merkmal, weil jüngere Tiere tendenziell größere Augen haben – wir würden also die beiden möglicherweise gemeinsam gruppieren, weil sich jüngere Tiere generell immer ein wenig ähneln. Eventuell ist es also besser, solche Fossilen gar nicht in die Analyse aufzunehmen. Es braucht also schon ein bisschen Erfahrung, um hier keinen Mist zu bauen.
Auch andere Phänomene können Kladogramme verfälschen. Beispielsweise ähneln sich die “Prosauropoden” (die Anführungsstriche diskutieren wir im – ihr ahnt es schon – zweiten Teil) wie Plateosaurus und eine andere Gruppe von Dinos, die Therizinosaurier (oft auch Segnosaurier genannt):

Von Krugerr – Eigenes Werk, GFDL, Link
Lange nahm man deshalb an, dass die Therizinosaurier mit den Prosauropoden eng verwandt wären – tatsächlich zählen sie aber zu den Raubsauriern und haben ihre generelle Ähnlichkeit im Bauplan vermutlich einfach wegen einer ähnlichen Lebensweise als Pflanzenfresser. Solche Konvergenzen können zu sehr ähnlichen Strukturen führen, ohne dass die Lebewesen tatsächlich eng verwandt wäre – bekanntes Beispiel sind die Ähnlichkeiten zwischen Haien, Fischsauriern und Delfinen. Natürlich kann man im Vorfeld nicht wissen, ob ein Merkmal bei zwei Arten nun ähnlich ist, weil sie eng verwandt sind (es wäre also ein Synapomorphie) oder weil es konvergent ist. Es ist deswegen wichtig, dass man möglichst viele verschiedene Merkmale verwendet, nicht bloß solche, die alle auf derselben Konvergenz durch ähnliche Umweltanforderungen beruhen.
Nicht weniger knifflig wird es mit der Veränderung der Form von Knochen. Wie zieht man z.B. die Grenze, wenn ein Knochen besonders stark gebogen ist? Oder besonders dick (wie der Schädel beim Pachycephalosaurus)? Oder wenn ein Knochen im Vergleich zu einem anderen vergleichsweise klein ist?
Fragen über Fragen.
Letztlich wird die Variation von Merkmalen natürlich über die Gene bestimmt – aber niemand weiß, wie viele Mutationen nun nötig sind, um die Zahl der Schwanzwirbel von 12 auf 16 zu erhöhen oder einen Knochen anders zu krümmen. Solange man das nicht weiß, bleibt nichts übrig als zu versuchen, möglichst viele Merkmale anzuschauen (so dass Fehler bei einzelnen nicht so stark ins Gewicht fallen) und die Merkmale so zu wählen, dass einzelne Aspekte nicht zu stark berücksichtigt werden. Es ist also nicht verwunderlich, dass verschiedene Paläontologen oft zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Trotzdem hat sich die Kladistik in der Paläontologie weitgehend durchgesetzt. Sie ist so ziemlich das einzige anerkannte Mittel zur Bestimmung von evolutionären Beziehungen (auch wenn es einige Wissenschaftler gibt, die die Kladistik wegen der erläuterten Probleme für ungeeignet halten) und ist soweit zum Standard geworden, dass Veröffentlichungen neuer Fossilfunde gelegentlich abgelehnt werden, wenn sie keine kladistische Analyse enthalten (was nicht unbedingt sinnvoll ist).
Man kann Kladistik auch anwenden, um Kladogramme auf der Basis von DNA-Sequenzen zu erstellen (dabei ist man natürlich im wesentlichen auf lebende Tiere beschränkt) – das wird insbesondere von Paläontologen, die sich mit Säugetieren beschäftigen, gemacht. Die Grundidee wird inzwischen auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen verwendet, in denen man Abstammungslinien rekonstruieren möchte – wichtigstes Beispiel ist meines Wissens die Linguistik.
Verwendet man Kladogramme, um die Abstammung von Tierarten darzustellen, dann sollte sich das eigentlich auch in der Benennung von Tiergruppen widerspiegeln. Hier allerdings haben die Biologinnen und Paläontologen noch keine Einigung erzielt – während eine entsprechende Nomenklatur bei Dinosauriern üblich ist (und man es dort cool findet zu sagen, Vögel seien Dinosaurier), verwendet man in der Säugetier-Paläontologie gern noch das gute alte Schema nach Carl von Linne. Was es mit dieser Kontroverse auf sich hat und warum es Leute gab (oder vielleicht noch gibt), die dem guten alten “Tyrannosaurus rex” stattdessen den Namen “rex Osborne 1905” verpassen wollten, das – wer hätte das gedacht – erkläre ich demnächst im zweiten Teil.
Disclaimer: Wie man dem Steckbrief oben links entnehmen kann, bin ich kein Biologe. Wie üblich gilt: Sollte ich hier irgendwelchen Blödsinn erzählt haben, dürft ihr gern in den Kommentaren meckern.
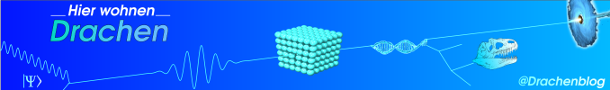

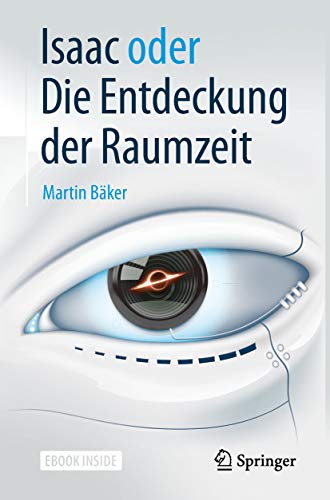



Kommentare (34)