Der Begriff “virtuelle Teilchen” fällt ja ziemlich oft, wenn man über Quanteneffekte redet. Irgendwie sind solche Teilchen nicht so richtig da, haben aber doch einen Effekt – das jedenfalls ist der Eindruck, den man oft bekommt. Manchmal wird auch mit der Unschärferelation argumentiert – für kurze Zeit können Teilchen quasi aus dem Nichts entstehen, weil dann die Energieerhaltung nicht gilt. Diese Bilder geben zwar viele wesentliche Aspekte wieder, letztlich sind sie aber ein bisschen schief. Und darüber hinaus sind eigentlich alle Teilchen, die wir beobachten, “virtuell”. Wie das? Das klären wir heute.
Im vorletzten Teil (der ist ja schon ein bisschen her, deswegen eine kleine Erinnerung) haben wir den Propagator kennengelernt, eins der wichtigsten Objekte, die es in der QFT überhaupt gibt. Der Propagator gibt an, wie groß der Einfluss einer Störung des Feldes (einer Quelle) ist. Ist x der Raumzeitpunkt, wo die Quelle sitzt und y der Raumzeitpunkt, wo wir den Einfluss der Störung wissen wollen, dann ist D(x-y) der Propagator.
Anschaulich kann man sich vorstellen, dass man am Raumzeitpunkt x einen Stein in einen Teich wirft und dann etwas später am Raumzeitpunkt y guckt, wie groß dort gerade die Wasserwelle ist. Grafisch habe ich das mit diesem Bild hier dargestellt:
Nach oben geht die Zeit, horizontal die Ortskoordinate. Am Punkt x sitzt unsere Quelle, die am Ort y1 einen großen Einfluss hat, am Ort y2 dagegen einen verschwindend kleinen.
Wir hatten auch gesehen, dass der Einfluss der Quellen auf die Wahrscheinlichkeitsamplitude durch -J(x) D(x-y) J(y)/2 gegeben ist. Die Wechselwirkung zwischen zwei Quellen können wir also mit Hilfe des Propagators beschreiben. Und dieser Propagator hat direkt etwas mit den “Teilchen” zu tun, die wir beobachten.
Dazu denken wir erst einmal kurz nach, wie wir eigentlich Teilchen beobachten. Wir können beispielsweise Leuchtpunkte auf einem Leuchtschirm sehen – wobei jeder Leuchtpunkt durch ein einfallendes Elektron erzeugt wurde. Dabei messen wir allerdings nur, dass ein Elektron angekommen ist und wissen nichts über seine Eigenschaften. Besser geht es vielleicht mit einer Blasenkammer – da hinterlässt das Elektron eine Spur aus Gasblasen, die man auswerten kann. Ein angelegtes Magnetfeld lenkt die Bahn des Elektrons ab, so dass sie gekrümmt ist. So sieht das aus, wenn zum Beispiel ein Elektron-Positron-Paar entsteht:
Aus der Krümmung der Bahn können wir dann Informationen über den Impuls des Elektrons gewinnen (je schneller es fliegt, desto schwieriger ist es aus seiner Bahn zu bringen). Wir können uns vorstellen, dass wir zusätzlich noch einen Weg finden, das Elektron am Ende seiner Bahn tatsächlich einzufangen und es dann auf eine Waage zu legen, um seine Masse zu bestimmen. (Das könnten wir z.B. mit einem Massenspektrometer erledigen, aber ich bin ja kein Experimentalphysiker, solche technischen Details überlasse ich lieber anderen…)
Unser Elektron kommt natürlich auch irgendwoher – aus einer Elektronenkanone oder irgendeinem Prozess. Dieser Prozess ist die Quelle J(x); unsere Blasenkammer entspricht dem J(y). Zwischen den beiden Quellen fliegt jetzt das Elektron.
Diese Erklärung verwendete allerdings das Teilchenbild – ich habe ja von einem Elektron gesprochen. Wie passt das nun in unsere Quantenfeldtheorie, in der es ja eigentlich gar keine einzelnen Elektronen gibt, sondern nur Anregungen des Elektron-Feldes?
Unser Elektron transportierte Masse, Energie und Impuls (und noch ein paar andere Größen wie elektrische Ladung, Drehimpuls) in unsere Blasenkammer (wobei Energie und Impuls nur zwei Aspekte derselben Sache, des Viererimpulses, sind). Zwischen Masse, Energie und Impuls des Elektrons lässt sich eine Beziehung aufstellen, die laut der speziellen Relativitätstheorie für jedes Teilchen gilt.
Es gilt
E ist die Energie, m die (Ruhe-)Masse, p der Impuls und c die Lichtgeschwindigkeit, die ich hier mal netterweise (hoffentlich richtig) wieder eingebaut habe.
Nach den Regeln für Vierervektoren können wir das umschreiben als
Dann steht auf der linken Seite direkt das Quadrat des Viererimpulses.
Aus dieser ganzen Überlegung folgt: Ein Teilchen, das wir beobachten, muss eine bestimmte Beziehung zwischen Energie, Impuls und Masse erfüllen.
Beschreibt man das Teilchen quantenmechanisch, dann kann man dazu ja die Wellenfunktion verwenden, die ich hier und sehr ausführlich (für den nicht-relativistischen Fall) auch in dieser Serie erklärt habe. Die Wellenfunktion beschreibt ein einzelnes Teilchen als Welle oder als Überlagerung von Wellen zu einem Wellenpaket, so wie in diesem Bild vom letzten Mal:

By Omegatron – Own work, CC BY-SA 3.0, Link
Für die Wellenfunktion gilt, dass die Frequenz der Welle mit der Energie des Teilchens zusammenhängt. Es gilt E=hν=ħω, mit ν als Frequenz und ω=2πν als “Kreisfrequenz”. Der Impuls p und die Wellenzahl k (hier fettgedruckt, weil es dreidimensionale Vektoren sind) hängen ebenfalls zusammen: p=ħk. Unsere Beziehung für Energie und Impuls übersetzt sich dabei zu
ω2–k2=m2
(wobei ich ab jetzt wieder Faktoren von c und ? weglasse.)
ω und k bilden zusammen den Vierervektor aus Frequenz und Wellenzahl (folgt dem Link, wenn ich euch nicht mehr erinnert, ist ja schon ne Weile her). Wie meist sind die mathematischen Details nicht so wichtig, wichtig ist hier nur, dass für ein Teilchen der Impuls (oder die Wellenzahl) und die Energie (oder die Frequenz) zusammenhängen und keine beliebigen Werte annehmen können.
Ausgeschrieben ist unsere Energie-Impuls-Beziehung jetzt
oder in Kurzform
Ganz kurz können wir das auch schreiben als
Aber wir haben ja bisher keine “Teilchen” und nicht mal Wellenfunktionen für einzelne Teilchen, sondern zwei Quellen mit einem Propagator, richtig? Was wir jetzt tun müssen, um den Zusammenhang zwischen Teilchenbild und dem Propagator herzustellen, ist, den Propagator D(x-y) so umzuschreiben, dass wir ihn aus lauter Wellen zusammensetzen, die wir mit Frequenz und Wellenzahl beschreiben können. Dann können wir nämlich direkt prüfen, ob die richtige Beziehung zwischen Frequenz und Wellenzahl immer erfüllt ist; wenn sie das ist, dann beschreibt unser Propagator eine Störung unseres Quantenfelds, die sich wie ein Teilchen verhält – die Störung transportiert dann Masse, Energie und Impuls in der richtigen Menge.
Um den Propagator, der ja eine Funktion von (x-y) ist (wobei x und y vierdimensionale Raumzeitkoordinaten sind – immer dran denken, wir haben hier eine relativistische Theorie), in Wellen umzuschreiben, verwenden wir den Trick mit den Wellen, die Fourier-Transformation: In einer Dimension können wir jede Funktion als Summe über lauter Sinus- und Kosinus-Funktionen darstellen, die unterschiedliche Wellenlängen haben.
Unser Propagator hat jetzt aber nicht eine einfache Zahl als Argument in der Klammer, sondern (x-y). x und y sind zwei Raumzeitpunkte, für die man jeweils 4 Zahlen braucht. Um den Wert von (x-y) festzulegen, braucht man entsprechend auch vier Zahlen (und nicht etwa acht), denn es kommt nur auf die Differenz, also den Raumzeitabstand an.
Der Propagator ist also eine Funktion mit 4 Argumenten oder, anders ausgedrückt, eine Funktion in der vierdimensionalen Raumzeit. Wenn wir eine beliebige Funktion in vier Dimensionen mit Wellen darstellen wollen, dann reicht ein einfacher Sinus natürlich nicht – man muss Sinusse in unterschiedlichen Richtungen überlagern. Hier zum Beispiel ein paar Beispiele für solche Überlagerungen in zwei Dimensionen (direkt aus meinem Vorlesungsskript):
Hier braucht man also beliebige Wellen in x- und y-Richtung, die man überlagert. Mit lauter solchen Wellen in x- und y-Richtung kann man jetzt auch wieder jede (hinreichend gutartige) mathematische Funktion darstellen. Man braucht dann Wellen in x- und y-Richtung, entsprechend gibt es also Wellenlängen oder Wellenvektoren für die x- und für die y-Wellen. Im rechten oberen Bild zum Beispiel ist die Wellenlänge in x-Richtung doppelt so groß wie die in y-Richtung.
In drei Dimensionen geht es genauso (mit einer zusätzlichen z-Richtung), ist aber schwieriger zu zeichnen. Der zugehörige Wellenvektor k ist dann ein dreidimensionaler Vektor und ist natürlich genau der, der mit dem Impuls der Welle zusammenhängt.
Wenn noch die Zeit hinzukommt, dann müssen wir jetzt unsere Wellen auch noch zeitlich oszillieren lassen, also als Sinus- und Kosinus-Funktionen in der Zeit schreiben. Die Frequenz der zeitlichen Oszillationen ist wieder ω – um eine beliebige Funktion darzustellen, müssen wir natürlich auch wieder verschiedene Wellen mit unterschiedlichem ω überlagern.
Wir brauchen also alle möglichen Wellen in Raum und Zeit, gekennzeichnet durch ihre Wellenzahlen k und ihre Frequenzen ω. Mit denen können wir den Propagator jetzt als Kombination aus Wellen darstellen.
Die Formel lautet
oder, wenn man die Vierervektoren auseinanderzieht und (x-y) als (Δt, Δx) umschreibt (wie üblich ohne Garantie, dass ich alle Vierervektoren vorzeichentechnisch richtig aufgedröselt habe)
Bemerkenswert an den Formeln ist vor allem der Ausdruck iε im Nenner des Bruchs. Das ist ein mathematischer Trick, der dafür sorgt, dass das Integral nicht gleich explodiert, wenn k2=m2 ist. Löst man das Integral mit den Mitteln der Funktionentheorie, dann kann man mit dem ε dafür sorgen, dass am Ende alles sauber herauskommt (und das ε sollte am Ende aus der Rechnung herausfallen). Das sind aber mathematische Tricksereien, die ich bestimmt nicht erkläre, dazu ist meine Funktionentheorie-Vorlesung viel zu lange her.
Aber halt! Sollten nicht Wellenzahl und Frequenz in genau der richtigen Beziehung zueinander stehen, damit wir ein Teilchen beschreiben können? Müssten nicht also in der Formel für den Propagator nur diejenigen Kombinationen von ω und k auftreten, mit denen wir die richtige Energie-Impuls-Beziehung bekommen?
Schreibt man die Formel J(x)D(x-y)J(y)/2 in Wellenform um, dann stellt man fest, dass das zunächst nicht der Fall ist – alle möglichen Wellen leisten einen Beitrag und nichts garantiert, dass ω und k zueinander passen, dass also ω2–k2=m2 gilt . (Die Rechnung findet ihr im Buch von Zee, Kap. 1.4 oder vermutlich in jedem QFT-Buch der Welt.)
Je größer allerdings der Raumzeit-Abstand (x-y) zwischen den Quellen wird, desto stärker ist der Beitrag von nur genau den Wellen, bei denen ω und k im richtigen Verhältnis stehen, bei denen also ω2–k2 gleich m2 ist. Im Grenzfall einer sehr sehr weiten Entfernung (denkt im Zweifel an ein Teilchen der kosmischen Strahlung, aber auch ein paar Zentimeter und Zeitabstände im Mikro- oder Millisekundenbereich sind in der Quantenwelt ja schon viel) ist der Beitrag solcher Feldkonfigurationen, bei denen ω2–k2 ungleich m2 ist, verschwindend klein. Die Feldanregung sieht dann genau so aus wie ein Teilchen der Masse m, sie trägt Energie und Impuls in genau dem richtigen Verhältnis. Solche Anregungen sind das, was wir als “echte” Teilchen kennen. Auf diese Weise haben wir also (endlich) dem Extra-Term mit dem Parameter m einen Sinn verliehen: m ist die (Ruhe-)Masse der beobachteten Teilchen.
Wenn sich also eine Anregung von einer Quelle ausgehend über einen längeren Raumzeit-Abstand ausbreiten, dann kann diese Anregung wie einer Überlagerung aus Wellen beschrieben werden, die alle (in sehr guter Näherung) die richtige Frequenz-Wellenzahl-Beziehung (oder Energie-Impuls-Beziehung) haben, und zwar zu einem Teilchen mit einer Masse m. Wir messen deshalb ein Teilchen, und nicht eine beliebige Feldanregung.
Wie haben ja neulich schon diskutiert, warum man auch in einer Feldtheorie keine “halben” Elektronen sehen kann. Hier sehen wir dass dies nicht nur – wie neulich – für einzelne ebene Wellen gilt, deren Energie quantisiert ist, sondern auch für Störungen des Quantenfeldes, die sich ausbreiten. Messbare Anregungen durch Elektronen gibt es eben für Wellen, die eine Energie und einen Impuls tragen, die genau zur Masse m passen. Bei m/2 zum Beispiel, der halben Teilchenmasse, ist der Wert des Propagators dagegen klein, also sehen wir halbe Elektronen nicht. Von unserer Quelle breiten sich also Wellen aus, die sich mathematisch beschreiben lassen wie Teilchen der Masse m – unsere Feldtheorie hat also etwas wiederentdeckt, das wir schon wussten, nämlich dass es Teilchen gibt.
Weicht dagegen ω2–k2 von m2 ab, dann erfüllt die Welle die richtige Energie-Impuls-Beziehung nicht. In diesem Fall spricht man von einem “virtuellen” Teilchen. (Manchmal sagt man auch, dass das Teilchen nicht “auf der Massenschale” ist.) Die Begriffe “reales” und “virtuelles” Teilchen werden sehr häufig verwendet – schaut man aber ganz genau hin, dann sind alle Teilchen, die wir beobachten, “ein bisschen” virtuell, denn einen gewissen Beitrag der Terme mit ω2–k2 ungleich m2 gibt es immer. Wenn dieser Beitrag aber für alle praktischen Zwecke im Rahmen jeder Messgenauigkeit verschwindet, dann spricht man eben von einem “realen” Teilchen. Auf hinreichend kurzen Raumzeitabständen kann es durchaus einen nennenswerten Beitrag eines “halben Teilchens” geben (also mit ω2–k2= m2/4), aber diese Abstände sind so winzig, dass wir die entsprechenden Effekte nie als ein Teilchen wahrnehmen, denn Teilchen impliziert ja, dass wir ein Objekt haben, dass sich von der Umwelt isolieren lässt.
Das ist übrigens mal wieder ganz typisch für Physiker: Sie denken sich Begriffe wie “virtuelles Teilchen” aus und unterscheiden sie von “realen Teilchen”, weil das konzeptionell einfach ist, auch wenn diese Unterscheidung sich gar nicht ganz strikt treffen lässt. Sie hilft der Anschauung (in der Sprache von Daniel Dennett nennt man so etwas eine “intuition pump” – Intuitionspumpe -, wobei Dennett den Begriff vor allem für Gedankenexperimente verwendet) und ist nützlich, wenn man sich ein grobes Bild machen will. Wenn’s dagegen hart auf hart kommt, dann greift man lieber zu den Formeln, in denen diese klare Trennung so nicht drin steckt.
Und auch diese Feinheit ist etwas, das in den meisten Quantenfeldtheoriebüchern nicht erklärt wird, da wird munter von “realen Teilchen” gesprochen, obwohl die streng genommen nur ein Grenzfall sind. In den Worten von Feynman, der sich auf Photonen bezieht:
Of course any photon that has a physical effect may be considered as a virtual photon since it is not observed unless it interacts, so that observed photons never really have ω=± k. There are, however, no difficulties in passing to the limit; physically, we know of photons that come from the moon, or the sun, for which the fractional difference between ω and k is very, very small.
[Natürlich kann jedes Photon, das einen physikalischen Effekt hervorruft, als virtuelles Photon betrachtet werden, denn es wird nicht beobachtet wenn es nicht wechselwirkt, so dass beobachtete Photonen niemals wirklich ω=± k erfüllen. Es macht aber keine Schwierigkeiten, zum Grenzfall überzugehen; physikalisch kennen wir Photonen die vom Mond oder der Sonne kommen und für die der Bruchteil an Differenz zwischen ω und k sehr sehr klein ist.]
(Quelle: “Feynman Lectures on Gravitation” – übrigens ein tolles Buch, über das ich auch noch mal was schreiben muss.)
Jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen “Moment mal. Du schreibst ein paar Formeln hin, machst ein bisschen Formalismus und – Tusch, Applaus – plötzlich hast du bewiesen, dass es keine halben Elektronen geben kann? So ganz ohne Experiment, durch bloßes Nachdenken? Wie soll das denn gehen?”
Wenn ihr euch diese Frage gestellt habt: Glückwunsch zu eurer physikalischen Intuition. Der Einwand ist völlig berechtigt. Ich habe oben den Extra-Term eingeführt und jetzt gezeigt, dass er zur Teilchenmasse gehört. Würde man auch halbe Elektronen beobachten, dann müsste ich einen zweiten Extra-Term mit Parameter m/2 einführen, und würde man beliebige Bruchstücke von Elektronen beobachten können, dann müsste man ebenfalls einen entsprechenden Term einführen.
Mathematisch müsste man wohl eine Funktion m(μ) definieren und die Lagrange-Funktion um einen Term ∫ m(μ)^2 φ^2 d μ erweitern.
Berücksichtigt man noch die Elektronenladung, wird die Sache noch etwas komplizierter, weil die “halben” Elektronen vielleicht auch nur die “halbe” elektrische Ladung tragen würden, man müsste also an den entsprechenden Term auch eine passende Funktion dranbauen.
Ich habe keine Ahnung, ob jemand schon mal so eine Feldtheorie zusammengebastelt hat und ob die zu etwas gut wäre. Wir beobachten jedenfalls keine halben Elektronen, und es ist zumindest vom ästhetischen Standpunkt her befriedigend, dass der einfachste Extra-Term, den man sich ausdenken kann, genau dafür sorgt, dass eine bestimmte Teilchensorte nur eine bestimmte Masse hat.
Insofern habe ich die Frage “Warum gibt es keine halben Elektronen” nicht wirklich beantwortet – ich habe nur gezeigt, dass die einfachste denkbare Feldtheorie den jeweiligen Teilchen eine eindeutige Masse zuweist. (Die übrigens auch Null sein kein.) Die Physik ist und bleibt nun mal eine empirische Wissenschaft.
Wenn ihr die Serie bis hierher durchgehalten habt, dann herzlichen Glückwunsch: Mit dem Propagator habt ihr eins der wichtigsten Elemente der Quantenfeldtheorie kennengelernt. Er ist zentral für sehr viele Berechnungen, insbesondere auch für die berühmten Feynman-Diagramme. Wie man die aus dem Formalismus herzaubert, schauen wir uns auch demnächst an.
Vorher wäre es aber wirklich toll, wir würden mal eine echte physikalische Problemstellung angehen, oder? Was bedeutet es eigentlich physikalisch, wenn zwei Quellen per Propagator ein “Teilchen” austauschen? Das werden wir uns als nächstes ansehen und dabei herausbekommen, wieso Teilchen Kräfte vermitteln können. (Ein bisschen mag es aber noch dauern, bis der nächste Teil erscheint, mir fehlen noch ein oder zwei Ideen – hat jemand eine gute anschauliche Begründung, warum der Hamilton-Operator die Zeitentwicklung beschreibt?)
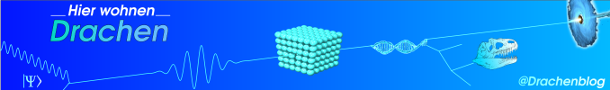

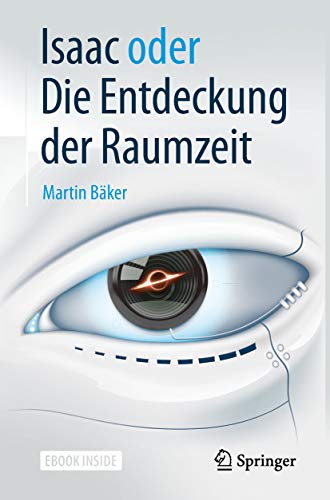



Kommentare (40)