Der Spin ist eine ziemlich seltsame Eigenschaft von Elementarteilchen – ein bisschen so, als würden sie sich wie kleine Kreisel drehen, ein bisschen aber auch nicht. Der Spin ist auch dafür verantwortlich, ob die Kräfte zwischen Teilchen anziehend oder abstoßend sind. Um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns aber den Spin noch etwas genauer ansehen.
Der Spin gibt die Richtung an
Wir bleiben erst einmal in der normalen Quantenmechanik – Gedanken über Relativität machen wir uns ein andermal. Nehmen wir ein beliebiges Teilchen1, das wir in einen Kasten einsperren – ganz egal, ob es ein echtes Elementarteilchen ist oder ein Atomkern oder sonst etwas. Wenn unser Teilchen einen Spin hat, dann können wir diesen Spin beispielsweise mit einem äußeren Magnetfeld beeinflussen und in eine bestimmte Richtung drehen (denn der Spin erfährt im Magnetfeld eine Kraft und dreht sich passend zum Magnetfeld).
1Nachtrag: Sascha hat in den Kommentaren zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht alle Teilchen mit Spin auf ein Magnetfeld reagieren, sondern nur geladene Teilchen oder solche, die sich aus geladenen zusammensetzen (wie Atome oder Protonen).
Jetzt schalten wir das äußere Magnetfeld aus und lassen unser Teilchen einen Moment in Ruhe. Da es einen Spin in eine bestimmte Richtung hat, werden jetzt auch seine Eigenschaften richtungsabhängig sein. Radioaktive Atomkerne zum Beispiel senden Teilchen bevorzugt ein eine zum Spin passende Richtung aus, wenn sie zerfallen (diese Eigenschaft hat ja auch zur berühmten Entdeckung der Paritätsverletzung geführt).
Was genau die Richtungsabhängigkeit unseres Teilchens sein soll, ist hier vollkommen egal – ob es ein radioaktiver Zerfall ist, ein messbares magnetisches Moment oder sonst irgendetwas, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass diese Richtungsabhängigkeit da ist.
Denn jetzt stellt sich die Frage: Wie ist sie eigentlich im Zustand des Teilchens “gespeichert”? Woher “weiß” der Atomkern, in welche Richtung er zerfallen muss? Irgendwie müssen wir diese Information in der Beschreibung des Teilchenzustands drin haben.
Ein quantenmechanisches Teilchen beschreibt man zunächst einmal durch seine sogenannte Wellenfunktion (die uns in der QFT-Serie hier begegnet ist). Wie immer in der Quantenmechanik kann man für bestimmte Prozesse nur die Wahrscheinlichkeitsamplituden kennen – das Quadrat der Wahrscheinlichkeitsamplitude gibt dabei die Wahrscheinlichkeit an, diesen Prozess zu messen. Kurz gesagt gibt die Wellenfunktion für jeden Ort die Wahrscheinlichkeitsamplitude an, das Teilchen an diesem Ort zu finden. Es gibt also eine Zahl für jeden Punkt des Raumes. (Wenn ihr mehr wissen wollt, folgt, den Links, ich habe die Sache mit der Wahrscheinlichkeit ja schon öfters erklärt. Weiter unten gibt es aber auch noch ein nettes Computer-Experiment dazu, das das ganze vielleicht noch anschaulicher macht.)
Diese Wellenfunktion allein kann die Spin-Information aber nicht speichern. Das geht deswegen nicht, weil zum Beispiel zwei Elektronen mit unterschiedlichem Spin genau dieselbe Aufenthaltswahrscheinlichkeit überall haben können. Die eigentliche Wellenfunktion (genauer gesagt: der ortsabhängige Teil) der beiden Elektronen im Grundzustand eines Helium-Atoms ist zum Beispiel dieselbe – trotzdem haben beide einen unterschiedlichen Spin. Auch die Tatsache, dass ein Elektron immer denselben Spin von ħ/2 hat, egal wie seine Wellenfunktion aussieht, spricht dafür, dass diese allein nicht ausreicht, um den Spin zu beschreiben.
Der Spin in Zahlen
Wir brauchen also eine zusätzliche Information. (Mathematisch wird die dann an die Wellenfunktion dranmultipliziert, aber das soll hier egal sein.) Diese zusätzliche Information muss irgendwie den Spin der Teilchen bechreiben.
Wenn das Verhalten des Teilchens richtungsabhängig ist, dann reicht eine einzige Zahl nicht aus, um den Spin zu beschreiben – denn mit einer Zahl könnt ihr keine Richtungsinformation geben (eine Schatzkarte mit der Erklärung “Gehe von der Statue 53 Schritte weit und grabe dort” wäre ziemlich sinnlos, es sei denn, ihr habt Lust, einen Graben vom 333 Schritten Länge (der Kreisumfang eines Kreises mit Radius 53 Schritt) zu buddeln).
Ein Teilchen mit Spin braucht also zusätzlich zu seiner Wellenfunktion noch ein paar Zahlen, die etwas über den Spin aussagen. Nun können wir den Spin (oder eine andere richtungsabhängige Eigenschaft) messen. Nach den Regeln der Quantenmechanik heißt das, dass es Wahrscheinlichkeitsamplituden für die unterschiedlichen möglichen Messwerte geben sollte. Wahrscheinlichkeitsamplituden sind aber komplexe Zahlen.
Insgesamt können wir folgendes aus all dem schließen: Ein Teilchen mit Spin braucht zusätzlich zu seiner Wellenfunktion noch einen Satz von komplexen Zahlen, die die Spin-Information festlegen.
Naiv könnte man glauben, dass man genau zwei Zahlen braucht – wenn der Spin zum Beispiel ħ ist, dann kann er in eine beliebige Richtung zeigen, und man braucht zwei Zahlen, um eine Richtung im Raum festzulegen. (Mit drei Zahlen kann man einen Punkt im Raum beschreiben und damit eine Richtung vom Koordinaten-Nullpunkt zu diesem Punkt festlegen. Wo auf dieser Richtungslinie der Punkt liegt, ist aber egal, also reichen zwei Zahlen. Das kann man sich am leichtesten anschaulich machen, wenn man einen Punkt auf der Erdoberfläche betrachtet: Um den festzulegen brauche ich zwei Zahlen, nämlich Längen- und Breitengrad, und damit liegt auch eine definierte Richtung fest, nämlich vom Erdmittelpunkt zu diesem Punkt.)
Wie gesagt, das könnte man so annehmen – es ist aber nicht korrekt. Wie viele Zahlen man tatsächlich braucht, hängt vom Wert des Spins ab. Das werden wir nachher noch sehen. Jedenfalls machen wir besser keine Annahmen darüber wieviele Zahlen wir tatsächlich brauchen.
Wir haben also einen Haufen Zahlen (bisher unbekannter Größe), die den Spin unseres Teilchens und damit die Richtungsabhängigkeit seiner Eigenschaften beschreiben. Damit das ganze nach theoretischer Physik aussieht, packen wir diesen Haufen Zahlen ordentlich hintereinander und geben den einzelnen Zahlen Namen (das “a” steht für Amplitude):
Das n sagt uns, wieviele Zahlen wir brauchen (wissen wir ja noch nicht). Falls ihr euch wundert, dass ich die Zahlen untereinander und nicht nebeneinander schreibe (was ja viel platzsparender wäre): Das ist eine mathematische Konvention, an die ich mich hier ausnahmsweise mal halte.
So. nun haben wir einen Haufen Zahlen. Wir wissen aber nicht, wie viele Zahlen wir brauchen, um unser Teilchen zu beschreiben und wissen auch sonst nichts über diese Zahlen. Und nun?
Rotationen
Nun verwenden wir einen Standard-Trick der theoretischen Physik – letztlich derselbe, der zur Relativitätstheorie führte. Ob und wie ein Teilchen zerfällt, sollte davon unabhängig sein, wer es anguckt. Das bedeutet, dass es egal ist, wie ich mein Koordinatensystem lege, in dem ich das Teilchen und seinen Spin beschreibe. Wir können nicht erwarten, dass Alice und Bob, die zwei unterschiedliche Koordinatensysteme verwenden, dieselben Zahlen a1… verwenden, aber zwischen ihren Zahlen muss es eine Beziehung geben.
Nennen wir die Amplituden, die Bob verwendet, passend b, dann muss es also eine Beziehung geben, mit der wir aus Alices Zahlen Bobs Zahlen berechnen können:
Über diese Beziehung können wir einiges aussagen: Wir haben es hier mit Wahrscheinlichkeitsamplituden zu tun. Die können miteinander interferieren. Das gibt uns einige Informationen über das mathematische Verhalten dieser Beziehung. Die Beziehung muss sich nämlich durch einen einfachen Satz von Zahlen beschreiben lassen, und zwar muss es n2 dieser Zahlen geben, wenn wir n Amplituden haben.
Mathematisch bedeutet das, dass die Beziehung zwischen den a’s und b’s linear sein muss, das heißt, die b’s entstehen aus den a’s in einer Gleichung, in der niemals zwei a’s miteinander multipliziert werden und auch keine komplizierten Funktionen wie sinus und cosinus involviert sind. Wenn ihr es mathematisch hinschreiben wollt, sieht es so aus:
Kurz gesagt, der lineare Zusammenhang zwischen a und b lässt sich als Matrixgleichung schreiben:
Diese Zahlen müssen natürlich irgendwie mit der Drehung zwischen den beiden Systemen von Alice und Bob zusammenhängen und aus ihr berechnet werden können.
Dazu nutzen wir aus, dass wir Drehungen hintereinander ausführen können. Beispielsweise wissen wir, dass zwei Drehungen hintereinander ausgeführt äquivalent sind zu einer einzigen Drehung. Das zeigt dieses kleine Bildchen:
Ihr seht meinen Lieblings-Würfel (ja, jeder Fantasy-Rollenspieler hat Lieblingswürfel), den ich erst einmal um 90° um eine senkrechte Achse gedreht habe, dann 90° um eine horizontale. Ich kann dasselbe Ergebnis auch durch eine einzige Rotation erreichen, wenn ich ihn um 120° um eine Achse drehe, die diagonal von der vorderen rechten oberen Ecke zur hinteren linken unteren verläuft. (Wenn ihr’s nicht glaubt, probiert es selbst aus.)
Nehmen wir also an, zusätzlich zu Bob und Alice kommt auch noch Charlie ins Spiel, mit seinen Amplituden
Es muss logischerweise egal sein, ob ich zuerst von Alices System in Bobs System gehe (Würfel einmal um 90° gedreht ) und dann in Charlies (Würfel nochmal um 90° gedreht), oder ob ich gleich von Alices System in Charlies System gehe (Würfel um 120° diagonal gedreht). Da wir wissen, was passiert, wenn man zwei Rotationen hintereinander ausführt, können wir daraus weitere Informationen über die Berechnungsvorschrift ableiten, mit der unsere n2 Zahlen bestimmt werden. Dazu werfen wir die Mathematik-Maschine an und lassen sie eine Weile rechnen.
Diese Rechnung findet ihr in vermutlich jedem Quantenmechanikbuch der Welt. Man vereinfacht das ganze dadurch, dass man nur infinitesimal kleine Drehungen betrachtet. (Mathematisch gesehen guckt man sich nicht die Rotations-Gruppe an, sondern ihre Lie-Algebra. Aber um das zu erklären, bin ich echt nicht der richtige.) Dann baut man sich die Matrix
(Wobei die M’s die Lie-Algebra-Elemente sind) und nimmt an, dass der a-Vektor ein Eigenvektor zu M2 ist, mit einem bestimmten Eigenwert. Mit Hilfe der Kommutator-Beziehungen zwischen den einzelnen M’s kann man dann Auf- und Absteige-Operatoren bauen.
Am Ende wirft unsere Mathematik-Maschine folgende Erkenntnis aus:
Unser Zahlenhaufen (die ganzen a’s) kann beliebig viele Einträge haben – der Spin-Zustand eines Teilchens kann also durch zwei, drei, vier usw. Zahlen gekennzeichnet sein. (Wenn es nur eine Zahl ist, dann hat unser Teilchen keinen Spin.)
Es ist praktisch, eine neue Zahl j=(n-1)/2 zu definieren. Haben wir zwei a-Werte, dann ist dieses j=(2-1)/2=1/2, haben wir drei ist j=1, bei 4 ist j=3/2 und so weiter. (Bei nur einem a-Wert, also gar keiner Richtungsabhängigkeit, ist j=0.)
Dieses j ist – bis auf einen Faktor ħ – der Spin unseres Teilchens. Um den Spin-Zustand eines Elektrons zu beschreiben, brauche ich also zwei Zahlen (n=2j+1)
für ein Spin-1-Teilchen drei
und für ein Spin-2-Teilchen fünf
Wir messen Spinzustände
So weit, so gut. Wir haben eine mathematische Beschreibung des Spins gefunden, das ist ja schon mal was. Aber vielleicht wundert ihr euch über eins:
Beim Stern-Gerlach-Experiment kamen genau zwei Messflecken für die Elektronen heraus. Das würde doch heißen, dass der Spin-Zustand eines Elektrons durch eine einzige Angabe (rauf oder runter, 1 oder 0, wie auch immer ihr die nennen wollt) festgelegt werden kann, sozusagen durch ein einziges Bit.
Und jetzt haben wir gesehen, dass man zwei komplexe Zahlen braucht, um den Spinzustand des Elektrons zu beschreiben, nämlich
Wie passt das zusammen? Ein Bit, oder zwei komplexe Zahlen?
Beides ist in gewisser Weise richtig – das ist wieder einmal das berühmte Messproblem der Quantenmechanik in anderer Form. (In der Quantencomputersprache würde man sagen, unser Spin ist ein Quantenbit oder kurz Qubit.) In unserer Schreibweise mit den a’s können wir die beiden Zustände (Spin rauf und Spin runter) so darstellen:
Unsere a’s sind ja Wahrscheinlichkeitsamplituden, sie geben also an, wie wahrscheinlich es ist, dass ich einen bestimmten Messwert bekomme.
Wenn mein Elektron im Zustand ↑ ist und ich messe seinen Spin mit einem passend orientierten Stern-Gerlach-Experiment, dann messe ich auch tatsächlich immer genau diesen Zustand. Umgekehrt gilt das gleiche für den zustand ↓. Wenn ich aber ein Elektron in einem anderen Zustand habe, zum Beispiel
dann messe ich in 50% der Fälle ↑ und in 50% der Fälle ↓. (Man muss die Amplituden jeweils quadrieren, um die Wahrscheinlichkeiten zu bekommen.)
Im Allgemeinfall gilt, dass für den Zustand
die Wahrscheinlichkeit, den Spin nach oben zu messen durch |a1|2 gegeben ist und für den Spin nach unten entsprechend durch |a2|2.
Wenn ich den Elektron-Spin aber gemessen habe, dann hat er hinterher auch den gemessenen Wert. Wenn ich also ein Elektron im Zustand
in meinen Apparat hineinschicke, dann ist es hinterher entweder im Zustand
wenn ich den Spin oben gemessen habe, oder im Zustand
wenn ich den Spin unten gemessen habe.
Und was passiert, wenn man den Stern-Gerlach-Apparat in eine andere Richtung dreht? Das könnt ihr selbst ausprobieren! Ich habe nämlich gerade ein total cooles Applet gefunden, mit dem man den Stern-Gerlach-Versuch selbst nachspielen kann:
Wenn ihr es ausprobieren wollt, klickt hier.
Oben könnt ihr die Messapparatur einstellen, links den Zustand der Atome, deren Spin ihr messen wollt. Per default sind die Spins anfänglich in x-Richtung ausgerichtet, aber es ist vermutlich einfacher, ihr schaltet das um und wählt für die Spin-Orientierung erst mal +z, also ↑
Ihr könnt einzelne Atome abschießen (“Fire Atom”) oder den Apparat automatisch die Atome schießen lassen – der Geschwindigkeitsregler sorgt dafür, dass ihr schnell eine gute Statistik anhäufen könnt.
Wenn ihr mit +z-Spins anfangt und den Apparat so lasst, wie er ist, dann bekommt ihr 100% aller Atome im oberen, roten Kanal und keine im unteren. Das ist nach dem eben gesagten auch logisch. Wenn ihr den Stern-Gerlach-Apparat dreht (oben mit dem Winkel-Einsteller), dann verschieben sich die Wahrscheinlichkeiten. Liegt er bei genau 90°, dann bekommt ihr gleich viele Atome in beiden Kanälen, das ist genau der 50-50-Zustand von eben.
Spielt ein bisschen damit herum, dann bekommt ihr hoffentlich ein Gefühl für die Sache. Anschließend könnt ihr auch einen zweiten Messapparat hinter den ersten schalten. Ihr könnt dann zum Beispiel schauen, was passiert, wenn ihr die beiden Apparate gegeneinander verdreht.
Ist beispielsweise der erste Apparat um 90° gedreht, dann gehen 50% der Atome durch. Diese Atome sind jetzt in einem klar definierten Spinzustand, nämlich +x; der Spin zeigt in +x-Richtung. Wenn ihr den zweiten Apparat ebenfalls um 90° dreht, dann kommen alle Atome, die den ersten passieren, auch durch den zweiten durch. Dreht ihr dagegen den zweiten Apparat auf 0°, bleiben wieder 50% der Atome hängen.
Der Spin in der Quantenmechanik
Was haben wir herausgefunden? In der Quantenmechanik wird ein Teilchen mit Spin j durch 2j+1 Zahlen beschrieben (natürlich zusätzlich zu seiner Wellenfunktion, die uns sagt, wo sich das Teilchen vermutlich gerade rumtreibt). Die drei wichtigsten Fälle sind das Elektron (Spin 1/2, 2 Zahlen), Spin 1-Teilchen wie das Photon (3 Zahlen) und Spin-2-Teilchen wie das Graviton (5 Zahlen).
Wir haben auch dank des Stern-Gerlach-Experiments gesehen, was passiert, wenn man den Spin misst.
Aber was passiert, wenn wir Quantenfeldtheorie betreiben? Dort gibt es ja gar keine klar abzählbaren Teilchen, sondern nur Überlagerungen von Feldern oder Propagatoren. Und außerdem haben wir uns hier alles mit Hilfe von Rotationen überlegt – aber wegen der speziellen Relativitätstheorie sind Raum und Zeit ja gemischt. Was passiert dann? Hat der Spin dann auch eine Zeitkomponente? (Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja, in gewisser Weise schon.)
Und mit diesem kleinen Cliffhanger verweise ich dann auf die nächste Folge der endlosen Serie “Quantenfeldtheorie für alle“.
Die Erklärung des Zusammenhangs zwischen Richtungsabhängigkeit und Spin stammt aus
R. Feynman “The Theory of Fundamental Processes”, das ich vorletztes Wochenende zu meiner großen Freude vollkommen überraschen auf dem Dachboden gefunden habe.
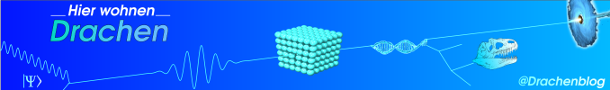

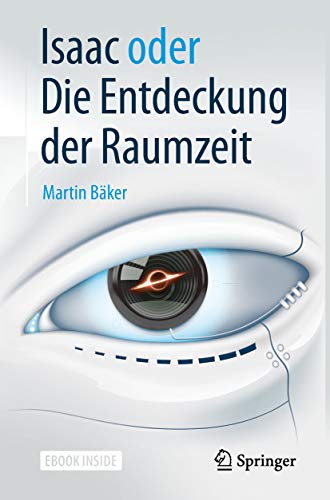



Kommentare (40)