Ich geb’s gleich im Vorfeld zu: Von Literaturwissenschaft habe ich nicht so viel Ahnung (abgesehen von zwei Seminaren bei den Anglisten, damals, als ich noch jung war (kurz nach Ende der letzten Eiszeit)). Was Literaturwissenschaftler genau treiben, weiß ich nicht – aber anscheinend haben sie zum einen ein eigenwilliges Verständnis von Vorlesungen und ansonsten eine Vorliebe dafür, Trivialitäten toll zu verpacken oder auch Leute zu zitieren, die das tun.
Dies jedenfalls entnehme ich dem Leitartikel der Zeitschrift “Forschung und Lehre” des DHV. In der aktuellen Ausgabe schreibt Friedmar Apel, Universitätsprofessor für Literaturwissenschaft, über den Wert von Vorlesungen gegenüber schriftlichen Veröffentlichungen. Und da lesen wir wirklich Erstaunliches.
Ich beschränke mich auf den letzten Absatz, denn der führte dazu, dass ich heute schallend lachend in meinem Büro saß. Dort lesen wir
Vorlesungen könnten eine Funktion erfüllen, die Odo Marquard in einer allgemeinen “Kunstregel” formuliert hat: “Informationskomplexität wird reduziert durch Rekurs auf Mündlichkeit.”
Das muss man erst mal sacken lassen. Informationskomplexität wird also reduziert. Hmm, was heißt denn das? Wenn man Komplexität reduziert, dann wird sie weniger – die Information wird also weniger komplex. Sozusagen “einfacher”.
Und wie passiert das? Durch “Rekurs auf Mündlichkeit”. “Mündlichkeit” heißt, dass gesprochen wird, nicht geschrieben. Und “Rekurs” – nun ja, soviel wie “Zurückgehen” oder vielleicht in diesem Zusammenhang besser “Zurückgreifen”.
Erste Übersetzung: “Durch Zurückgreifen aufs Sprechen werden Informationen einfacher.” Wow. Wer hätte das gedacht? Gesprochene Sprache ist meist einfacher formuliert als Schriftsprache! Schon eine umwerfende Erkenntnis – für die man sich deswegen auch besser Unterstützung in Form einer Autorität (obwohl ich ja ehrlich zugebe, Odo Marquardt nicht zu kennen) holt; nicht, dass noch jemand denkt, diese bahnbrechende Neuigkeit hätte sich Prof. Apel ganz allein ausgedacht.
Beim nochmaligen Lesen macht mich dann die Einleitung des Satzes stutzig: “Vorlesungen könnten” diese Funktion erfüllen? Heißt das, sie tun das gar nicht? Wird in literaturwissenschaftlichen Vorlesungen der Rekurs aufs Mündliche nur insofern realisiert, als dass im Vorfeld fixierte Verbalkonstrukte mündlich reproduziert werden?1 Lesen Literaturprofs ihre Vorlesungen wirklich vor? Und jetzt, im 21. Jahrhundert, merkt einer, dass das vielleicht das Verstehen schwieriger macht, als wenn man frei sprechen würde?
1
Macht irgendwie Spaß, solche Sätze zu schreiben, da kommt man sich ein bisschen vor wie Sir Humphrey Appleby, mit seinem unsterblichen Satz: “The identity of the official whose alleged responsibility for this hypothetical oversight has been the subject of recent discussion is not shrouded in quite such impenetrable obscurity as certain previous disclosures may have led you to assume, but, not to put too fine a point on it, the individual in question is, it may surprise you to learn, one whom your present interlocutor is in the habit of defining by means of the perpendicular pronoun. ”
Möglicherweise ist das so, denn wir lesen weiter:
In literaturwissenschaftlichen Vorlesungen sollten dann nicht Aufsätze abgelesen werden, sondern Auslegungen performativ vorgetragen und besprochen werden…
Ich bin etwas baff. Dass man Vorträge möglichst nicht abliest, ist doch so ungefähr “Rhetorik 101” – bei Politikern sehe ich’s ja noch ein bisschen ein, die schreiben ihre Rede nicht selbst und bei denen wird auch jede falsche Formulierung gleich auf die Goldwaage gelegt. Aber in einer Vorlesung? Mit Studis, die man für ein Thema begeistern will? Aber bitte nicht einfach erzählen – nein, da muss man schon “performativ vortragen”. (Und dank Wikipedia lerne ich gerade, dass eine Sprechhandlung “performativ” ist, wenn sie ausgeführt oder konkretisiert wird. Bei weiterem Lesen des Artikels muss ich aber zugeben, das ich mir nicht recht vorstelen kann, wie man eine literaturwissenschaftliche Vorlesung “performativ” vorträgt – wie trage ich denn eine Auslegung so vor, dass ich beim Vortragen das Gesagte gleich konkretisiere?)
Aber der Artikel bietet noch weitere geradezu unglaubliche Erkenntnisse, die der Reduktion der Informationskomplexität in Nichts nachstehen. Ich zitiere das Ende des Meisterwerks:
Mündliche Darlegungen von Forschungsergebnissen zu Shakespeare, Goethe oder Flaubert in einer zugewandten Sprache dienten schließlich im Sinne Marquardts auch der “Kompensation von Vertrautheitsdefiziten” in der beschleunigten Bologna-Welt.
Auch hier erstmal der Blick auf das Zitat: “Kompensation von Vertrautheitsdefiziten”. Hmmm – “Vertrautheitsdefizit”, da mangelt es also an Vertrautheit, beispielsweise mit Shakespeare. Und das wird “kompensiert”. Mit anderen Worten, es wird etwas (Trommelwirbel bitte) “gelernt”! Und zwar durch “mündliche Darlegung… in zugewandter Sprache.” Sapperlot. Wenn ich in einer Vorlesung so rede, dass mich jemand versteht, dann könnte der etwas lernen. Das ist ja geradezu unglaublich.
Und gerade in der “beschleunigten Bologna-Welt” (ein Seitenhieb gegen die ist in jeder DHV-Veröffentlichung Pflicht) wäre das natürlich wichtig. Wahrscheinlich deshalb, weil all die beschleunigten Bologna-Studis keine Lust haben, Wortkonstrukte wie “Informationskomplexität wird reduziert durch Rekurs auf Mündlichkeit” zu analysieren um zu sehen, dass dahinter absolute Trivialitäten stehen.
Aber Spaß macht es natürlich. Wir können ja alle mal ein bisschen probieren. Wie wär’s mit
“Durch ihren essayistischen Charakter leisten Publikationen in modernen Kommunikationsmedien (Blogs) einen signifikanten Beitrag zur Popularisierung und Ent-Anonymisierung der Wissenschaft.” Oder
“Durch die Utilisation komplexer verbaler Strukturen nötigt der Literaturwissenschaftler den Adressaten zu unproportional augmentierter syntaktischer Verarbeitung und reduziert so die Fähigkeit zur semantisch korrekten Rezeption.”
Der erste Satz des Artikel lautet übrigens “Es fällt offenkundig leichter denn je, die Deutungen der Literaturwissenschaft als Glasperlenspiel zu belächeln.” Nach der Lektüre des Artikels bin ich versucht, dem zuzustimmen (auch wenn das Hesse’sche “Glasperlenspiel” ja nicht wirklich nutzlos war).
PS: Ja, ich weiß – das war nicht wirklich fair (deswegen ist es ja auch eine Polemik); mit etwas Suchen findet man wahrscheinlich auch ähnlich sinnlos verkomplizierte Physik-Texte. (Wobei Physiker natürlich auch nicht gerade diejenigen sind, die den Umgang mit Sprache zu ihrem Anliegen machen, dafür haben wir Formeln.) Falls ihr Literaturwissenschaftler seid und euch auf den Schlips getreten fühlt, seid ihr herzlich eingeladen, das Bild in den Kommentaren wieder geradezurücken. Oder vielleicht mal in einem Gastbeitrag erklären, was Literaturwissenschaftler so treiben? Geisteswissenschaftler haben wir hier eh zu wenig…
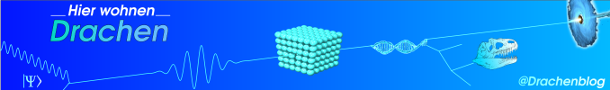

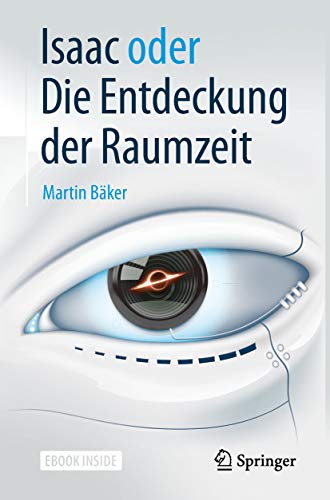



Kommentare (81)