Geschlechtergerechte Sprache ist ja immer ein Aufregerthema. Versteht nicht jeder sofort, was gemeint ist und weiß, dass “die Studenten” natürlich auch Frauen sein können? Beeinflusst ein solches “generische Maskulinum” unser Denken? Eine wissenschaftliche Studie, auf die ich kürzlich aufmerksam gemacht wurde, gibt eine einigermaßen klare Antwort auf diese Frage.
Es ist natürlich nicht ganz einfach, diese Frage zu untersuchen, denn man braucht ja einen Vergleich zwischen Formulierungen mit generischem und ohne generisches Maskulinum, und wirklich neutrale Formen sind im Deutschen ja ziemlich selten und ungewohnt. Die ForscherInnen haben deshalb drei unterschiedliche Sprachen miteinander verglichen: Deutsch und Französisch als Sprachen mit ausgeprägtem “generischen Maskulinum” sowie Englisch als wesentlich neutralere Sprache.
Dann legten sie Versuchspersonen Satzpaare in den jeweiligen Sprachen vor, beispielsweise dieses:
(1) Die Sozialarbeiter gingen durch den Bahnhof.
(2) Weil das Wetter schön war, trugen einige der Frauen keinen Mantel.
Die Versuchspersonen sollten dann entscheiden, ob der zweite Satz eine korrekte Fortführung des ersten Satzes sein könnte. Wenn “die Sozialarbeiter” ein generisches Maskulin ist, dann ist das sicherlich korrekt, wenn “die Sozialarbeiter” dagegen als männlich verstanden werden, dann nicht.
Natürlich hat man hier das zusätzliche Problem, das gewisse Bezeichnungen für Personen tendenziell eher als männlich oder weiblich stereotypisiert sind – Kosmetiker sind wohl meist weiblich, Ingenieure öfters männlich.
In einer Voruntersuchung wurden deshalb insgesamt 126 Personenbezeichnungen von Versuchspersonen danach eingestuft, ob es sich hier eher um Männer oder um Frauen handeln dürfte. Von diesen 126 Gruppenbezeichnungen wurden 36 ausgewählt, die von
Sprechern aller drei Sprachen als deutlich “typisch männlich”, “typisch
weiblich” oder “neutral” eingestuft wurden.
So entstehen also drei Gruppen von Personenbezeichnungen: Solche mit eher männlichem Stereotyp (Spion, Politiker, Flieger), solche mit eher neutralem Stereotyp (Spaziergänger, Kinobesucher, Nachbar) und solche mit weiblichem Stereotyp (Krankenpfleger, Wahrsager, Geburtshelfer).
Anschließend wurden dann verschiedene Satzpaare wie im Beispiel oben verwendet und von Versuchspersonen danach eingestuft, ob der zweite Satz jeweils eine gültige Fortsetzung des ersten sein könnte.
Bei den englischsprechenden Versuchspersonen war das Ergebnis ziemlich eindeutig: Wenn es sich um ein männliches Stereotyp bei der Personenbezeichnung handelte, dann akzeptierten 88% der Versuchspersonen eine Fortsetzung mit männlichen Begriffen, aber nur 65% eine, bei der der zweite Satz von Frauen handelte. Bei einem weiblichen Stereotyp war es umgekehrt, 85% akzeptierten einen zweiten Satz, in dem es um Frauen ging, 66% einen Satz mit Männern. War das Stereotyp neutral, so wurden 81% der Fortsetzungssätze akzeptiert, unabhängig vom Geschlecht, das im zweiten Satz spezifiziert wurde.
Die Schlussfolgerung ist hier ziemlich klar: Englischsprechende Versuchspersonen lassen sich tendenziell vom Stereotyp leiten, also davon, ob die jeweils beschrieben Personengruppe tendenziell als männlich, weiblich oder neutral empfunden wird, und halten eine zum Stereotyp passende Fortsetzung für plausibler.
Betrachten wir als nächstes die französisch-sprechende Gruppe. Bei einem männlichen Stereotyp wurde ein Fortsetzungssatz mit Männern in 83% der Fälle als gültig akzeptiert, einer mit Frauen nur mit 58%. Von den insgesamt etwas geringeren Prozentzahlen abgesehen, ist das Ergebnis dem der Englisch-Sprechenden sehr ähnlich. War aber das Stereotyp im ersten Satz weiblich, dann wurden trotzdem Männer im Fortsetzungssatz mit 77% akzeptiert, Frauen nur mit 59%. Im Fall eines neutralen Stereoytps war das Ergebnis ähnlich, Männer wurden in 73% der Fälle akzeptiert, Frauen in 56% der Fälle.
Es ist also, anders als bei den Englisch-Sprechenden, nicht das Stereotyp, das entscheidet, sondern es werden in allen Fällen eher Männer als Frauen als mögliche Fortsetzung für einem Satz akzeptiert, der ein generisches Maskulinum verwendet.
Im Deutschen waren die Ergebnisse prinzipiell ähnlich wie im Französischen, allerdings auf einem insgesamt niedrigeren Prozentniveau: Bei männlichem Stereotyp wurden Männer in 69% der Fälle akzeptiert, Frauen in 35% der Fälle, bei neutralem Stereotyp waren es 72% und 45%, bei weiblichem Stereotyp 65% und 40%. Auch hier sind die Zahlen also in allen drei Fällen ähnlich und es wurden generell Männer eher als gültige Fortsetzung akzeptiert als Frauen.
Achtung, dies bedeutet nicht, dass die entsprechenden Stereotypen im Deutschen oder Französischen nicht existieren – die wurden ja in einer Voruntersuchung gefunden. Aber obwohl die meisten beim Beruf “Kosmetiker” eher an eine Frau denken, wird dieser Effekt anscheinend durch das generische Maskulinum überlagert.
Allerdings fällt auf, dass die Zahlen bei den Französisch- und Deutsch-Sprechenden Versuchspersonen generell niedriger ausfallen. Man könnte argumentieren, dass diese den ersten Satz eben als generisch interpretieren, also implizit erwarten, dass es sich um eine gemischt-geschlechtliche Gruppe handelt, und deshalb dann den zweiten Satz häufiger nicht akzeptieren, weil “einige der Frauen” dann für sie implizierte, dass es sich im zweiten schon im ersten Satz ausschließlich um Frauen handelt.
Die ForscherInnen halten diese Erklärung – zumindest als alleinige – für nicht zutreffend. Zum einen, weil man dann erwarten müsste, dass zumindest einige Versuchspersonen solche Fortsetzungssätze mit weiblicher Fortsetzung niemals akzeptieren. So ist es aber nicht, die Akzeptanz fällt zwar geringer aus, aber es gab keine Versuchsperson, die eine weibliche Fortsetzung im zweiten Satz grundsätzlich immer ablehnte.
Die Autorinnen führen noch ein weiteres Argument an, das ich aber nicht verstanden habe, deswegen hier nur das Zitat:
Furthermore, in our pilot study female continuations were only taken to indicate that the group comprised exclusively of women in six instances (4%).
Woher diese Information stammt, ist mir aus dem Text nicht klar geworden.
Ein weiterer Einwand könnte darin bestehen, dass sich die englische Kultur einfach generell stark von der deutsch- oder französisch-sprachigen Kultur der Schweiz (wo die Experimente stattfanden) unterscheidet. Dafür gibt es aber keinen Beleg, und die Untersuchung, welche Rollen wie stereotypisiert werden, hat einen solchen Unterschied auch nicht gezeigt. Wer also so argumentieren will, müsste dafür einen Beleg bringen.
Es wurde übrigens auch untersucht, wie lang die Reaktionszeiten bei positiven Antworten jeweils waren – braucht jemand, der deutsch oder französisch spricht, länger, um zu erkennen, dass eine weibliche Fortsetzung für ein generisches Maskulinum möglich ist? In der Arbeit wird dies zumindest bei der deutschsprachigen Gruppe gefunden (in einer leider nicht sehr genau ausgeführten statistischen Analyse), bei der französischsprachigen nicht. Die Daten sind allerdings nicht besonders eindeutig, weil die Streuung der Versuchsergebnisse sehr hoch und der Effekt eher klein ist. Sehr ausgeprägt ist ein solcher “Verzögerungseffekt” also anscheinend nicht.
Weitere Experimente wurden in Norwegen durchgeführt. Norwegisch hat anscheinend ursprünglich ähnlich klare grammatische Geschlechter wie das Deutsche oder Französische, in den letzten 30 Jahren wurde aber die Sprache so verändert, dass die weiblichen Bezeichnungen immer weniger verwendet wurden, so dass das männliche Geschlecht heutzutage tatsächlich generisch verwendet wird wie im Englischen. Es zeigte sich, dass bei der Akzeptanz einer gültigen Fortsetzung bevorzugt Männer gewählt wurden, wenn es sich um ein männliches Stereotyp handelte, und Frauen bei einem weiblichen Stereotyp, so wie im Englischen. Ist das Stereotyp allerdings neutral (wie “Nachbar”), dann gab es eine Bevorzugung von Männern gegenüber Frauen. Die Autoren schließen daraus, dass es immer noch einen “Nacheffekt” der ursprünglichen Sprachform gibt – ob das wirklich plausibel ist, weiß ich nicht.
Was meiner Ansicht nach bei diesen Studien schade ist, ist, dass keine echt neutralen Formen im Deutschen ausprobiert wurden, wie beispielsweise “Kind”, “Mitglied”, “Person” oder auch moderne Konstrukte wie “Studierende”. Das könnte zeigen, ob in diesem Fall dann keine Bevorzugung eines Geschlechts mehr vorliegt, wie im Englischen, oder ob auch dann die männliche Form gegenüber der weiblichen deutlich bevorzugt wäre (so wie bei den stereotyp-neutralen Formen im Norwegischen). Wie gesagt, da das Experiment so nicht durchgeführt wurde, kann man hier nur spekulieren.
So oder so scheint mir das Ergebnis der Studien relativ deutlich: Das sogenannte “generische Maskulinum” wird tendenziell eher als echtes Maskulinum verstanden und es fällt Versuchspersonen schwerer, sich unter einer generischen Form Frauen vorzustellen. Anscheinend beeinflusst die Grammatik unser Denken also doch. Grund genug, über geschlechtsneutrale Formulierungen nachzudenken.
Gygax, P., Gabriel, U., Sarrasin, O., Garnham, A. & Oakhill, J. (2009). Some grammatical rules are more difficult than others: The case of the generic interpretation of the masculine.
European Journal of Psychology of Education, 24, 235-246
Gygax, P., Gabriel, U., Sarrasin, O., Garnham, A. & Oakhill, J. (2008). There is no generic masculine in French and German: When beauticians, musicians and mechanics are all men.
Language and Cognitive Processes, 23(3), 464-485.
Gefunden via Sprachlog
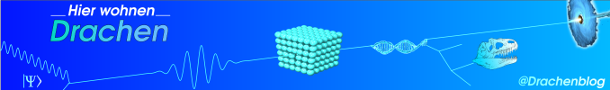

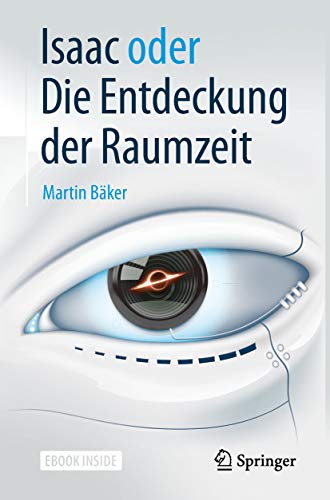



Kommentare (289)