Über fünf Teile dieser Serie haben wir jetzt den Weg eines Teilchens von A nach B verfolgt und dabei immer mehr Komplikationen eingebaut, bis schließlich sogar der ominöse Higgs-Mechanismus ins Spiel kam. Anscheinend ist es gar nicht so einfach, mal eben von A nach B zu fliegen, wie man denkt. In diesem letzten Teil der Serie möchte ich mir noch ein paar allgemeine Gedanken zu den vielen Modellen machen, mit denen wir es zu tun hatten. (Ihr könnt diesen Teil übrigens auch dann lesen, wenn euch die anderen zu kompliziert und abgefahren waren…)
Zwei Dinge sind meiner Ansicht nach an diesem einfachen Beispiel bemerkenswert. Das erste ist ziemlich offensichtlich, aber dennoch immer wieder ein Anlass zum Staunen: Man kann eins der simpelsten Phänomene der Welt betrachten und landet am Ende bei den fundamentalsten Gesetzen. Ein Beleg dafür, dass in der Naturwissenschaft alles mit allem verknüpft ist (während EsoterikerInnen und andere ja die Wissenschaft gern als eine Art Buffet betrachten, wo sie sich mit den Ergebnissen bedienen, die ihnen schmecken, und die anderen liegen lassen). Egal welches simple Phänomen ihr anguckt – guckt ihr genau genug hin, dann findet ihr überall faszinierende Wissenschaft und landet bei den letzten Fragen.
Noch etwas anderes ist bemerkenswert, und vielleicht viel weniger offensichtlich: Jede unserer Überlegungen und Beschreibungen, egal ob in der klassischen Physik, der Quantenmechanik oder der Quantenfeldtheorie, war in sich schlüssig und gab eine sinnvolle Beschreibung des Wegs von A nach B; aber je weiter wir kamen, desto mehr Effekte wurden berücksichtigt. Für die meisten praktischen Zwecke können wir makroskopische Teilchen mit den Mitteln der klassischen Physik beschreiben und Elektronen, die sich nicht zu schnell bewegen, mit den Mitteln der Quantenmechanik. Welche Beschreibung angemessen ist, ist vor allem eine Frage dessen, was wir eigentlich mit unserer Beschreibung erreichen wollen. Alle Beschreibungen sind Modelle – sie haben unterschiedliche Reichweite und Anwendungsbereiche, aber jede Beschreibung hat ihren Daseinszweck, und es wäre ziemlich unsinnig, einen Ball, der von A nach B rollt, mit der vollen Maschinerie der QFT berechnen zu wollen. Über diese Kunst des Denkens in Modellen habe ich auch schon mal ausführlich nachgedacht.
Ist es eigentlich selbstverständlich, dass das so ist, dass wir also für einfache Fragestellungen auch einfache Modelle finden, die von der zu Grunde liegenden Komplexität nichts merken?
Einerseits ist es natürlich plausibel, dass wir Quanteneffekte eben nur dann bemerken, wenn wir Phänomene betrachten, bei denen die relevanten physikalischen Größen von der Größenordnung des Planckschen Wirkungsquantums sind, und dass sich auf einer größeren Skala eine andere physikalische Theorie ergibt. (Im dritten Teil hatten wir ja genau das mit Hilfe des Pfadintegrals gesehen: Bei hinreichend großen Teilchen ergibt sich gerade das Prinzip der kleinsten Wirkung.) Eine solche Theorie, die sich aus einer grundlegenden Theorie als Grenzfall ergibt, nennt man auch eine effektive Theorie. Auch unser aktuelles Standardmodell ist vermutlich so eine effektive Theorie, die sich aus einer fundamentaleren Theorie ergibt, in der die Gravitation einbezogen ist. (Einige Leute glauben ja, dass eine solche Theorie mit Strings zu tun hat.)
Dass es effektive Theorien gibt, erscheint auf den ersten Blick nicht besonders verwunderlich: Wenn man in den mathematischen Formeln, die eine fundamentale Theorie beschreiben, einige Konstanten sehr klein oder sehr groß werden lässt, dann werden einige Terme in den Formeln eben klein gegenüber anderen und können vernachlässigt werden. Dadurch ergeben sich näherungsweise andere Formeln, die eben zur effektiven Theorie gehören. Unsere klassische Physik ist also deswegen so einfach, weil wir sehr viele Effekte einfach nicht berücksichtigt haben und die entsprechende effektive Theorie deswegen einfach ist.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich zwingend so ist. Es gibt nämlich auch mindestens eine physikalische Theorie, die diese Eigenschaft nicht hat: Die Strömungsmechanik. (Achtung: Ich bin kein Strömungsmechanik-Experte – sollte ich hier also Unsinn schreiben, hinterlasst bitte einen Kommentar.)
Reale Flüssigkeiten und Gase haben eine Zähigkeit, die Viskosität. Die beruht auf der Wechselwirkung der Moleküle miteinander und sorgt für eine innere Reibung. Moleküle, die sich bewegen, zerren an benachbarten Molekülen, so dass diese ebenfalls anfangen, sich zu bewegen. Aus dem Alltag wissen wir, dass zähe Flüssigkeiten wie Honig eher langsam fließen und dass es ziemlich schwierig ist, Wirbel im Honig zu erzeugen. Honig hat eine sehr große Viskosität, so dass das Fließen von Honig von Effekten der inneren Reibung dominiert wird. Die Energie, die wir beim Umrühren von Honig aufwenden, wird sehr schnell durch Reibung in Wärme umgewandelt, so dass wir den Honig nicht dazu bekommen, schnell zu fließen. Mit Wasser gelingt das Verwirbeln schon leichter, wie ihr im Abfluss eures Waschbeckens sehen könnt – beim Abfließen bildet das Wasser einen Wirbel. In Luft lassen sich Wirbel noch leichter erzeugen – deswegen kann Gandalf ja auch so schöne Rauchringe pusten. Je kleiner also die Viskosität einer Flüssigkeit, desto leichter lässt sie sich verwirbeln. Macht man die Viskosität winzig klein, gibt es entsprechend sehr starke Turbulenz und Verwirbelungen.
Anmerkung: Etwas genauer sollte ich die Reynolds-Zahl betrachten, die angibt, wie stark die Verwirbelung einer Flüssigkeit ist. Sie ist definiert als Dichte der Flüssigkeit (oder des Gases, StrömungsmechanikerInnen sprechen meist von “Fluid”, wenn sie sich nicht festlegen wollen) multipliziert mit einer “typischen Länge” (also beispielsweise der Größe eines Tragflügels) und einer “typischen Geschwindigkeit” (beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der sich der Flügel bewegt), geteilt durch die Viskosität. Haben zwei Strömungen dieselbe Reynolds-Zahl, dann haben sie auch dieselbe Neigung zur Verwirbelung; deswegen kann man zum Beispiel im Maßstab verkleinerte Modelle eines Schiffs bauen, bei denen man dann statt Wasser ein anderes Fluid mit niedrigerer Reynoldszahl nimmt. (Auch Kryo-Windkanäle benutzen das Prinzip – bei niedrigen Temperaturen sinkt die Viskosität der Luft und ihre Dichte steigt, dafür kann man dann die “typische Länge” veringern.) Eigentlich spielt das aber für unsere Betrachtungen hier keine Rolle – wahrscheinlich wollte ich nur mal wieder den Blogeintrag länger machen…
Also: Je kleiner die Viskosität, desto stärker die Verwirbelung. Man sollte also eigentlich meinen, dass man im Grenzfall verschwindender Viskosität quasi unendlich starke Verwirbelungen bekommt. Doch wenn die Viskosität vollkommen verschwindet, dann gibt es überhaupt keine Reibung innerhalb der Flüssigkeit und es können auch keine Wirbel entstehen, weil sich bewegende Moleküle keine Energie auf ihre Nachbarn übertragen können. (Das Modell des Wassers, bei dem die Viskosität ignoriert wird, heißt in den Feynman Lectures – nach einer Idee von John von Neumann – “trockenes Wasser”.)
Eine simple Theorie, die die Viskosität ignoriert, entsteht also nicht ohne weiteres aus einer Theorie, bei der die Viskosität einfach gegen Null geht, aber auch nicht aus einer, bei der sie gegen unendlich geht (denn dann ist der Fluss jeder Flüssigkeit unendlich langsam und die Bewegung wird von Reibungskräften dominiert.) Natürlich ist das in der Strömungsmechanik überhaupt kein Problem; die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen ganz genau, wann sie die Viskosität einfach ignorieren dürfen und wann nicht.
Aber wenn wir uns vorstellen, dass sich zum Beispiel die Relativitätstheorie so verhalten würde, dann wäre die Sache ziemlich knifflig. In unserer Welt ist es so, dass relativistische Effekte verschwinden, wenn das Verhältnis der Geschwindigkeit eines Teilchens zur Lichtgeschwindigkeit sehr klein ist. Je kleiner die Geschwindigkeit, desto weniger merken wir von den Effekten der SRT, und in einem Flugzeug müssen wir schon sehr genaue Uhren verenden, um bei diesen Geschwindigkeiten einen Effekt zu sehen. Wären die Verhältnisse aber so wie bei der Viskosität, dann würden wir die einfache Newtonsche Theorie nicht einfach dadurch bekommen, dass wir sehr kleine Terme in den Gleichungen vernachlässigen – so wie wir eben nicht die Eigenschaften von “trockenem Wasser” bekommen, wenn wir eine Flüssigkeit mit sehr kleiner Viskosität beobachten.
Es ist also nicht unbedingt zwingend, dass sich im Grenzfall einer Theorie ein sauberer Übergang zu einer einfacheren Theorie ergibt.
Auch ansonsten erscheint es gar nicht so abwegig, dass eine fundamentale Theorie so komplex ist, dass sich eben keine wirklich gute effektive Theorie daraus ableiten lässt. Ein Beispiel dafür liefert wieder die Strömungsmechanik: Die Grundgleichungen der Strömungsmechanik, die Navier-Stokes-Gleichungen, sind für sich genommen gar nicht so sehr komplex, aber sie führen zu sehr komplexen Phänomenen wie eben der Turbulenz. Bisher ist es nicht wirklich gelungen, eine effektive Theorie zu finden, mit der sich Turbulenzphänomene zum Beispiel um ein Flugzeug herum gut beschreiben lassen, ohne dass man die Navier-Stokes-Gleichungen auf sehr kleiner Längenskala löst. Es gibt jede Menge Turbulenzmodelle, mit denen man in einigermaßen guter Näherung rechnen kann, aber weder sind diese Modelle besonders einfach noch gibt es eins, dass immer passt. Was wäre, wenn die fundamentalen Gesetze der Physik genauso wären? (Diese Idee ist übrigens nicht von mir, sondern von dem Mathematiker Achi Brandt, mit dem ich darüber vor ewig langer Zeit mal diskutiert habe.)
PhysikerInnen gehen meist davon aus, dass die fundamentalen Gesetze in irgendeiner Weise “einfach” sind (wobei man sich natürlich schon streiten kann, ob so etwas wie die QFT einfach im eigentlichen Sinne ist). Aber selbst wenn das stimmt, warum sollten sich dann aus so einer Theorie auch “einfache” effektive Theorien ergeben?
Auf diese Frage fallen mir im Moment vier mögliche Antworten ein.
1. Glück Es gibt keinen besonderen Grund, warum das so ist – wir haben einfach Glück gehabt, dass wir in einem Universum leben, wo die effektiven Theorien hinreichend einfach sind.
2. Das anthropische Prinzip Vielleicht ist Leben (und insbesondere intelligentes Leben) nur in einem solchen Universum möglich, in dem die effektiven Theorien einfach sind. Intelligente Lebewesen müssen ja das verhalten ihrer Umwelt einigermaßen gut vorhersagen können – in einem Universum, in dem die effektive Theorie unglaublich komplex ist, wäre dann vielleicht entweder die Entwicklung von Intelligenz gar nicht möglich (weil gezielte Vorhersagen so schwierig sind, dass es keinen evolutionären Weg gibt, unter dem sich ein Wesen entwickeln könnte, das dazu fähig ist), oder Leben selbst wäre nicht möglich, weil einfache Reiz-Reaktions-Mechanismen in einer solchen Welt nicht funktionieren könnten.
3. Evolutionäre Erkenntnistheorie Man kann das Argument des anthropischen Prinzips aber auch umdrehen: Ob etwas “einfach” ist, ist ja keine objektiv entscheidbare Frage. Vielleicht würde einem Lebewesen, das in einer turbulenten Gaswolke wohnt, unsere effektive klassische Physik mit starren Objekten und Massepunkten als unglaublich wirr oder kompliziert erscheinen. Würden wir uns ständig mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegen, fänden wir vermutlich die spezielle RT ganz anschaulich und die Newtonsche Physik seltsam und kompliziert. (“Man soll Objekte immer weiter beschleunigen können, zu beliebigen Geschwindigkeiten? Wie absurd!”) Dass uns die klassische Physik anschaulich und einleuchtend erscheint, liegt eben daran, dass wir als Kinder eine naive Physikvorstellung entwickeln, die eben genau zu dieser effektiven Theorie passt.
Die letzten beiden Antworten sind allerdings auch nicht wirklich zufriedenstellend – sie liefern zwar jeweils ein Argument dafür, warum die klassische Physik einfach sein muss; warum es aber zwischen der klassischen Physik und z.B. dem Standardmodell noch durchaus sinnvolle Zwischenstufen (wie zum Beispiel die Quantenmechanik) gibt, die einfacher sind und die man verstehen kann, ohne die zu Grunde liegende Theorie zu kennen, ist nicht klar.
Wenn man etwas wissenschaftskritisch ist, dann mag einem noch eine vierte Antwort einfallen:
4. Unsere Theorien haben mit der Realität wenig zu tun. Das ist ein etwas postmoderner Gedanke: Physikalische Theorien sind menschliche Konstrukte, und die bauen wir so, wie es uns passt und stülpen sie dann der Welt quasi über. Wir passen zwar die Details unserer Theorien an die Messergebnisse an, aber die grundlegenden Konzepte, die wir verwenden, stammen von uns selbst und haben mit der Realität nichts zu tun. Für sehr plausibel halte ich diese Idee allerdings nicht, dafür ist die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment schon erstaunlich gut. Es wäre schon seltsam, wenn man z.B. die makroskopische klassische Physik mit einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Konzepten beschreiben könnte. Man kann sich natürlich wieder Wesen aus Gas oder so vorstellen, deren klassische Physik keine Punktteilchen als fundamentale Objekte verwendet, sondern Strömungen oder Felder; aber auch wenn deren Formeln und Konzepte dann etwas anders aussehen würden, würden sie letztlich wohl doch zumindest mathematisch äquivalente Gleichungen verwenden müssen, um Strömungen oder Planetenbewegungen zu beschreiben. Und es ist schwer vorstellbar, dass man die klassische Physik sinnvoll ohne Konzepte wie “Energie” oder “Impuls” beschreiben kann; dazu sind die einfach zu tief in der Physik verankert.
Natürlich sind auch kombinierte Begründungen denkbar: Beliebig kompliziert können die effektiven Theorien nicht sein, weil es dann kein intelligentes Leben gibt, die moderat komplizierten effektiven Theorien führen dann zu einer Form von Intelligenz, der solche Theorien einfach erscheinen, und wie genau die Theorie dann ausgestaltet wird, unterliegt einer gewissen Willkür. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, an die ich nicht gedacht habe?
Auf jeden Fall zeigt sich: Dass wir in dieser Serie eine schöne Hierarchie von Modellen für den Weg von A nach B verfolgen konnten, bei der auf jeder Stufe immer brav eine Komplikation hinzukam und sich jedes Mal ein einigermaßen schlüssiges Bild ergab, ist gar nicht so selbstverständlich, wie man vielleicht denkt. Warum die Natur es uns ermöglicht, sie mit einer solchen Hierarchie zu beschreiben, bleibt erst einmal ein Geheimnis.
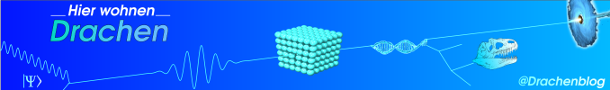

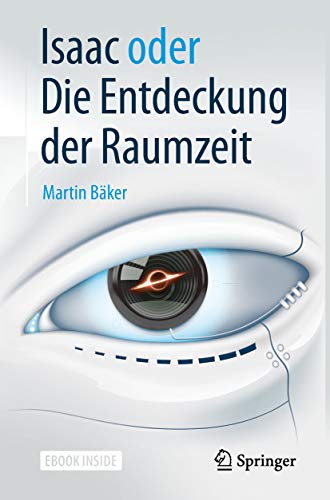



Kommentare (23)