Beeinflusst unsere Sprache unser Denken und wie stark ist dieser Einfluss? Diese Frage treibt die LinguistInnen seit langem um. Auch hier auf dem Blog haben wir gelegentlich – im Zusammenhang mit der geschlechtergerechten Sprache – über dieses Problem diskutiert. Heute will ich einen kleinen Blick auf eine ganz spezifische Frage werfen: Beeinflusst das grammatische Geschlecht unser Denken?
Um es gleich vorweg zu sagen: Es gibt keine klare und eindeutige Antwort auf die Frage, ob und wie das grammatische Geschlecht unser Denken beeinflusst. Unterschiedliche Experimente ergeben leicht verschiedene Antworten, die sich auch nicht unbedingt alle ohne weiteres unter einen Hut bringen lassen.
Warnung: Ich bin kein Linguist. Ich habe zwar in den letzten Wochen einen Haufen paper gelesen und mir unterschiedliche Experimente durchgelesen, aber ich übernehme keine Garantie dafür, dass ich nicht irgendwo etwas falsch verstanden habe oder ein Ergebnis falsch interpretiere – mein Linguistik-Abschluss ist sozusagen ein Bachelor der Google University, aber auch nicht mehr. Falls ihr vom Fach seid und mehr Ahnung habt als ich, dürft ihr euch gern in den Kommentaren beschweren und mir zeigen, wo ich Mist gebaut habe.
Wir müssen im folgenden zwei Arten von “Geschlecht” unterscheiden, das grammatische Geschlecht (das werde ich im folgenden mit GG (nein, steht nicht für Grundgesetz) abkürzen, weil es dauernd vorkommt), nach dem also “der Löffel” männlich und “die Gabel” weiblich ist, und das semantische Geschlecht (kurz SG – hat hier aber nix mit Wurmlöchern zu tun…) – Männer sind männlich, Frauen sind weiblich. Wörter können entweder nur ein GG haben, aber kein SG (wie zum Beispiel “der Löffel”, der ja eigentlich nicht so der Macho-Typ ist) oder sie können beides haben, wobei dann GG und SG meist übereinstimmen, allerdings nicht immer (beispielsweise sagen wir “das Mädchen”, SG weiblich, GG sächlich – interessanter Weise habe ich bisher keine Studie finden können, die solche Wörter systematisch mit solchen vergleicht, bei denen GG und SG übereinstimmen, vielleicht, weil es Wörter wie “das Mädchen” nicht so sehr viele gibt.). Manche Wörter bezeichnen auch Begriffe, die zwar prinzipiell ein SG haben, das aber unbestimmt ist – beispielsweise “die Person”, “das Mitglied”. (Das führt jetzt schon wieder ein wenig in Richtung des berühmten generischen Maskulinums – das ist hier aber nicht unser Hauptthema, auch wenn ich im 2. Teil bei einem Experiment noch etwas dazu sagen werde. VerfechterInnen des generischen Maskulinums führen aber ja gern Wörter wie “der Löffel/die Gabel” als Beleg dafür an, dass das GG offensichtlich keinen Einfluss auf unser Denken hat.)
Das grammatische Geschlecht könnte unser Denken und unsere Verwendung von Wörtern auf verschiedene Weise beeinflussen, beispielsweise auf der sozusagen unteren Ebene der Wort-Verarbeitung oder aber auf der Bedeutungs-Ebene. Beispielsweise könnten wir mit Wörtern, die ein feminines GG haben, auch eher “weibliche” Begriffe assoziieren.
Schauen wir erst einmal auf die “unterste” Ebene, die des Wortverständnisses und der Wortverarbeitung. Ich stelle hier jeweils verschiedene Experimente vor, die genauen Referenzen findet ihr am Ende des Artikels.
Beeinflusst das Geschlecht die Wort-Verarbeitung?
Cubelli et al. 2011
In dieser Arbeit wurde untersucht, ob die Zuordnung von Objekten durch das GG beeinflusst wird. Es wurden 16 Bilder aus 8 Begriffskategorien (wie Säugetier, Vogel, Gebäude usw.) gewählt und Versuchspersonen sollten jeweils sagen, ob die Bilder zur selben Kategorie gehören oder nicht. (Mir wurde dabei nicht ganz klar, ob die Versuchspersonen die Kategorien vorher gesagt bekamen oder nicht – wenn nicht, dann ist es natürlich nicht so einfach, wenn z.B. ein Säugetier und ein Vogel gezeigt wurden, da beide zur Kategorie “Tiere” gehören. Für das Endergebnis spielt das aber keine große Rolle, da ohnehin nur korrekte Zuordnungen ausgewertet wurden. Wie genau die Bilder ausgewählt wurden, ist in der Arbeit auch beschrieben, aber solche methodischen Aspekte sind mir hier nicht so wichtig, gehen wir einfach mal davon aus, dass die LinguistInnen wissen, was sie tun…)
Der Versuch wurde sowohl mit englisch- als auch mit italienisch-sprachigen Personen gemacht. Da das Englische kein GG für Substantive hat, können die Ergebnisse dieser Gruppe sozusagen als Referenz dienen. Die Bilder wurden so gewählt, dass bei einigen Paarungen das GG im Italienischen übereinstimmte, bei anderen nicht. Dann wurde jeweils die Reaktionszeit gemessen, die benötigt wurde, um die Zuordnung zu machen. (Dabei ist zu sagen, dass die Standardabweichungen bei Reaktionszeiten natürlich sehr hoch sind, entsprechend muss man sauber statistisch auswerten, um zu sehen, ob es Effekte gibt.)
Im Englischen zeigt sich (erwartungsgemäß), dass die Reaktionszeit kürzer ist, wenn die beiden Objekte zur selben Kategorie gehören. (Ich erkläre mir das mal ganz naiv so, dass man im Geiste unterschiedliche Kategorien durchprobiert und wenn man eine übereinstimmende gefunden hat, ist man fertig.) Im Italienischen war dieser Effekt auch vorhanden, zusätzlich war die Zuordnung aber immer schneller, wenn die beiden Objekte in ihrem GG übereinstimmten (egal ob sie nun zur selben Kategorie gehörten oder nicht).
Das Experiment wurde dann mit einem Vergleich von italienisch- und spanisch-sprechenden Personen wiederholt, wobei die Bilder so gewählt wurden, dass dieselben Bilder in der einen Sprache dasselbe GG hatten, in der anderen nicht. Auch hier ergab sich dasselbe Ergebnis – ein übereinstimmendes GG führt immer zu einer schnelleren Verarbeitung.
Im dritten Experiment wurde dann getestet, ob der Effekt tatsächlich auf Sprachverarbeitung im Kopf beruht. Dazu wurde das Sprachzentrum der Versuchspersonen anderweitig beschäftigt – sie mussten während des Testes die ganze zeit “bla bla bla” sagen. (Man bezeichnet das als “Shadowing” – in einem anderen Zusammenhang wird das ausführlich in Feynman’s Autobiographie “Surely you are joking…” diskutiert, die ihr hoffentlich alle gelesen habt.) Tatsächlich verschwand der Effekt in diesem Fall, die Reaktionszeiten wurden also vom GG nicht beeinflusst, wenn das Sprachzentrum anderweitig beschäftigt war.
Was kann man daraus schließen? Die Einordnung von Objekten geschieht mit Hilfe des Sprachzentrums – sonst könnte das GG keinen Einfluss haben. Allerdings führt eine Übereinstimmung des GG immer zu einer schnelleren Verarbeitung – die AutorInnen schließen daraus, dass das GG nicht semantisch interpretiert wird, sonst müsste es länger dauern, Wörter mit übereinstimmendem GG und verschiedenen Kategorien einzuordnen. Der Einfluss des grammatischen Geschlechts ist nach den AutorInnen demnach in diesem Experiment nur indirekt, aber kein Bestandteil der Konzeptualisierung. Stimmen Wörter im grammatischen Geschlecht überein, können sie schneller verarbeitet werden, aber das grammatische Geschlecht ist kein Bestandteil der Semantik.
Auf jeden Fall zeigt das Experiment, dass das GG als eine Art “primer” wirken kann – ein Wort mit einem bestimmten GG macht es leichter, ein anderes Wort mit demselben GG zu verarbeiten. Solche “priming”-Effekte sind inzwischen ziemlich gut untersucht und es ist bekannt, dass schon kleine Reize das Denken in eine bestimmte Richtung lenken können. Wer mehr wissen will, wie “priming” unser Denken beeinflusst, kann in das Buch “Thinking, Fast and Slow” von Daniel Kahnemann schauen. Habt ihr beispielsweise kürzlich das Wort “Tier” gelesen, dann werdet ihr ein Wort-Ergänzungsrätsel, bei dem ihr den fehlenden Buchstaben in _aus suchen müsst, mit höherer Wahrscheinlichkeit mit “Maus” lösen; habt ihr dagegen gerade das Wort “Burg” gelesen, dann werdet ihr eher an “Haus” denken. (Ich habe mir dieses Beispiel zugegebenermaßen gerade ausgedacht – im englischen Original geht es um “soup” oder “soap” mit den primern “eat” und “wash”.)
Boutonnet et al., 2012
Hier wurde ein ähnlicher Versuch gemacht – allerdings gab es immer drei Bilder zu sehen, von denen das dritte mit den ersten beiden entweder im GG übereinstimmte oder nicht. Zusätzlich zu den Reaktionszeiten wurden auch noch elektrische Potentiale im Gehirn vermessen. Die Versuche wurden auch wieder auf Englisch durchgeführt, zum einen mit nur englischsprachigen, zum anderen mit englisch- und spanischsprachigen Versuchspersonen (hey, hier wimmelt es schon von Abkürzungen – ab jetzt schreibe ich VP, dieser Text ist eh schon lang…). Anders als Cubelli et al. fand diese Untersuchung keinen messbaren Unterschied in der Reaktionszeit (und also auch keinen priming-Effekt durch das GG). Es machte auch keinen Unterschied,ob die Wörter zur selben Kategorie gehörten oder nicht – im klaren Widerspruch zu Cubelli et al. Die bilingualen Testpersonen brauchten allerdings immer etwas länger als die englischen Muttersprachler, um die Wörter zu verarbeiten, aber das ist wohl verständlich, weil sie eben nicht in ihrer Muttersprache gearbeitet haben. (Es wurden zwar Bilder gezeigt, aber die Erklärungen, was die VPs tun sollen, wurden auf Englisch gegeben.)
Allerdings zeigte sich ein messbarer Unterschied in den Gehirnströmen – in Fällen, w das GG übereinstimmte, sahen sie bei den bilingualen VPs anders aus als in denen, wo es nicht übereinstimmte. Das impliziert, dass das GG einen Einfluss auf die Verarbeitung von Begriffen hat, auch wenn der Effekt in diesem Fall sich nicht als Unterschied in der Reaktionszeit äußerte. (Die Autoren spekulieren kurz darüber, warum sie anders als Cubeli et al. keinen solchen Effekt gefunden haben.) Ich muss allerdings zugeben, dass mir nicht ganz klar ist, wie aussagekräftig solche Hirnpotentiale tatsächlich sind.
Bender et al, 2011
In dieser Arbeit wurde untersucht, ob das GG bei Gegenständen mit einem SG assoziiert wird, und zwar auf der eher fundamentalen lexikalischen Ebene. (Als Nicht-Linguist habe ich mich beim Lesen dieser Arbeit sehr schwer getan, an dieser Stelle ein herzlicher Dank an Andrea Bender, die mir so lange per mail Linguistik-Nachhilfe gegeben hat, bis ich (hoffentlich) verstanden habe, was genau in dem paper versucht wurde.)
Es geht hier wieder um die Wort-Verarbeitung. Dazu haben die WissenschaftlerInnen sich folgendes ausgedacht: Sie haben Wörter mit sehr ähnlicher Bedeutung gesucht, beispielsweise Kiste und Kasten. Dann haben sie aus den Buchstaben dieser Wörter neue gebaut – aus “Kiste” wurde “Stike”, aus “Kasten” Staken”. Die neu gebauten Wörter wurden dabei so gebildet, dass sie von Testpersonen (nicht denselben, die nachher die eigentlichen Experimente gemacht haben) ziemlich eindeutig als GG männlich bzw. GG weiblich eingestuft wurden – vermutlich stimmt ihr alle zu, dass der “der Staken” aber “die Stike” heißen muss, selbst wenn es die Wörter gar nicht gibt.
Jetzt hat man also jeweils 4 zusammenhängende Wörter, von denen zwei eine Bedeutung haben und zwei nicht, jeweils mit unterschiedlichem GG.
Versuchspersonen sollten jetzt jeweils entscheiden, welches der vier Wörter ein tatsächlich korrektes Wort ist und welches nicht. Allerdings bekamen sie die Wörter nicht einfach so gezeigt, sondern mit einem “primer”, also einem weiteren Reiz, der das Denken in die eine oder andere Richtung lenken sollte. (Dass das prinzipiell funktioniert, haben wir ja eben bei der Arbeit von Cubelli et al. gesehen – die wird allerdings hier nicht zitiert, vermutlich da beide Arbeiten etwa gleichzeitig erschienen sind.)
Nehmen wir an, dass das GG in unserem Denken auch mit einem SG assoziiert wäre. Dann müsste die Nennung eines männlichen primers uns die nachfolgende Verarbeitung der Wörter “Kasten” und “Staken” erleichtern, die der Wörter “Kiste” und “Stike” aber nicht. Hierzu wurden jetzt mehrere Versuche gemacht.
Der erste Versuch ist ziemlich trickreich: Als “primer” wurden die Wörter “sein”, “seine”, “ihr” und “ihre” verwendet. Die Versuchspersonen sahen auf einem Monitor z.B. die Wörter “ihr Stike” und sollten jeweils entscheiden, ob das zweite Wort ein echtes Wort ist oder nicht. Die Unterscheidung “sein”/”ihr” dient dabei als semantischer primer, soll also eine Assoziation mit einem Geschlecht hervorrufen. Wenn das so wäre, dann müssten die Versuchspersonen besser abschneiden, wenn sie “ihr Stike” lesen als wenn sie “sein Stike” lesen, weil “Stike” GG feminin ist und der semantische primer sie ein männliches GG erwarten lässt.
Zusätzlich müsste man auf jeden Fall erwarten (ansonsten gäbe es hier nicht mal grammatische priming-Effekte), dass die Verarbeitung leichter ist, wenn das durch das Pronomen geforderte GG auch tatsächlich folgt – es sollte also leichter sein, “seine Stike” korrekt einzuordnen als “sein Stike”, weil bei der zweiten Kombination eine Diskrepanz zwischen dem geforderten und dem tatsächlich nachfolgenden GG vorliegt.
Wertet man die Reaktionszeiten aus, so zeigt sich, dass es einen Effekt des GG bei der Reaktionszeit für die Nicht-Wörter gibt, aber nicht bei der Reaktionszeit für die Wörter. Einen priming-Effekt durch das SG gab es nicht. Betrachtet man stattdessen, ob die Antwort Wort/Nicht-Wort korrekt war, dann ergibt sich ein Effekt des GG bei den Wörtern – mit anderen Worten, Kombinationen wie “die Kasten” sind schwerer zu verstehen, während “die Staken” kein Problem darstellt.
Insgesamt gibt es also einen schwachen priming-Effekt durch das GG, aber keinen durch das SG.
Das Experiment ist allerdings in sofern problematisch, als die priming-Effekte durch die Verwendung der Wörter “ihr”/”sein” hervorgerufen werden sollen. Es wurde nicht getestet, ob diese Wörter wirklich deutlich als semantische primer für das Geschlecht wirken können. Immerhin lautet auch das neutrale Possessivpronomen “sein”, und da ja auch Wörter ohne SG ein GG haben, kann beispielsweise “seine Kiste” sich ja auch auf einen Lastwagen beziehen, der eine Kiste hat (an dem aber ja nichts besonders männlich ist). Außerdem sind wir es aus dem Alltag ja gewohnt, dass wir Kombinationen wie “seine Gabel” oder “ihr Löffel” lesen – insofern bin ich mir nicht so sicher, ob es hier wirklich einen starken priming-Effekt geben sollte. Diese Probleme werden in der Arbeit auch angesprochen, aber es ist natürlich nicht so einfach, sie in den Griff zu bekommen.
Deshalb gab es noch weitere Experimente: Hier dienten als semantische primer (die also die Idee eines bestimmten Geschlechts hervorrufen sollten) die Wörter “der/die”, “Mann/Frau” sowie Piktogramme mit dem männlich/weiblich-Symbol (damit hatten allerdings viele Versuchspersonen Schwierigkeiten) sowie Piktogramme, wie man sie z.B. an Toiletten finden kann. Als Versuchswörter wurden jetzt keine Nicht-Wörter mehr verwendet sondern entweder Objekte oder Wörter, die tatsächlich auch ein SG haben (Wie “Onkel” oder “Tante”). Die VPs sollten explizit das Geschlecht des jeweiligen Wortes bestimmen (die Wörter, die sowohl ein GG als auch ein SG haben, wurden so gewählt, dass diese beiden immer übereinstimmen, Wörter wie “Mädchen” waren also ausgeschlossen). Ich finde es ja ein wenig schade, dass man nicht genau dasselbe Experiment wie vorher gemacht hat – also ein männliches/weibliches Piktogramm mit dem Wort “Staken”/”Stike” gezeigt und gemessen, ob es einen SG-priming-Effekt gibt. Dadurch dass hier zwei Variablen verändert wurden, lassen sich die Ergebnisse schwerer interpretieren. (Vermutlich alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, kennen mein Mantra: “Ändere nie zwei Variablen gleichzeitig!”…)
Generell zeigte sich (wenn ich alles richtig verstehe), dass in allen Fällen “der/die” den stärksten priming-Effekt hatte. Bei den Wörtern, die ein SG haben, gab es auch durch Begriffe wie “Mann/Frau” einen starken priming-Effekt, bei den Objekten ohne SG dagegen nicht. Problematisch erscheint mir bei der Auswertung, dass drei Gruppen von Experimenten durchgeführt wurden – es wurde jeweils der priming-Effekt von “der/die” verglichen mit “Mann/Frau” bzw. den Symbolen. Eigentlich müsste man vielleicht erwarten, dass die Ergebnisse für die primer “der/die” in allen drei Experimenten etwa identisch sein sollten, aber das war nicht der Fall – in dem Experiment mit den männlich/weiblich-Symbolen (die ja besonders schlechte primer waren), war der priming-Effekt der Artikel besonders stark.
Insgesamt kommen die AutorInnen des Artikels zu folgendem Schluss: “performance in lexical tasks on objects is not sensitive to priming biological gender” [Die Leistung bei lexikalischen Aufgaben wird nicht durch primer für das biologische Geschlecht beeinflusst.] Das GG dagegen hat offensichtlich einen starken priming-Effekt.
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis. Man muss aber beachten, dass dieses Ergebnis nicht den Umkehrschluss zulässt: Bei Worterkennungs-Aufgaben dient das SG nicht als primer; das bedeutet aber nicht, dass nicht umgekehrt ein Wort mit einem bestimmten GG nicht auch mit einem SG assoziiert wird. (Man sollte vielleicht mal das umgekehrte Experiment machen und testen, ob Wörter mit einem GG als primer für Wörter mit einem SG dienen können, soweit ich weiß, hat das so herum niemand gemacht.)
Boroditsky et al. 2003
Von Lera Boroditsky gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die in einem Übersichtsartikel zusammengefasst werden. Die erste, die ich kurz angucken möchte, ist eine Wortgedächtnis-Aufgabe. Dabei bekamen VPs Objekte, die mit einem Namen belegt waren, also z.B. ein Apfel, der “Patrick” oder “Patricia” heißen konnte. Das Experiment wurde mit deutschen und spanischen MuttersparchlerInnen gemacht, und zwar so, dass die Objekte in beiden Sprachen entgegengesetztes GG hatten. Das Experiment selbst wurde aber auf Englisch durchgeführt – alle VPs sprachen fließendes Englisch. Es zeigte sich, dass das Lernen leichter war, wenn GG des Objekts und SG des Namens übereinstimmten – zunächst wenig überraschend, wenn man sich vorstellt, dass man sich zum Lernen beispielsweise Kombinationen wie “Patrick, der Apfel” besser merken kann als “Patricia, der Apfel”. Da das Experiment aber auf Englisch durchgeführt wurde, sollten sich die VPs eigentlich ja die Kombination “Patricia, the apple” gemerkt haben (wer fließend Englisch spricht, der denkt ja auch in dieser Sprache) – trotzdem gab es einen Effekt. Das ist zumindest ein Indiz dafür, dass das GG der Muttersprache auch das geistige Bild eines Objekts irgendwie beeinflusst.
Fazit der Versuche
Was können wir aus den Versuchen schließen? Es gibt einen priming-Effekt durch das GG – Wörter wie “der” lassen uns (wenig überraschend) erwarten, dass ein Wort mit passendem GG folgt. (Wobei man auch hier berücksichtigen muss, dass “der” ja auch ein femininer Artikel im Genitiv und Dativ sein kann, und “die” der Universal-Artikel im Plural ist – soweit ich sehen kann, wurde das in den Arbeiten nicht diskutiert (es sei denn, ich habe es überlesen).) Die Experimente von Cubelli et al. zeigen, dass das GG mit einem Begriff eng genug verknüpft ist, dass es als “primer” für andere Wörter mit übereinstimmendem GG wirken kann – allerdings stimmen Boutonnet et al. mit dem Ergebnis nicht ganz überein. Aus dem Experiment von Bender et al. lernen wir, dass das SG anscheinend nicht als primer für Wörter dient, die kein SG haben. Daraus kann man möglicherweise schließen, dass auf dieser Verarbeitungsebene das GG nicht direkt als SG interpretiert wird; so ganz klar bin ich mir aber nicht, ob das eine zulässige Schlussfolgerung ist, denn bei solchen einfachen “Wortabruf-Aufgaben” ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass ein schwacher semantischer primer nicht wirkt.
Einen schlagenden Beweis dafür, dass das GG einen starken Einfluss auf unsere Wortverarbeitung hat, geben diese Experimente aber eher nicht – die Effekte sind vermutlich klein. Aber bisher ging es ja auch nur um die simple Wort-Verarbeitung – ändert sich das Bild, wenn man den VPs inhaltliche Fragen stellt und versucht, an das echte Wortverständnis heranzukommen? Das schauen wir uns dann – wen wundert’s noch auf diesem Blog? – im zweiten Teil an.
Andrea Bender , Sieghard Beller & Karl Christoph Klauer
Grammatical gender in German: A case for linguistic relativity?
The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 64:9, 1821-1835
Boroditsky, Lera, Lauren A. Schmidt, and Webb Phillips.
Sex, syntax, and semantics.
Language in mind: Advances in the study of language and thought (2003): 61-79.
Bastien Boutonnet, Panos Athanasopoulos, Guillaume Thierry
Unconscious effects of grammatical gender during object categorisation
brain research 1479 (2012) 72–79
Roberto Cubelli, Daniela Paolieri, Lorella Lotto
The Effect of Grammatical Gender on Object Categorization
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 2011, Vol. 37, No. 2, 449 – 460
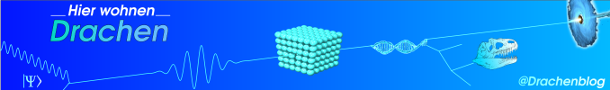

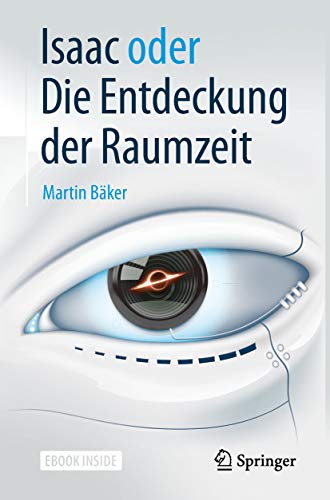



Kommentare (40)