Bei den Zentauren
Am Wochenende stand Miranda gleich nach Sonnenuntergang auf, um sich reisefertig zu machen. Wyveria lag vor dem Ofen und wärmte sich, denn es war immer noch kalt. Während Miranda überlegte, was sie alles mitnehmen wollte, und ihren Rucksack einpackte, strich ihre Katze Neferti um ihre Beine herum.
„Arme Neferti“, sagte Miranda und nahm sie auf den Arm. „Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit für dich wie früher, nicht wahr?“ Neferti schnurrte, während Miranda sie streichelte. Doch als Miranda sie wieder absetzte, wuselte Neferti immer noch um sie herum.
„Weißt du was, Neferti“, sagte Miranda schließlich, „diesmal nehme ich dich mit. Wyveria muss ja schließlich hierbleiben, aber dir macht die Kälte nicht so viel aus.“
Kurze Zeit später klopfte es an der Tür. Miranda hatte Netti gebeten, sich um Wyveria zu kümmern, während Miranda nicht da war.
„Hallo Miranda. Reisefertig?“, begrüßte Netti sie.
„Ich glaube schon“, sagte Miranda, „ich brauche nur noch etwas Katzenfutter, denn diesmal nehme ich Neferti mit.“ Nachdem sie auch das Futter eingepackt hatte, verabschiedete Miranda sich und machte sich auf den Weg.
Neferti saß hinter ihr im Korb und schaute neugierig in die Welt hinaus. Miranda hatte sie beide warm gezaubert, Neferti in eine Decke gehüllt und sich selbst ihre wärmsten Sachen angezogen, so dass sie beide nicht froren. So sausten sie über die nächtliche Schneelandschaft dahin, in Richtung Südosten.
Sie flogen über Wälder, Felder, Wiesen und Flüsse, eine ganze Weile lang. Schließlich sahen sie vor sich das große Gebirge, an dem sie entlangfliegen mussten. Als Miranda sich umdrehte, sah sie, dass Neferti ihre Decke zur Seite gestrampelt hatte. „Du hast Recht. Es ist wirklich wärmer geworden“, bemerkte Miranda und knöpfte ihren dicken Wintermantel auf.
Nachdem sie noch eine Weile weitergeflogen waren, wurde es schließlich so warm, dass Miranda landen musste, um ihre warmen Sachen auszuziehen. „Ich glaube, bald sind wir in Griechenland“, sagte Miranda und schaute auf die Karte, die sie mitgenommen hatte.
Sie vertrat sich einen Moment die Beine, trank einen Schluck, und flog dann weiter in die Nacht hinaus.
Schließlich erreichten sie Griechenland. Unter ihnen lagen Wälder, aber auch viele karge Felsen und Hügel, die nur mit einigen Büschen und Gestrüpp bewachsen waren. Dann, endlich, näherten sie sich dem Gebirge, in dem die Zentauren wohnen sollten.
Steile und schroffe Klippen und Berghänge wechselten sich ab mit Wiesen und dunklen Wäldern. Miranda schaute aufmerksam zu Boden, doch zunächst konnte sie keine Spur der Zentauren entdecken. Dann sah sie, noch ziemlich weit entfernt, eine Bewegung in der Luft. Etwas Dunkles waberte dort herum – Rauch! ‘Wo Rauch ist, ist Feuer, und wo Feuer ist, da wohnt vermutlich jemand,’ dachte Miranda und flog auf den Rauch zu. Es dauerte nicht lange, und sie sah unter sich eine flache Ebene mit einem Dorf aus großen, länglichen Hütten aus Holz. Das erste, das ihr auffiel, war, dass die Häuser sehr große und vor allem breite Eingangstüren hatten. Dann bemerkte sie etwas anderes: Viele der Türen standen offen, doch trotzdem war im ganzen Dorf niemand zu sehen, so als wären alle Dorfbewohner fortgegangen. ‘Lange können sie aber noch nicht weg sein,’ überlegte Miranda, ‘denn dann hätten sie kein Feuer im Kamin angelassen.’ Miranda drehte noch eine Runde über dem Dorf, aber nachdem sie auch dabei niemanden sehen konnte, flog sie weiter in die Höhe und hielt Ausschau.
Die Ebene, auf der das Dorf stand, war nicht sehr groß und ein kleines Stückchen weiter sah Miranda einen schmalen Pfad, der sich am Berg entlangschlängelte. Vielleicht waren alle Dorfbewohner in diese Richtung gegangen? Sie flog den Pfad entlang, und tatsächlich musste sie nur ein kleines Stück weiter fliegen, als sie Stimmen hörte. Sie riefen aufgeregt und hektisch, und zwischen den tiefen Stimmen der Erwachsenen konnte sie das ängstliche Rufen eines Kindes hören.
Die Zentauren standen auf dem schmalen Weg und schauten nach unten, so dass sie Miranda nicht bemerkten. Sie sahen genau so aus, wie das Buch sie beschrieben hatte: Ihre Körper waren die von großen Pferden, aber anstelle von Hals und Kopf hatten sie menschliche Oberkörper. Die Zentaurenmänner trugen dunkle Lederwesten, die Zentaurenfrauen dagegen Umhänge aus leuchtend buntem Stoff. Doch Miranda nahm sich nicht viel Zeit, um sie anzusehen, denn sie hörte nun ganz deutlich eine Kinderstimme, die laut um Hilfe rief.
Unter dem Weg lag ein großes Geröllfeld aus lauter großen Steinen und Kieseln, und ein ganzes Stück unterhalb des Weges inmitten des Gerölls stand ein junges Zentaurenfohlen. Es war anscheinend den Hang hinabgerutscht und gestürzt und hatte sich dann beim Aufstehen seinen rechten Vorderhuf zwischen einigen großen Steinen eingeklemmt, so dass es sich nicht mehr bewegen konnte.
Die Zentauren oben am Weg riefen im Mut zu und überlegten, wie sie ihm helfen konnten, aber mit ihren schmalen Hufen konnten sie nicht über das Geröll laufen, denn sie hätten sich die Beine gebrochen. Ein Zentaur schlug vor, das Kind mit einem Seil hochzuziehen, aber dazu hätten sie erst einmal das Bein des Kindes zwischen den Steinen herausziehen müssen.
Miranda zögerte nicht lange. Sie rief den Zentauren zu „Ich helfe Euch“, und flog den Abhang hinunter, bis sie direkt über dem Kind war. „Bleib ganz ruhig, ich helfe dir“, sagte sie und überlegte, was sie tun sollte. Vorsichtig flog sie tiefer und versuchte zu landen, doch als sie ein Bein auf den Boden setzte, kamen die Steine unter ihr ins Rollen. Also blieb sie auf dem Besen sitzen und flog ein Stück in die Höhe. Das Zentaurenkind war so groß wie ein Pony – Miranda war sicherlich nicht stark genug, um es auf den Besen zu heben und mit ihm nach oben zu fliegen. Dann aber hatte sie eine Idee.
Sie flog nach oben zu den anderen Zentauren und rief „Gebt mir ein Seil.“ Einer der Zentauren, die ihr gespannt zugesehen hatten, wie sie über den Hang geflogen war, reichte ihr ein Seil. „Ich weiß nicht, wer du bist“, sagte er, „aber wenn du mir hilfst, mein Kind zu retten, werde ich dir jeden Wunsch erfüllen.“
„Klar helfe ich Euch“, sagte Miranda und versuchte, zuversichtlich zu klingen, um dem Zentaurenvater Mut zu machen. Sie nahm ein Ende des Seils, drehte sich in ihrem Besen nach hinten und knotete es um Neferti’ Bauch. Dann flog sie den Abhang hinunter, bis sie wieder neben dem Zentaurenkind in der Luft schwebte. „Halte ganz still“, sagte sie, „gleich versuche ich dich herauszuziehen.“ Sie hob Neferti aus dem Besen und setzte sie auf dem Boden ab, direkt neben dem Zentaurenkind.
„Still, Neferti“, sagte sie und ihre Katze blieb ganz ruhig auf dem Boden sitzen. Da sie leicht war, blieben die Steine unter ihren Tatzen ruhig liegen. Miranda hielt das andere Ende des Seils fest und flog über den Rücken des Zentaurenkindes auf seine andere Seite. „Komm Neferti“, rief sie dann. Neferti lief um das Zentaurenkind herum und wollte zum Besen hochspringen. „Nein, nicht so“, sagte Miranda. „Du musst unter seinem Bauch durchlaufen.“ Miranda flog wieder auf die andere Seite und rief ihre Katze noch einmal. Diesmal rannte Neferti vor dem Zentaurenkind herum.
Beim dritten Mal klappte es schließlich. Neferti lief unter dem Bauch des Zentaurenkindes hindurch und durfte dann zurück in den Korb springen. Auf diese Weise hatte Miranda das Seil um den Bauch des Zentaurenkindes geschlungen und konnte es nun verknoten.
„Vorsichtig, ich ziehe dich jetzt ein wenig nach oben“, rief sie dem Zentaurenkind zu und flog dann in die Höhe. Das Seil straffte sich, bis es ganz gespannt war. „Autsch!“, schrie das Zentaurenkind, denn der Ruck hatte natürlich an seinem eingeklemmten Fuß weh getan.
„Du musst ganz tapfer sein“, sagte Miranda, „es tut gleich noch einmal weh, aber dann bist du frei.“ Sie flog wieder in die Höhe, es ruckte einmal heftig, das Zentaurenkind schrie auf, aber Miranda sah, dass sie Erfolg gehabt hatte: Der Vorderhuf war nun wieder frei.
Miranda zog das Zentaurenkind immer noch ein wenig nach oben, damit nicht sein ganzes Gewicht auf dem Geröllboden lag. „Du bist zu schwer, ich kann dich nicht ganz hochheben“, sagte sie. „Versuch vorsichtig nach oben zu laufen, ich helfe dir.“
Behutsam setzte das Zentaurenkind einen Huf vor den anderen, während Miranda über seinem Rücken flog und es ein wenig in die Höhe hob. Schritt für Schritt ging es den Berghang hinauf. Einmal geriet der Boden unter ihm noch in Bewegung, doch bevor es ausrutschen konnte, ruckte Miranda das Seil noch etwas nach oben, so dass es wieder Fuß fassen konnte. So gelangten sie schließlich zum Bergpfad.
Der Vater des Zentaurenkindes schloss es überglücklich in seine Arme. „Hyppolyta, ist dir auch nichts passiert?“ „Nein, mir geht es gut. Nur mein Huf tut weh“, antwortete Hyppolyta, und tatsächlich war ihr Huf aufgekratzt und blutete. „Das wird bald wieder“, tröstete Hyppolytas Vater sie. Dann drehte er sich zu Miranda um, die inzwischen gelandet war: „Ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen und werde immer in deiner Schuld stehen. Wenn du einen Wunsch hast, brauchst du ihn nur auszusprechen.“
„Ich habe euch gern geholfen“, sagte Miranda. Natürlich hätte sie den Zentauren auch geholfen, wenn sie nichts von ihnen gewollt hätte. Doch nun würde es sicherlich ein Leichtes sein, die Zentauren um etwas von ihrem Wein zu bitten, dachte sie, während die Zentauren sich auf den Weg in ihr Dorf machten.
„Wir feiern ein Fest, und du bist unser Ehrengast“, sagte ein älterer Zentaur mit einem kurzen grauen Bart.
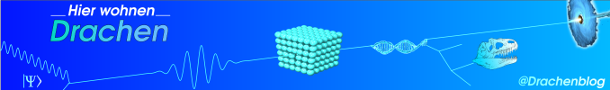

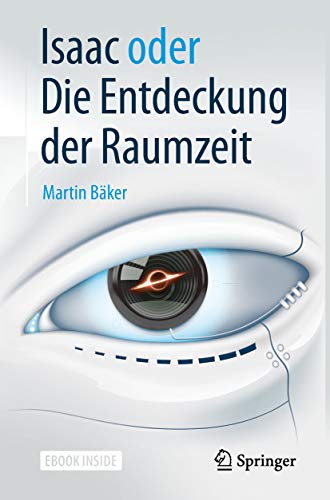



Kommentare (6)