Zum Glück haben sich die Länder der Welt bei der Internationale Meridian-Konferenz im Jahr 1884 in Washington darauf geeinigt, in Zukunft nur noch den Meridian von Greenwich als Bezusgpunkt zu verwenden. Naja, alle Länder bis auf Frankreich – die waren verärgert weil niemand für ihren Pariser Meridian gestimmt hat und haben sich der Stimme enthalten. Seit damals kann man jeden Punkt auf der Erde eindeutige Koordinaten zuweisen. Man weiß genau, wie weit südlich sich die Sternwarte Greenwich vom Nordpol befindet (das kann man herausfinden, wenn man die Bahnen der Sterne am Himmel verfolgt). Und dann muss man sich nur Stück für Stück weiter durch die Welt arbeiten. Wenn ich weiß, wo Greenwich ist und wenn ich weiß, wie weit ich in nördlich/südlicher bzw. östlich/westlicher Richtung von Greenwich entfernt bin, weiß ich wo ich bin. Das ist auf dem Festland recht einfach, denn da kann ich meine Bezugspunkte ja immer sehen und die Entfernungen exakt vermessen.
Wenn sich jetzt aber der zwielichtige Werftsbesitzer Stähli nachts am Bodensee rumtreibt, dann sieht er nicht nur nichts, weil es dunkel ist sondern hat bei schlechtem Wetter auch noch das Pech, nichts außer Wasser zu sehen. Und ohne Bezugspunkte kann man nicht wissen, wo man ist.
Heute hat man dafür natürlich technische Hilfsmittel und wir haben uns ein paar Bezugspunkte an den Himmel gesetzt. Dort ziehen ein paar Dutzend Satelliten ihre Runde die von der Erde aus gesehen werden können. Bzw. “gesehen”, da man sie ja mit Funksignalen anpeilt und nicht mit freiem Augen nach ihnen suchen muss. Das war früher anders. Da hat man auch probiert, Bezugspunkte auf dem Meer zu errichten. Überall waren sogenannte Feuerschiffe auf dem Wasser verteilt und verankert, die dort als Leuchttürme dienten, wo die Natur unpraktischerweise keine Inseln zur Verfügung gestellt hatte. Anfangs hatten diese Schiffe nur Licht- und Tonsignale abgegeben, an denen sich vorbeifahrende Schiffe orientieren konnten. Später nutzte man dann schon Funksignale.

Das Feuerschiff “Flensburg” im Jahr 1961 (Bild: Holger Ellgaard, CC-BY-SA 3.0)
Urs Stähli scheint am dunklen See jedenfalls gefunden zu haben, was er gesucht hatte. Und jemand dürfte ihn gefunden haben, den am nächsten Morgen treibt sein Boot führerlos auf dem Wasser und er leblos darin. Kommissarin Blum probiert den Fall gemeinsam mit ihrem Schweizer Kollegen Reto Flückiger zu lösen. Zuerst verdächtigen sie den Assistentin von Flückiger, der nämlich schon seit Jahren Werftbesitzer Stähli des Drogenhandels verdächtigt und ein wenig von ihm besessen zu sein scheint. Irgendwann haut er einfach ab; wird aber von Flückiger geschützt, der keine Fahndung ausschreiben will. Sehr zum Ärger von Blum und ihrem Konstanzer Kollegen Perlmann. Die sitzen in der Schweiz, wissen nicht wo sich der Flüchtige aufhält und können nichts tun.
“Wir sind hier in der Schweiz. Ohne Amtshilfeansuchen dürfen wir hier noch nicht mal nach der Uhrzeit fragen.”
meinte Kommissarin Blum. Tja, hätten sie mal lieber nach der Uhrzeit gefragt! Denn die hat sich im Laufe der Geschichte als die beste Methode herausgestellt, um herauszufinden, wo sich etwas befindet. Im 18. Jahrhundert waren die seefahrenden Nationen dieser Welt ziemlich angenervt von der Tatsache, dass ihre Schiffe auf dem Meer nicht herausfinden konnten, wo sie genau waren. Andauernd verfuhren sie sich, liefen auf Riffe auf oder brauchten für ihre Reisen viel länger als geplant. Erschreckend viele Seeleute starben immer wieder, weil sich die Position der Schiffe nicht bestimmen ließ. Anfang des 18. Jahrhunderts setzte die britische Regierung daher ein hohes Preisgeld für die Lösung dieses Längenproblems aus.
Eigentlich wäre es ja ganz einfach: Die Erde dreht sich von Westen nach Osten, mit einer bekannten Geschwindigkeit (sie braucht dafür genau einen Tag). Eine Hälfte wird dabei immer von der Sonne beschienen, die andere nicht. Wenn sich also zum Beispiel London gerade in die beleuchtete Hälfte dreht und dort der Tag beginnt ist es westlich davon noch dunkel. Ein Schiff auf dem Atlantik muss also nur aufpassen, wann die Sonne an seiner Position aufgeht und diesen Zeitpunkt mit der Sonnenaufgangszeit in London vergleichen. Je weiter westlich es von Greenwich ist, desto größer wird der Unterschied sein. Das wäre heute kein Problem, damals aber schon. Man konnte zwar bestimmen, wann die Sonne an der eigenen Position aufgeht, wusste aber nicht, wie spät es im gleichen Moment in London war. Es gab keine Uhren, die man mitnehmen hätte können und keine Funksignale oder Telegraphen, um in London nachzufragen. Die einzigen genauen Uhren der damaligen Zeit waren Pendeluhren und die funktionierten auf den schwankenden Schiffen nicht. Die Astronomen probierten also, eine himmlische Uhr zu basteln, in dem sie dicke Bücher mit langen Tabellen erstellten. Darin berechneten sie, wann der Mond in einer bestimmten Nacht und an einer bestimmten Position vor bestimmten Sternen vorüber ziehen würde. Man musste als nur nachsehen, wo sich der Mond gerade am Himmel befand, und da das auf See und in London gleichzeitig passierte, konnte man aus den astronomischen Büchern die entsprechende Zeit ablesen. Leider ist das eine enorm aufwendige Methode, die nicht wahnsinnig genau ist und bei schlechtem Wetter nicht angewandt werden kann. Das Längenproblem wurde dann schließlich im Jahr 1759 vom Uhrmacher John Harrison gelöst, der eine Taschenuhr bauen konnte, die kompakt genug war um auf Schiffsreisen mitgenommen werden zu können und trotzdem noch ausreichend genau lief. Die Kapitäne wussten nun also immer genau, wie spät es gerade in London war und konnten daraus ihre Position berechnen.



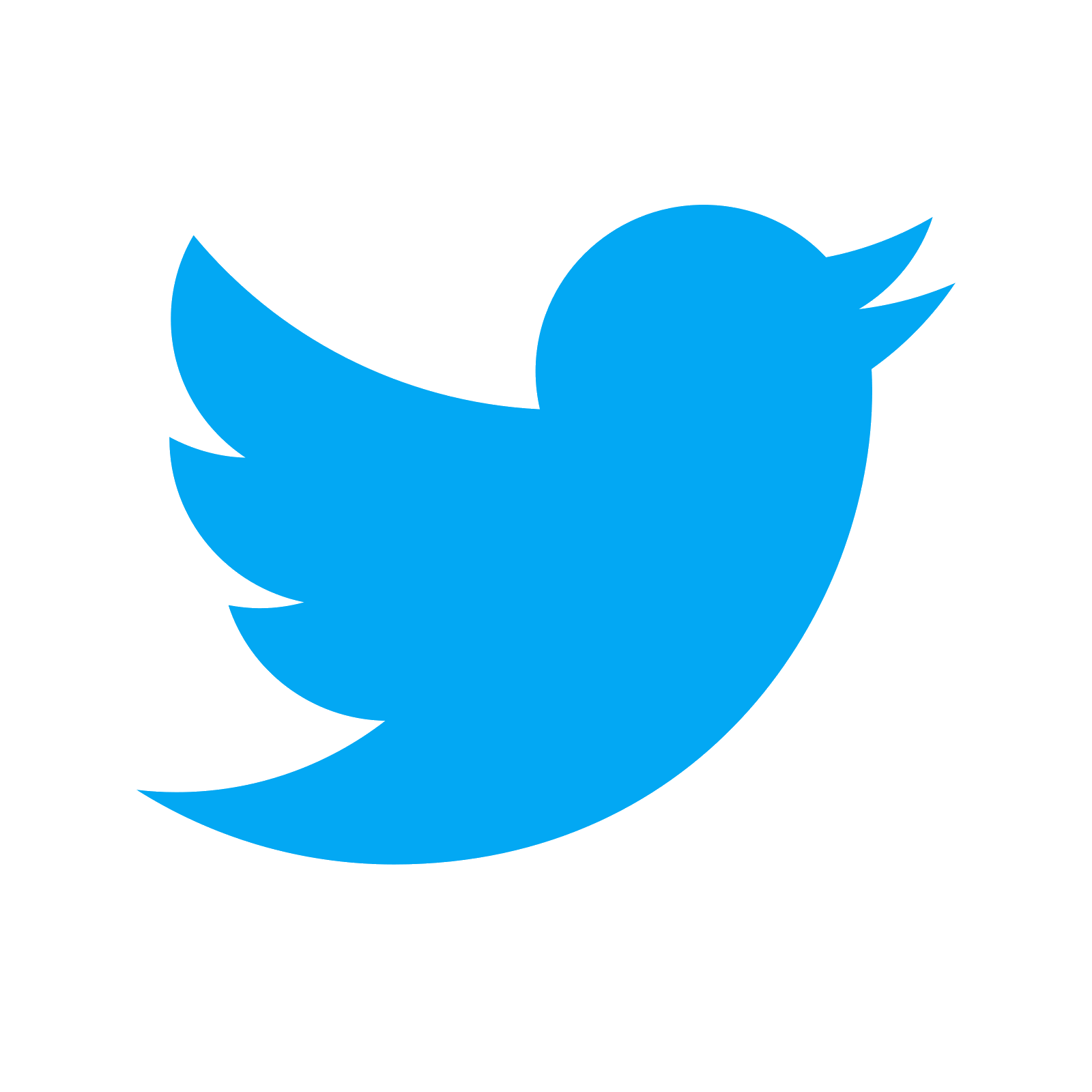







Kommentare (17)