Als unerwünschte Folge eines Teilchenbeschleuniger-Experiments erlebt die Menschheit einen kollektiven, dreiminütigen Bewusstseinssprung in eine 21 Jahre entfernte Zukunft – so zumindest lautet die Prämisse des Science Fiction-Romans „Flash Forward”, der wiederum die Grundlage der gleichnamigen – leider eher wissenschaftsfeindlichen – TV-Serie bildet.
Wer sich schon mal eine Folge Flash Forward im TV angesehen hat, und erst danach einen Blick in die Romanvorlage aus dem Jahr 1999 riskiert (am besten im englischsprachigen Original zu lesen), dürfte überrascht sein: Keine FBI-Ermittlergruppe, keine weltweite Verschwörung, keine Kämpfe gegen Söldnertruppen im Irak, keine verhunzte Version von Schrödingers Katze – und vor allem keine skrupellosen Wissenschaftler, die den millionenfachen Tod von Menschen fast schon schulterzuckend in Kauf nehmen. Tatsächlich gibt es überhaupt nur einen einzigen Charakter – den Physiker Lloyd Simcoe – der sowohl im Buch als auch in der TV-Adaption auftaucht, ansonsten sind Roman und Serie – abgesehen von der Idee des kollektiven Bewusstseinssprungs – praktisch schnittmengenfrei, womit sich der Roman des preisgekrönten (u.a. Nebula-Award) kanadischen SF-Autors Robert J. Sawyer auch abgeschreckten Fernsehzuschauern empfehlen lässt.
Worum geht es in „Flash Forward”?
Der Roman beginnt mit einer kurzen Vorstellung des LHC, des am CERN angesiedelten Large Hadron Colliders, über dessen Funktionsweise – und völlige Ungefährlichkeit – Florian, Jörg und Ludmila hier, hier, hier und hier bereits ausführlich berichtet hatten, und um den sich zahlreiche Verschwörungs- und Weltuntergangstheorien ranken. Drei der Protagonisten in Sawyers Roman – die Physiker Lloyd Simcoe und Theodosius „Theo” Procopides sowie die Technikerin Michiko Komura – gehören einem Team von CERN-Wissenschaftlern an, das sich auf der Suche nach dem massegebenden Higgs-Boson befindet. Während eines Experiments verlieren die Teammitglieder plötzlich ihr Bewusstsein und erleben für eine dreiminütige Zeitspanne merkwürdige Visionen von teils banalen Alltagshandlungen, die sich im Verlauf der Handlung schnell als Blick in eine 21 Jahre entfernte Zukunft erweisen.

Als Simcoe und seine Kollegen wieder zu sich kommen, müssen sie entdecken, dass der Blackout nicht auf das CERN begrenzt war, sondern globale Außmaße hatte – und damit nicht nur Milliarden Menschen mit verwirrenden Eindrücken der eigenen Zukunft zurückgelassen, sondern auch viele tausend Todesopfer gefordert hat. Und während das Team noch damit beschäftigt ist zu ergründen, ob möglicherweise ihr Experiment der Auslöser des „Flash Forwards” gewesen sein könnte, sind die Charaktere darüber hinaus gezwungen, sich mit ihrer ganz persönlichen Vision der Zukunft auseinanderzusetzen – wie etwa Lloyd Simcoe, der sich mit einer ihm unbekannten Frau verheiratet sah und nun versucht ist, seine Verlobung aufzulösen, um einer gescheiterten Ehe aus dem Weg zu gehen. Oder der junge „Theo” Procopides, der – wie viele andere Menschen – keine Vision hatte und sich der Vorstellung stellen muss, in 21 Jahren voraussichtlich nicht mehr am Leben zu sein.

Der Roman, dessen wesentlicher Handlungsstrang an dieser Stelle nach kaum 50 Seiten endet, entführt den Leser in den folgenden 250 Seiten auf eine halbernste aber dennoch faszinierende Reise durch eine Welt, die durch das (vermeintliche) Wissen um die Zukunft tiefgreifend transformiert wird. Lohnt sich zum Beispiel der Widerstand des chinesischen Dissidenten, wohlwissend, dass sein Land auch in 21 Jahren noch von der kommunistischen Partei regiert wird? Wie reagiert der angehende Schauspieler oder Autor, wenn er sich in 21 Jahren Fritten und Hamburger servieren sieht? Und sollte es wirklich gestattet sein, auf in Zukunftsvisionen zufällig erblickte Apparaturen und Designs Patente anzumelden?
Zeitreisen und schwarzer Humor
Ein weiteres dominierendes Element sind die vielen Gespräche zwischen den Protagonisten über die Frage nach der einen – unveränderbaren – Zukunft, in deren Rahmen zahlreiche weniger bekannte Zeitkonzepte und Zeitreise-Paradoxa angerissen werden, darunter der Minkowski-Würfel, das Nivensche Gesetz oder auch der Unterschied zwischen der Many-Worlds-Interpretation und der Transactional Interpretation in der Quantenphysik.
Lobend erwähnt sei an dieser Stelle auch der eher schwarze Humor des Romans, der die in zahlreichen Dialogen ausgefochtenen Grabenkämpfe zwischen Naturwissenschaftlern und Philosophen ob des korrekten Umgangs mit dem unbekannten Phänomen zu einer recht kurzweiligen Lektüre werden lässt – die mich auf amüsante Art und Weise an manche Diskussionen auf den ScienceBlogs erinnern…
Lloyd found himself crumpling up the newspaper page and throwing it across the office. A philosophy professor! Punter’s death didn’t prove a thing, of course. His account was entirely anecdotal. There was no supporting evidence for it – no newspaper or TV show glimpsed that could be compared with others’ accounts of the same things and no one else had appearantly seen him in their visions. A forty-seven year old could easily be dead in twenty-one years. He could have made up the vision rather than revealing he hadn’t had one. Lloyd sighed. Couldn’t they have gotten a real scientist to adress this issue? Someone who understands what really constitutes evidence? A philosophy professor! Give me a f…. break.
Darüber hinaus bietet das Szenario Raum für alle möglichen skurrilen Nebenhandlungen, wie etwa die des Physikers, der versucht, Hinweise auf seinen eigenen Mord zu erhalten, indem er mit dem zukünftigen Ermittler über dessen Visionen spricht – und feststellen muss, dass der gegenwärtig erst sieben Jahre alt ist. Oder die des Mannes, der sich nach seiner Vision für einen der ersten Astronauten auf dem Mars hält – bis diese sich als Ausflug in einen Virtual Reality-Simulator in Disney World erweist. Oder die des Illusionisten, der in einer TV-Show einen Briefbeschwerer aus seiner Vision zerschlägt, um zu beweisen, dass die Zukunft nicht fixiert ist – und daraufhin von Simcoe, der von der Unabänderbarkeit der Visionen überzeugt ist, einen baugleichen Briefbeschwerer zugeschickt bekommt…
Alles in allem ein sehr unterhaltsamer und lesenswerter Roman, in dem darüber hinaus noch zahlreiche physikalische Theorien und philosophische Überlegungen angerissen werden und der sich – ähnlich wie die Riverworld-Chroniken – dadurch auszeichnet, dass etliche nicht-fiktionale Charaktere und Organisationen eine Rolle spielen – von Bernard Shaw über Frank Tipler bis hin zum Comittee of the Scientific Investigation of the Paranormal (CSICOP), dem US-amerikanischen Vorbild der GWUP. Kuriosum am Rande: Der Papst des fiktionalen Jahres 2009 ist Benedikt XVI. – und das in einem 1999 erstveröffentlichten Buch…
Vom Buch zur TV-Serie
Was nun ist aus dieser anregend-skurrilen Romanvorlage geworden, als der Sender ABC sich 2007 dazu entschloss, den Stoff zu verfilmen? Offensichtlich gefiel den Produzenten und Autoren zwar die Prämisse des globalen Blackouts sowie der kollektiven Zukunftsvision, nicht jedoch der Rest des eher dialoglastigen Romans, so dass man sich dazu entschloss, eine eigene Storyline zu entwickeln, die bestenfalls noch lose auf der Buchvorlage basiert. Herausgekommen ist eine ziemlich stark actionorientierte Handlung rund um die Blackout-Ermittlungen des FBI-Agenten Mark Bamford, der – wie auch die restlichen Charaktere der TV-Show – im Buch nicht vorkommt.
Ein wesentlicher Unterschied zur Romanvorlage ist dabei die recht drastische „Verkürzung” des Zeitsprungs von 21 Jahren auf gerade mal sechs Monate, die einen dem Medium angemessenenen, schnelleren Handlungsverlauf begünstigt – so nimmt unter anderem natürlich die Dringlichkeit der Spurensuche zu, wenn der eigene Mord nicht in 21 Jahren, sondern bereits in sechs Monaten stattfinden soll (dieser Handlungsstrang aus dem Buch hat sich ja immerhin über den Sub-Plot rund um “Sulu” Demetri Noh in die Serie gerettet).
Dass die Serie qualitativ mit dem Roman kaum mithalten kann, liegt in meinen Augen allerdings weniger an solchen, dem Medium geschuldeten Änderungen, sondern eher an der klischeehaften Ausgestaltung des LHC-Subplots. Während die Wissenschaftler im Roman als vielschichtige Charaktere präsentiert und der Wissenschaftsbetrieb an sich einigermaßen realitätsnah abgebildet wird, verfällt die Serie dem altbekannten Klischee der gewissenlosen Clique renegater Wissenschaftler, die unter vollem Bewusstsein der Konsequenzen auf einen Blackout hinarbeiten, personifiziert insbesondere durch den Protagonisten Simon Campos, der darüber hinaus auch noch alle anderen Klischees voll erfüllt (Arroganz, Zynismus, gering ausgeprägtes Sozialverhalten, fehlendes Verantwortungsbewusstsein etc. pp.).
Flash Forward im TV ist dadurch – owohl unterhaltsam – weitaus weniger ansprechend als Flash Forward in Papierform. Ein Jammer, dass man nicht versucht hat, die Romanvorlage dichter „am Stoff” zu verfilmen. Dabei wäre den Schauspielern, denen es gelungen wäre, die Szene, in der sich ein Physiker und ein Chemiker mit gezogener Waffe über das Pauli-Prinzip streiten, glaubwürdig zu verkörpern, ein Oscar schon so gut wie sicher gewesen…
Noch mehr Buchrezensionen auf ScienceBlogs:

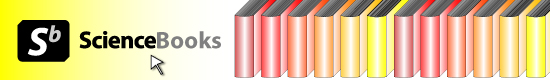

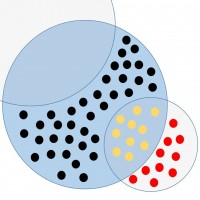
Kommentare (13)