Das kleinste Schmiedeteil der Welt ist winzig. Sehr winzig. Mit einem Durchmesser von weniger als 500 Nanometern müsste man mehr als 100 nebeneinanderlegen, um die Dicke eines Haares zu erreichen. Und wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer – sondern die Braunschweiger. Die Forschung, die ich heute vorstelle, stammt direkt von meinen Kollegen am Braunschweiger Institut für Werkstoffe.
Woher bekommt man Nanoteilchen?
Bei uns in Braunschweig befasst man sich seit langem mit besonders festen und temperaturbeständigen Legierungen, den Nickelbasis-Legierungen, aus denen man zum Beispiel Turbinenschaufeln baut. Unter dem Mikroskop sehen diese Legierungen so aus:
Ihr erkennt viele kleine etwa quadratische Felder. Da es sich um einen Blick auf die (geeignet behandelte) Oberfläche des Metalls handelt, sind die Strukturen natürlich in Wahrheit keine Quadrate, sondern kleine Würfelchen. Diese Würfelchen – γ’-Teilchen (sprich: “gamma-Strich”) genannt – bestehen im Wesentlichen aus Nickel- und Aluminiumatomen in einer ganz regelmäßigen Anordnung (ein paar andere Elemente wie Titan, Tantal und so sind auch noch drin, aber heute geht es ja nicht ums Legierungsdesign, die können wir also vernachlässigen).
Um die γ’-Teilchen herum liegt die metallische Matrix, die ebenfalls vor allem aus Nickel besteht, auch wieder mit ein paar anderen Elementen darin. Das Zusammenspiel von Matrix und Teilchen verleiht den Nickelbasis-Legierungen ihre extreme Festigkeit. Die Teilchen behindern die Bewegung der Versetzungen im Kristall, also der Störstellen, die für die Verformung zuständig sind (folgt dem Link für eine ausführliche Erklärung). Nickelbasis-Legierungen sind deswegen etwas besonderes, weil diese Teilchen auch bei hohen Temperaturen stabil bleiben und sich nicht – wie die meisten anderen Ausscheidungen in Metallen – zu größeren Klumpen vereinen. Außerdem liegen sie als Würfelchen vor, nicht als kugelige Teilchen; dadurch kann man sie sehr dicht in die Matrix packen. (Dahinter stecken natürlich wieder die Thermodynamik und die Entropie.)
Es sind diese kleinen Würfelchen, die wir schmieden wollen. Dazu müssen wir sie natürlich erstmal aus der Matrix herausholen. Das geht am besten mit Hilfe geeigneter Säuren (und einer angelegten elektrischen Spannung), die die metallische Matrix wegätzen, aber die Teilchen nicht beeinflussen. (Die dazu notwendige Ätztechnik wurde in einem anderen Projekt bei uns am Institut entwickelt – da modelt man die Legierung noch ein bisschen um, so dass man am Ende eine poröse Membran erhält – aber auch das ist eine andere Geschichte.)
So sieht so ein Würfelchen dann aus:
Und hier der Vergleich mit einem menschlichen Haar
Der Schmiedeprozess
Dank geeigneter Ätzung können wir die Teilchen also aus der Matrix herausholen. Sie werden dann aus der Säure herausgefiltert und anschließend in ein Rasterelektronenmikroskop (kurz REM – wenn Materialwissenschaftler immer “Rasterelektronenmikroskop” sagen würden, müsste die Arbeitszeit pro Tag vermutlich gleich um 15 Minuten verlängert werden) gebracht.
Unser REM verfügt über Mikromanipulatoren – letztlich sind das feine Nadeln, die man sehr präzise bewegen kann:
Mit diesen Nadeln “pickt” man die Teilchen auf – meistens klappt das, weil so kleine Teilchen im Verhältnis zu ihrem Volumen eine sehr große Oberfläche haben und deswegen die Haftung (Adhäsionskräfte) groß ist.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach wie es hier klingt – sobald nämlich auch nur kleine elektrische Ladungen vorhanden sind, laden sich die Teilchen auf und hüpfen durch die Gegend. Man braucht also schon ein bisschen Geschick, damit das funktioniert (und damit ist es nix für mich – mein experimentelles Geschick ist kleiner als Epsilon).
Aber wenn alles klappt, dann kann man das Teilchen jetzt auf die dafür vorgesehene “Platte” legen, an der auch noch ein kleiner Kraftmesser dran ist. Diese Platte ist sozusagen der Amboß:
Um das Teilchen zu schmieden, braucht man natürlich auch noch einen Hammer. Dafür nimmt man Wolfram-Nadeln, so wie die, die oben schon ins Bild ragt – die sind ziemlich verformungsresistent. Man zieht den Manipulator zurück und positioniert die Wolfram-Nadel über dem Teilchen:
Und jetzt kann man mit der Wolfram-Nadel das Teilchen plattdrücken (unter dem Bild jeweils die gemessene Kraft, die man dafür braucht)
Und was soll das?
Ist ja ganz nett – aber mal ehrlich, wozu soll das gut sein?
Zum einen kann man natürlich an Anwendungen denken, beispielsweise an das Schmieden von Nanobauteilen für die Mikrotechnik. (Momentan ist ein Kollege gerade dabei, Teilchen in Formen reinzuschmieden – aber da das noch nicht veröffentlicht ist, sage ich dazu erstmal nichts.) Vielleicht wollen wir ja irgendwann man Naniten herstellen, oder U-Boote, die durch den menschlichen Körper fahren [Hier war ein Bild aus dem amerikanischen Film “Fantastic Voyage”; aus Copyright-Gründen habe ich das lieber entfernt.]
Da ist es sicher praktisch, wenn wir kleine Zahnräder, Kolben oder sonst irgendwelche Bauteile schmieden können.
Aber zugegeben, das ist natürlich ein bisschen Science Fiction. Die Nanoschmiederei hat aber noch einen direkten wissenschaftlichen Wert: Wie genau sich derart kleine Teilchen verformen, ist nämlich immer noch nicht verstanden. Eigentlich sollten so kleine Teilchen wenig oder gar keine Versetzungen enthalten, weil die an die Oberfläche wandern (was energetisch günstiger ist). Wie können sie sich dann trotzdem so gut plastisch verformen?
Diese Fragen werden zur Zeit überall auf der Welt intensiv untersucht – allerdings nicht an Nanowürfeln (da sind wir in Braunschweig einzigartig), sondern an sogenannten “Micropillars” (Mikrosäulen) wie diesen hier:
(Quelle: https://www2.nsysu.edu.tw/MSE/research/research.htm)
Diese Micropillars werden mit einem Ionenstrahl aus einem Material herausgetrennt und dann verformt. Allerdings haben sie gegenüber unseren Nanowürfeln zwei Nachteile: Zum einen stehen sie nicht frei, sondern sind immer noch unten verankert. Zum anderen führen die Ionenstrahlen, mit denen man das umliegende Material wegbrät, zu Störungen an der Oberfläche der Micropillars, deren Einfluss man schwer genau einschätzen kann. Die Nanowürfel sind also eine interessante Alternative.
Und natürlich – und hier kommt ein bisschen von meiner Forschung ins Spiel – kann man auch versuchen, diesen Prozess im Computer zu simulieren. Damit kann man testen, wie denn nun die Versetzungen in den Nanowürfel hineinkommen – wir machen bestimmte physikalische Annahmen und schauen dann, ob die simulierte Verformung der real gemessenen entspricht, was dann die Annahmen stützen würde. Leider ist auch das noch nicht veröffentlicht (die Simulationsrechnungen dauern seeeehr lange) – deswegen erzähle ich das nicht im Detail. Aber zumindest ein hübsches Bild kann ich euch zeigen, das nebenbei demonstriert, warum Simulationen immer besser sind als Experimente – sie sind viel bunter:
Die Ergebnisse sind erschienen in
Schloesser, J., Rösler, J., & Mukherji, D. (2011). Deformation behaviour of freestanding single-crystalline Ni3Al-based nanoparticles International Journal of Materials Research (formerly Zeitschrift fuer Metallkunde), 102 (05), 532-537 DOI: 10.3139/146.110504
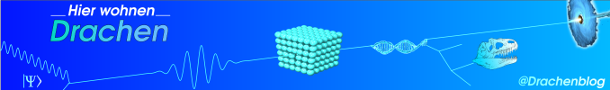

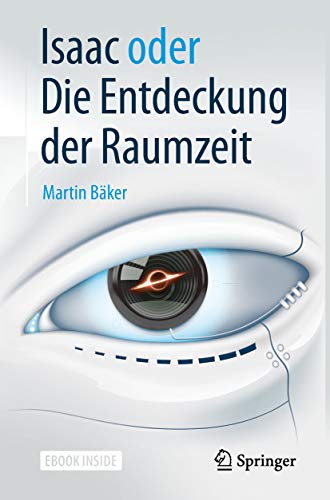



Kommentare (18)