Wir Menschen und viele unserer nächsten Verwandten sind ja soziale Wesen, die in großen komplexen Gruppen leben und tagaktiv sind. Primaten stammen aber mit ziemlicher Sicherheit von nachtaktiven Einzelgängern ab. Wie hat sich der Wandel vollzogen? Gab es Zwischenstufen, beispielsweise Familienverbände? Wie soll man das herausfinden – Verhalten lässt sich ja nicht an Fossilien beobachten. Eine neue Untersuchung verwendet raffinierte Computeranalysen, um diese Frage zu beantworten.
Die Grundidee ist eigentlich simpel (ihre Umsetzung allerdings nicht): Man nehme einen “Stammbaum” der Primaten, genauer gesagt, ein Kladogramm. Darin sind die Verwandtschaftsbeziehungen unterschiedlicher Primatenarten detailliert dargestellt. (Wer genau wissen will, wie so etwas funktioniert, kann das hier nachlesen.)
Das Kladogramm stammt vom 10k-Trees project der Uni Harvard. Dabei werden auf der Basis von genetischen Daten (also durch Vergleich der DNA) Stammbäume erzeugt. Das Besondere am 10k-Trees Projekt ist jetzt, dass man nicht einfach einen einzigen Stammbaum produziert, der am besten zu den Daten passt, sondern 10000 unterschiedliche (daher der Name des Projekts), die durch statistische Verfahren erzeugt wurden und alle eine einigermaßen hohe Wahrscheinlichkeit besitzen, korrekt zu sein. Das sieht man auch sehr schön an diesem Bild von der Internetseite:
Für die Analyse des Sozialverhaltens wurde aber ein einziges Kladogramm ausgewählt – das mit der maximalen Wahrscheinlichkeit, richtig zu sein.
![]() In dieses Diagramm trägt man dann ein, in welcher sozialen Struktur die jeweiligen Primaten leben. Dabei muss man natürlich ein bisschen vereinfachen – die Sozialstruktur von Schimpansen, Pavianen und Menschen ist in vieler Hinsicht sehr unterschiedlich, und wenn man solche feinen Unterschiede berücksichtigen wollte, dann würde man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Deswegen hat man sich auf vier grundlegende Sozialstrukturen beschränkt: Einzellebend, Gruppen, die ein Männchen enthalten, Gruppen die mehrere Männchen enthalten, Familien mit einem Elternpaar. (Falls sich jemand fragt, wie Menschen eingestuft werden: Wir leben in Gruppen mit mehreren Männchen, auch wenn sich darin noch eine Familien-Substruktur findet.)
In dieses Diagramm trägt man dann ein, in welcher sozialen Struktur die jeweiligen Primaten leben. Dabei muss man natürlich ein bisschen vereinfachen – die Sozialstruktur von Schimpansen, Pavianen und Menschen ist in vieler Hinsicht sehr unterschiedlich, und wenn man solche feinen Unterschiede berücksichtigen wollte, dann würde man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Deswegen hat man sich auf vier grundlegende Sozialstrukturen beschränkt: Einzellebend, Gruppen, die ein Männchen enthalten, Gruppen die mehrere Männchen enthalten, Familien mit einem Elternpaar. (Falls sich jemand fragt, wie Menschen eingestuft werden: Wir leben in Gruppen mit mehreren Männchen, auch wenn sich darin noch eine Familien-Substruktur findet.)
Trägt man diese vier Sozialstrukturen in ein Kladogramm ein, dann ergibt sich ein ziemlich klares Bild:
Die Farbgebung codiert dabei die Sozialstruktur: Lila für einzellebend, Orange für Gruppen mit einem Männchen, Rot für Gruppen mit mehreren Männchen und Pink für paarlebende Primaten. (Grau bezeichnet die Arten, für die die entsprechenden Daten nicht vorlagen.)
Das Kladogramm selbst zerfällt in zwei große Gruppen, oben die Prosimii (oft als “Halbaffen” bezeichnet, ein Begriff, der aber meines Wissens so eigentlich nicht mehr benutzt wird), unten die Anthropoidea, die “Menschenartigen”, zu denen nicht nur wir und die Menschenaffen gehören, sondern auch Neu- und Altweltaffen (also Paviane, Uakaris, Rhesusaffen, Löwenkopfaffen und so weiter). Wir Menschen hängen übrigens an dem Knoten mit dem “e”.
An den Daten sieht man, dass die Sozialstruktur anscheinend evolutionär ziemlich stabil ist: Die Farben sind nicht kreuz und quer durch das Diagramm verstreut, sondern treten in großen Blöcken auf. Unter den Prosimiern sind die meisten einzellebend, aber es gibt einen großen (und einen kleinen) Block mit in Mehr-Männchen-Gruppen lebenden Arten, aus denen sich dann wiederum Arten mit Paarstrukturen entwickelten. Im unteren Teil des Diagramms sieht es ganz ähnlich aus, auch da gibt es große “Blöcke” mit gleichem Sozialverhalten.
Die erste Schlussfolgerung, die man ziehen kann, ist also, dass sich Sozialstrukturen nur selten evolutionär ändern – das mag überraschend vorkommen, weil sich für eine andere Struktur ja “nur” andere Verhaltensweisen entwickeln müssen, nicht aber irgendwelche Körperteile sich stark verändern müssen.
Schaut man weiter hin, dann sieht man, dass sich die Mehr-Männchen-Gruppen (in Rot) typischerweise aus den einzeln lebenden Arten entwickeln, und dann aus diesen Mehr-Männchen-Gruppen sowohl paarlebende als auch Ein-Männchen-Gruppen. Auch das ist überraschend – bisher war häufig angenommen worden, dass die Entwicklung in Richtung zunehmender Komplexität verläuft, also erst die Pärchenstruktur, dann eine Haremstruktur mit einem Männchen und vielen Weibchen und erst dann die Großgruppen.
Eine detaillierte statistische Analyse der Daten zeigt aber, dass das nicht der Fall ist. Dazu wurden unterschiedliche Modelle des Übergangs zwischen den Gruppen verwendet und geprüft, wie gut sie zu den Daten passen. Der klare Sieger ist dieses Diagramm hier:
Die Entwicklung ging also anscheinend direkt vom Einzelgänger hin zur Sozialstruktur mit höchster Komplexität, den großen Gruppen. (Theoretisch ist natürlich denkbar, dass es bei diesen Übergängen immer Zwischenstufen gab, von denen aber keine in heutigen Arten erhalten blieben – besonders wahrscheinlich ist das aber nicht.) Von dort aus können dann entweder Paarstrukturen oder Haremsstrukturen entstehen, und Haremsstrukturen können sich wieder zu größeren Gruppen zurückentwickeln, während das bei Paarstrukturen nicht beobachtet wird. (Was natürlich nicht heißt, dass es nie passiert ist oder passieren kann.)
Was hat nun die Entwicklung vom Einzelgänger zur Großgruppe getrieben? Gruppenlebende Primaten sind nahezu immer tagaktiv, einzeln lebende sehr häufig nachtaktiv. Es liegt also nahe, dass mit dem Übergang vom Nacht- zum Tagleben auch größere Gruppen gebildet wurden. Auch dies lässt sich an Hand der Daten statistisch prüfen. Es zeigt sich tatsächlich, dass die beiden denkbaren Zwischenzustände (nachtaktiv und in Gruppen lebend und tagaktiv und einzelgängerisch) zwar vorkommen, dass sie aber instabil sind: Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich aus diesen beiden Zuständen der Zustand tagaktiv und in Gruppen lebend entwickelt. Die Vermutung liegt nahe, dass dies damit zusamenhängt, dass tagaktive Primaten ein wesentlich höheres Risiko haben, einem Beutegreifer zum Opfer zu fallen – das ließ sich aber mit den Daten nicht eindeutig sagen.
Eine alternative Erklärung für die Entwicklung zum Gruppenleben, die als plausibel gilt, ist die, dass sich Gruppen bilden, wenn ein Geschlecht nach dem Erwachsenwerden sich weiter vom Geburtsort entfernt als das andere (so wie in unserer europäischen Gesellschaft früher Frauen wegheirateten). Das könnte dazu führen, dass Angehörige des jeweils anderen Geschlechts an einem Ort eng miteinander verwandt sind, so dass es ein Selektionsvorteil ist, Gruppen zu bilden, in denen sich die Mitglieder unterstützen. Dieses Modell wird jedoch durch die Daten nicht bestätigt.
Insgesamt ergibt sich also, dass der Übergang vom nacht- zum tagaktiven Primaten eine Sozialstruktur mit großen Gruppen bedingt, vermutlich wegen des besseren Schutz vor Räubern. Aus größeren Gruppen können sich dann andere Strukturen entwickeln. Und man sieht, dass man mit genügend Cleverness und hinreichend vielen Daten sogar die Evolution des Verhaltens schlüssig rekonstruieren kann.
Shultz, S., Opie, C., & Atkinson, Q. (2011). Stepwise evolution of stable sociality in primates Nature, 479 (7372), 219-222 DOI: 10.1038/nature10601
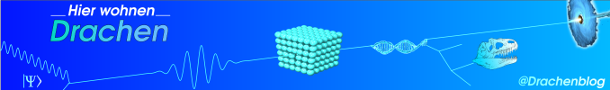

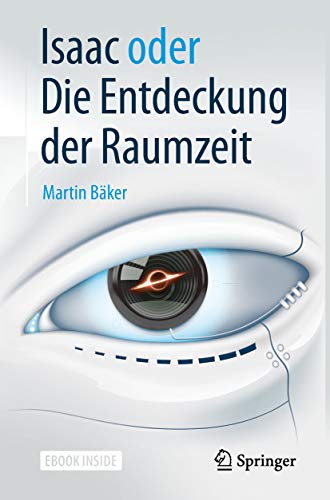



Kommentare (21)