In drei Dimensionen geht es genauso (mit einer zusätzlichen z-Richtung), ist aber schwieriger zu zeichnen. Der zugehörige Wellenvektor k ist dann ein dreidimensionaler Vektor und ist natürlich genau der, der mit dem Impuls der Welle zusammenhängt.
Wenn noch die Zeit hinzukommt, dann müssen wir jetzt unsere Wellen auch noch zeitlich oszillieren lassen, also als Sinus- und Kosinus-Funktionen in der Zeit schreiben. Die Frequenz der zeitlichen Oszillationen ist wieder ω – um eine beliebige Funktion darzustellen, müssen wir natürlich auch wieder verschiedene Wellen mit unterschiedlichem ω überlagern.
Wir brauchen also alle möglichen Wellen in Raum und Zeit, gekennzeichnet durch ihre Wellenzahlen k und ihre Frequenzen ω. Mit denen können wir den Propagator jetzt als Kombination aus Wellen darstellen.
Die Formel lautet
oder, wenn man die Vierervektoren auseinanderzieht und (x-y) als (Δt, Δx) umschreibt (wie üblich ohne Garantie, dass ich alle Vierervektoren vorzeichentechnisch richtig aufgedröselt habe)
Bemerkenswert an den Formeln ist vor allem der Ausdruck iε im Nenner des Bruchs. Das ist ein mathematischer Trick, der dafür sorgt, dass das Integral nicht gleich explodiert, wenn k2=m2 ist. Löst man das Integral mit den Mitteln der Funktionentheorie, dann kann man mit dem ε dafür sorgen, dass am Ende alles sauber herauskommt (und das ε sollte am Ende aus der Rechnung herausfallen). Das sind aber mathematische Tricksereien, die ich bestimmt nicht erkläre, dazu ist meine Funktionentheorie-Vorlesung viel zu lange her.
Aber halt! Sollten nicht Wellenzahl und Frequenz in genau der richtigen Beziehung zueinander stehen, damit wir ein Teilchen beschreiben können? Müssten nicht also in der Formel für den Propagator nur diejenigen Kombinationen von ω und k auftreten, mit denen wir die richtige Energie-Impuls-Beziehung bekommen?
Schreibt man die Formel J(x)D(x-y)J(y)/2 in Wellenform um, dann stellt man fest, dass das zunächst nicht der Fall ist – alle möglichen Wellen leisten einen Beitrag und nichts garantiert, dass ω und k zueinander passen, dass also ω2–k2=m2 gilt . (Die Rechnung findet ihr im Buch von Zee, Kap. 1.4 oder vermutlich in jedem QFT-Buch der Welt.)
Je größer allerdings der Raumzeit-Abstand (x-y) zwischen den Quellen wird, desto stärker ist der Beitrag von nur genau den Wellen, bei denen ω und k im richtigen Verhältnis stehen, bei denen also ω2–k2 gleich m2 ist. Im Grenzfall einer sehr sehr weiten Entfernung (denkt im Zweifel an ein Teilchen der kosmischen Strahlung, aber auch ein paar Zentimeter und Zeitabstände im Mikro- oder Millisekundenbereich sind in der Quantenwelt ja schon viel) ist der Beitrag solcher Feldkonfigurationen, bei denen ω2–k2 ungleich m2 ist, verschwindend klein. Die Feldanregung sieht dann genau so aus wie ein Teilchen der Masse m, sie trägt Energie und Impuls in genau dem richtigen Verhältnis. Solche Anregungen sind das, was wir als “echte” Teilchen kennen. Auf diese Weise haben wir also (endlich) dem Extra-Term mit dem Parameter m einen Sinn verliehen: m ist die (Ruhe-)Masse der beobachteten Teilchen.
Wenn sich also eine Anregung von einer Quelle ausgehend über einen längeren Raumzeit-Abstand ausbreiten, dann kann diese Anregung wie einer Überlagerung aus Wellen beschrieben werden, die alle (in sehr guter Näherung) die richtige Frequenz-Wellenzahl-Beziehung (oder Energie-Impuls-Beziehung) haben, und zwar zu einem Teilchen mit einer Masse m. Wir messen deshalb ein Teilchen, und nicht eine beliebige Feldanregung.
Wie haben ja neulich schon diskutiert, warum man auch in einer Feldtheorie keine “halben” Elektronen sehen kann. Hier sehen wir dass dies nicht nur – wie neulich – für einzelne ebene Wellen gilt, deren Energie quantisiert ist, sondern auch für Störungen des Quantenfeldes, die sich ausbreiten. Messbare Anregungen durch Elektronen gibt es eben für Wellen, die eine Energie und einen Impuls tragen, die genau zur Masse m passen. Bei m/2 zum Beispiel, der halben Teilchenmasse, ist der Wert des Propagators dagegen klein, also sehen wir halbe Elektronen nicht. Von unserer Quelle breiten sich also Wellen aus, die sich mathematisch beschreiben lassen wie Teilchen der Masse m – unsere Feldtheorie hat also etwas wiederentdeckt, das wir schon wussten, nämlich dass es Teilchen gibt.
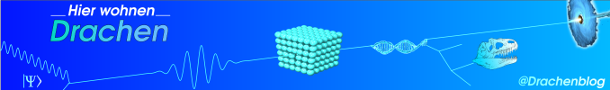

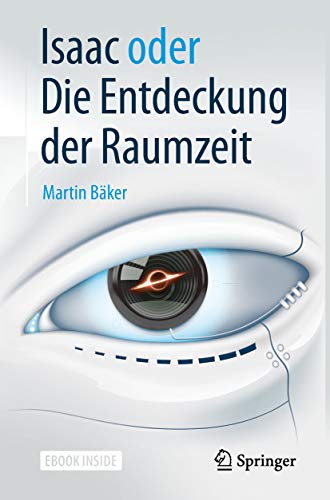



Kommentare (40)