Drüben bei Geograffitico hat Jürgen ja vor kurzem gefragt, ob Klausuren noch zeitgemäß sind. Ich will hier sogar noch einen Schritt weitergehen und fragen, ob sie es je waren oder ob sie ein Beispiel für eine klassische Denkfalle (oder sogar drei) sind, in die wir gern hineintappen.
Der Irrtum der eindimensionalen Quantifizierbarkeit
Der Sinn einer Klausur ist ja, zu messen, was eine Schülerin* oder Studentin gelernt hat. Das Wissen als solches ist natürlich ziemlich komplex – nehmen wir als Beispiel ein bisschen Oberstufenmathematik wie Integralrechnung, dann gibt es vielleicht Formeln zu lernen (wie berechne ich die Stammfunktion eines Polynoms) ein paar nette Sätze (Mittelwertsatz oder Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung), Flächenberechnungen, Anwendungsaufgaben etc. Wir packen ein entsprechendes Sammelsurium an Aufgaben in eine Klausur, verteilen die Punkte entsprechend (dazu gleich mehr) und lassen die Schülerinnen dann versuchen, die Aufgaben in einer bestimmten Zeit zu lösen. Das Ergebnis werten wir dann aus und jede bekommt eine Note.
*Ja, auch heute wieder im generischen Femininum, wie immer, ja, regt euch drüber auf, wenn ihr müsst, aber bitte hier.
Wenn man die Klausur ausarbeitet, dann muss man wie gesagt auch Punkte verteilen. Auch da sieht man, dass die scheinbar objektive Zahl, die am Ende herauskommt, eben auch willkürlichen Entscheidungen unterliegt – gebe ich für die einfache Antwort einen Punkt? Oder einen halben? Stelle ich viele Aufgaben, so dass die Zeit knapp ist (und diejenigen einen Vorteil haben, die schnell arbeiten oder ganz banal schnell schreiben können) oder lasse ich so viel Zeit, dass auch die, die gern ein wenig nachdenken oder nicht alles auswendig gelernt haben sondern sich manche Sachen während der Klausur selbst herleiten, genügend Zeit haben? Stelle ich schwere oder leichte Aufgaben oder mische beide?
An Hand der Note können wir dann etwas über das Wissen aussagen – aber tatsächlich nur sehr wenig. Eine 3 zum Beispiel kann dadurch zu Stande kommen, dass die Schülerin brav alle Formeln auswendig gelernt und richtig angewandt hat, oder dadurch, dass sie zwar nichts gelernt hat, aber einige der Textaufgaben auf kreative Weise gelöst hat. Oder nehmen wir an, zwei Schülerinnen haben beide eine 4 bekommen. Da in vielen Klausuren 50% für eine 4 ausreichen (jedenfalls an der Uni), ist es also denkbar, dass das Wissen der beiden vollkommen disjunkt ist und die eine genau das weiß, was die andere nicht weiß.
Diese sehr komplexen Sachverhalte versuchen wir in eine einzige Zahl zu packen – eben die Note. Dass dabei viel Information auf der Strecke bleibt, ist eigentlich offensichtlich. Die Annahme, man könne Wissen als eine einzige Zahl fassen, so dass man genau sagen kann, welche Schülerin wie viel besser ist als welche andere, ist eigentlich offensichtlich falsch. (Deswegen versucht man ja auch in Grundschulen, mit ausformulierten Zeugnissen zu arbeiten – was zwar besser ist, wenn man z.B. liest “rechnet sicher im Zahlenraum bis 100, hat aber Schwierigkeiten bei der schriftlichen Addition”, dann weiß man mehr als wenn da nur “2” steht, aber auf Grund der großen Zahl an Schülerinnen, die eine Lehrerin hat, endet es in vielen Fällen dann doch mit Standardsätzen, weil auch Lehrerinnen nur endlich viel Zeit haben.)
Ein Problem ist hier also die Annahme, dass wir eine einfache Zahl verwenden können, um “Wissen” zu beschreiben. Und das ist in anderen Bereichen noch wesentlich schwieriger – wenn ich zum Beispiel schriftliche Texte aus meinem Präsentationsworkshop bewerte, lässt eine mäßige Note nahezu gar keine Rückschlüsse mehr zu, was denn nun das Problem war: Schlechte Formulierungen? Unlogische Gliederung? Sprunghaftes Niveau? Zwei Texte mit gleicher Note zum selben Thema können vollkommen unterschiedlich ausfallen.
Die leichtere Frage
Was wir eigentlich tun, wenn wir eine Klausur bewerten, ist ähnlich zu dem, was bei Daniel Kahnemann (“Thinking – fast and slow”) “Aswering an easier question” heißt. Eigentlich wollen wir die gesamte Komplexität des Wissens einer Schülerin bewerten. In einer Zeit, wo es vielleicht nur eine Handvoll Schülerinnen pro Lehrerin gab, war das sicher einfach – jede Lehrerin wusste genau, was ihre Schülerinnen konnten und was nicht. (So ist es heute noch z.B. bei Doktorarbeiten – da weiß man als Betreuerin ziemlich genau, was am Ende rauskommt, weil man die Doktorandin und ihre Arbeit über Jahre intensiv begleitet hat.)
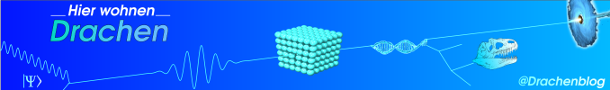

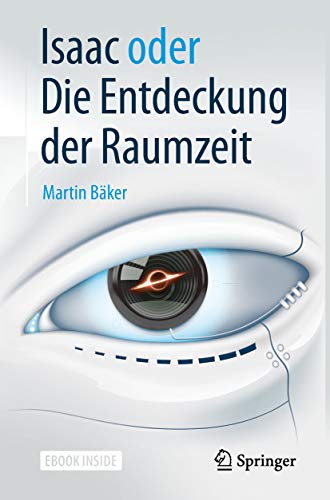



Kommentare (75)