Dieser Text ist ziemlich lang. Am 12. April 2018 findet an der Universität Jena eine Podiumsdiskussion statt. Einer der Teilnehmer werde ich sein und es wird über Wissensvermittlung diskutiert. Um vorab schon mal meine Gedanken zu sortieren und auch um Feedback aus der Leserschaft zu bekommen, das ich dann auch in die Diskussion einfließen lassen kann, möchte ich schon jetzt ein wenig dazu schreiben. Wenn ihr nicht alles lesen wollt, ist das ok. Aber springt dann vielleicht nach der Einleitung zu den Fragen am Schluss – denn ich bin sehr an dem interessiert, was eurer Meinung nach auf dieser Podiumsdiskussion besprochen werden sollte. Und dazu brauche ich euer Feedback.
Einleitung: Ein “March for Science” macht noch keine Wissenschaftskommunikation
Als im letzten Jahr überall auf der Welt Menschen im Rahmen des “March for Science” öffentlich für Wissenschaft demonstriert haben, habe ich mich dazu auch in meinem Blog geäußert. Damals habe ich geschrieben:
“Es können noch so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überall auf der Welt durch die Straßen der Städte spazieren: Solange der Rest der Gesellschaft sich nicht dafür interessiert, hat das ganze keinen Effekt. Veranstaltungen wie der “March for Science” sind wichtig, können ihre Wirkung aber nur entfalten, wenn es auch ein entsprechendes Publikum gibt. Und die Wissenschaft hat eben das – dank fehlendem Einsatz für die Öffentlichkeitsarbeit selbst verursachte – Problem dass sich große Teile der Gesellschaft nicht für das interessieren, was sie tut. Das lässt sich nicht durch eine einzelne Veranstaltung lösen sondern nur durch dauerhafte Arbeit.”
Dieser Meinung bin ich immer noch; und noch viel mehr als damals. Der “March for Science” ist 2018 durchaus eine genau so wichtige Veranstaltung wie er es 2017 war. Aber es ist meiner Meinung nach auch naiv zu glauben, mit solchen Aktionen könne man wirklich einen relevanten Teil der Öffentlichkeit dauerhaft erreichen. Vor allem kann man Menschen mit solchen Aktionen nicht dauerhaft für die Wissenschaft faszinieren und das ist es, worauf es ankommt!
Es gibt zwei grundlegende Probleme bei der Vermittlung von Wissenschaft. Zuerst einmal ist da die starke Trennung zwischen “der Öffentlichkeit” und “der Wissenschaft”. Die Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung haben die Welt in der wir leben massiv geprägt und werden das in Zukunft nur noch stärker tun. Das ändert aber nichts daran, dass die meisten Menschen keinen Bezug zur Arbeit der Wissenschaftler haben. Das was Forscherinnen und Forscher in den Universitäten treiben ist für den großen Rest der Welt unsichtbar. Das mag uns, die wir selbst Wissenschaftler sind oder aus anderen Gründen regelmäßig damit zu tun haben, seltsam erscheinen. Aber wir leben in einer Filterblase – für die meisten Menschen spielt Wissenschaft schlicht und einfach keine Rolle. Ich treffe zum Beispiel jeden Tag Menschen die im Handel arbeiten oder Menschen die an Behörden angestellt sind. Ich sehe Sportlerinnen und Sportler im Fernsehen und ich werde detailliert darüber informiert, was Politikerinnen und Politiker treiben. In den Fernsehserien ist alles voll mit Ärzten, Werbegrafikern, Polizisten, und so weiter. In meiner Familie gibt es Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, Interessen und Tätigkeiten – aber nirgendwo Wissenschaftler. Hätte ich nicht selbst studiert und würde ich mich nicht seit Jahren täglich mit Wissenschaft beschäftigen, dann hätte ich heute genau so wenig Kontakt zur Welt der Forschung wie es der große Rest der Menschen hat.
Diese Trennung macht es schwierig zu vermitteln, was die Wissenschaft treibt und warum sie wichtig ist. Denn bevor man das tun kann, muss man die Trennung erst einmal überwinden! Das muss ich nicht tun, wenn ich über etwas anderes reden; zum Beispiel Sozialreformen. Auch wer noch nie in seinem Leben arbeitslos oder auf Hartz-IV angewiesen war, ist über diese Themen zumindest grundlegend informiert und hat dazu eine Meinung. Wenn es aber um Wissenschaft geht, dann muss man es zuerst einmal schaffen, die Menschen dazu zu bringen, einem zuhören zu wollen! Selbst das beste und informativste Angebot an Wissensvermittlung bringt nichts, wenn die Leute nicht einmal auf die Idee kommen, dass sie so etwas interessieren könnte und das es sie interessieren sollte.
Wissenschaft muss im Alltag stattfinden
Das ist das erste grundlegende Problem. Das zweite hat damit zu tun, wie Wissenschaft auch heute immer noch viel zu oft vermittelt wird. Das passiert auf eine Art und Weise, die die Trennung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit oft nur noch verstärkt anstatt sie aufzulösen. Die klassischen Angebote der Wissenschaftsvermittlung sind immer asymmetrisch: Auf der einen Seite steht “Die Wissenschaft” und sie spricht über die gesellschaftliche Kluft hinweg zum “gemeinen Volk”. Bei klassischer Wissenschafts-PR (das, was euphemistisch immer gerne “Wissenschaftskommunikation” genannt wird) ist das besonders gut zu sehen. Da gibt es Pressemitteilungen, in denen Organisationen irgendwas verlautbaren. Es gibt öffentliche Vortragsreihen, in den Wissenschaftler reden. Es gibt Podiumsdiskussionen, es werden Zeitungsartikel geschrieben, und so weiter. Und wenn man das gut macht (was nicht immer der Fall ist), dann findet sich dafür auch ein Publikum. Das ist dann aber immer ein Publikum, dass sich prinzipiell schon für Wissenschaft interessiert.
Das ist ein wichtiger Punkt! Es gibt eine gewisse Menge an Leuten, die keine Vorurteile gegenüber der Wissenschaft haben; die keine “Angst” haben, das Wissenschaft zu kompliziert ist um für sie unverständlich zu sein. Genau diese Leute sind es, die zu öffentlichen Vorträgen kommen, die populärwissenschaftliche Bücher über Wissenschaft kaufen, etc. Für diese Menschen muss die Wissenschaft selbstverständlich ein ausreichendes Angebot bereit halten. All die Bücher, Vorträge, Zeitungsartikel, etc sind wichtig (was der Grund ist, warum ich auch beständig dazu beitrage) – aber sie dürfen nicht alles sein. Denn dann hat man kaum eine Chance, auch den Rest der Menschen zu erreichen.
Genau darum sollte es aber der Wissensvermittlung verstärkt gehen. Fast jede Forschungseinrichtung hat mittlerweile genug Angebote für wissenschaftsinteressierte Menschen; die Buchläden sind voll mit populärwissenschaftlichen Büchern; im Internet gibt es jede Menge Blogs oder Videokanäle zu Wissenschaft. Das kann und soll so bleiben (und gerne noch mehr werden), aber worauf man sich wirklich konzentrieren sollte, ist die Suche nach Möglichkeiten, auch die Menschen zu erreichen, die man bis jetzt nicht erreicht hat.
Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie sich für Wissenschaft interessieren.
Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. Diesen Satz habe ich schon oft geschrieben und gesagt und je länger ich mit Wissensvermittlung beschäftige, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass er richtig ist. Wissenschaft hat das Potential die Menschen genau so zu faszinieren wie das Musik, Kunst, Kultur, Literatur, Sport, etc tun. Nur haben viele Leute aus verschiedensten Gründen alle möglichen Vorurteile. Würde ich einen Bekannten fragen, ob er Lust hat, mit zu einem Konzert zu kommen, würde er vielleicht zustimmen, auch wenn er keine Ahnung hat, um welche Band es geht. Einfach nur, weil er aus Erfahrung weiß, dass so ein Live-Konzert ziemlich cool sein kann und ihm die Band vielleicht gut gefällt. Würde ich aber fragen, ob er mit mir zu einem wissenschaftlichen Vortrag geht, stehen die Chancen gut, dass er ablehnt und mir erklärt, dass er von Wissenschaft ja eh nichts versteht und das nur ein komplizierter und langweiliger Abend würde. Aber wenn man es schafft, Menschen irgendwie über diese Schwelle und in Kontakt zur Wissenschaft zu bringen, dann merken sie fast immer, dass auch Wissenschaft enorm faszinierend ist (vorausgesetzt, sie wird vernünftig vermittelt natürlich).
Das war übrigens genau der Grund, aus dem die Science Busters entstanden sind, bei denen ich nun seit fast drei Jahren mitmache. Der Physik-Professor Heinz Oberhummer hatte den Wunsch (und die Fördermittel), Wissenschaft unter die Menschen zu bringen. Aber ihm war auch klar, dass man dazu eben erst einmal genau die Vorurteile überwinden muss, die so viele haben. Und deswegen hat er gemeinsam mit dem Kabarettisten Martin Puntigam ein Wissenschaftskabarett (Auch wenn man unter “Kabarett” in Deutschland meist etwas leicht anderes versteht als in Österreich, sträube mich immer noch, dafür den Begriff “Comedy” zu verwenden – denn so viel was unter diesem Label in Deutschland gezeigt wird, ist einfach grauenhaft) entwickelt. Ins Kabarett gehen die Leute gerne. Die meisten haben keine prinzipielle Abneigung dagegen, einen potentiell amüsanten Abend in einem Theater o.ä. zu verbringen. Und wenn diese Leute dann im Theater sitzen, kriegen sie auch Kabarett – aber eben Kabarett mit Wissenschaft. Und wenn es vorbei ist, haben sie einen amüsanten Abend verbracht und dabei etwas über Wissenschaft gelernt.
Anders gesagt: Wenn man Wissenschaft vermitteln will, dann muss man die Wissenschaft zuerst irgendwie in den Alltag der Menschen quetschen. Nur dann schafft man es, die bestehenden Vorurteile zu überwinden. Und natürlich ist mir klar, dass regelmäßige Theaterbesuche für viele Leute genauso wenig zum Alltag gehören wie der Besuch wissenschaftlicher Vorträge bei anderen. Aber die Sache mit dem Kabarett ist nur ein Ansatz von vielen.
Bleiben wir wieder beim “March of Science”. So etwas ist natürlich eine Aktion, die prinzipiell sehr viel Aufmerksamkeit bringt. So wie im letzten Jahr werden auch dieses Jahr sicherlich wieder viele Medien darüber berichten. Forscherinnen und Forscher werden überall auf der Welt auf die Straßen gehen und die restlichen Menschen werden ihnen dabei zusehen. Und vielleicht merken sie dabei auch, dass da eine Welt voll faszinierender und wichtiger Dinge existiert, die bisher in ihrem Leben kaum eine Rolle gespielt hat. Nur: Wie viel bleibt davon übrig, wenn der “March of Science” vorüber ist und die Wissenschaftler wieder in ihren Unis verschwunden sind? Am Ende war es wieder “Die Wissenschaft” auf der einen Seite, die kurzfristig im Alltag “Der Öffentlichkeit” auf der anderen Seite aufgetaucht ist.
Aber das reicht nicht. Zumindest dann nicht, wenn man an einer nachhaltigen Vermittlung von Wissenschaft interessiert ist. Dann muss man Wege finden, wie die Wissenschaft dauerhaft und sichtbar im Alltag der Menschen verankert werden kann. Das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert und nichts, was man mit einfachen und einmaligen Aktionen hinbekommt. Es ist auch nichts, wofür mir spontan ein Patentrezept einfallen würde.
Das Unbehagen der Universitäten angesichts der Öffentlichkeit
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich an der grundlegenden Situation so lange nichts ändern wird, solange die Forschungseinrichtungen nicht das Unbehagen verlieren, dass sie immer noch viel zu oft zu haben scheinen, wenn es um den Kontakt mit der Öffentlichkeit geht. Ein Beispiel: Schaut man sich die Homepage der Uni Jena, dann gibt es dort eine Seite mit “Nachrichten aus der Forschung”. Solche Seiten haben so gut wie alle Unis, und so gut wie bei allen Unis wird auch die der Uni Jena vermutlich von der Mehrheit der Leute ignoriert werden. Wer nicht von sich aus auf die Idee kommt, sich über aktuelle Forschung an der Uni zu informieren, wird dieser Seite vermutlich nie begegnen (Übrigens: Selbst wenn man auf dem Laufenden bleiben will, wird es einem oft schwer gemacht, wenn – wie in diesem Fall – etwa kein Feed existiert, den man abonnieren könnte). Aber selbst wenn man irgendwie auf die Meldungen stößt, dann findet man dort so etwas wie diesen Bericht (war zufällig heute die aktuellste Meldung). Darin geht es um Therapien bei potentiell tödlichen Pilzinfektionen, wie sie als Komplikation nach Operationen auftreten können. Jetzt haben Wissenschaftler festgestellt, dass unser Immunsystem auf einen Teil des Pilzes reagiert, bei dem man das bisher nicht vermutet hatte. Das ist durchaus sehr relevant und die Ergebnisse der Forschung würden vermutlich auch viele Leute interessieren. Aber diese “Neuigkeit aus der Forschung” ist meiner Meinung nach halt komplett ungeeignet, bei irgendwem Faszination für die Forschung hervor zu rufen.
Nicht das man mich falsch versteht: Was klassische Uni-PR angeht, ist diese Meldung weder schlecht noch außergewöhnlich. Es ist genau das, was man in unzähligen Pressemitteilungen unzähliger Forschungseinrichtungen finden kann und in jeder Menge Zeitungsartikel über aktuelle Forschung. Aber meiner Meinung nach kann man so etwas durchaus besser machen. Nehmen wir diesen Absatz: “Besonders eindrucksvoll demonstriert Dr. Betty Hebecker, eine weitere Autorin des Nature-Artikels, diese internationale Zusammenarbeit. Sie fertigte ihre Doktorarbeit am Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie in Jena an. Im Anschluss wechselte sie ausgestattet mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft als Postdoc in Gordon Browns Gruppe nach Aberdeen.”
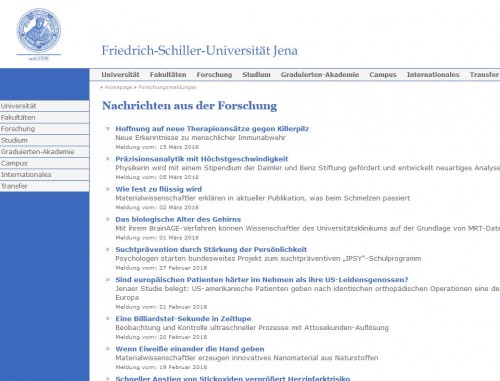
Wissenschaft lässt sich auch anders präsentieren… (Screenshot: https://www.uni-jena.de/Forschungsmeldungen.html)
Es ist nicht überraschend, dass die Uni Jena herausstellen möchte, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu der Arbeit beigetragen haben (das ist ja genau der Zweck von institutioneller PR aka “Wissenschaftskommunikation”). Aber wenn Frau Hebecker etwas schon “besonders eindrucksvoll” demonstriert: Wieso liest man dann in der Meldung nicht mehr von ihr? Wer ist Betty Hebecker, was hat sie nach Jena gebracht? Warum hat sie über diesen Pilz geforscht, wie hat sie ihr Stipendium bekommen und warum wollte sie nach Aberdeen gehen? Wieso hat sie sich überhaupt dafür interessiert, (Infektions)Biologie zu studieren? Wie ist ihre Arbeit zu diesem Thema gelaufen? Auf welche Schwierigkeiten ist sie gestoßen und wie hat sie sie überwunden? Welche Fragen will sie in Zukunft erforschen und warum? Und so weiter… Das wären alles Dinge gewesen, die mich interessiert hätten. Stattdessen gibt es eher wenig aussagekräftige Statements eines Jenaer Professors der Dinge sagt wie ” Wir sind sehr froh über das europaweite Netzwerk erfahrener Forscher, das die verschiedenen Teilaspekte von Pilzinfektionen auf molekularer Ebene untersucht und das gewonnene Wissen zusammenführt. Die erfolgreiche Bekämpfung von Infektionen ist nur noch über Nationengrenzen hinweg möglich.”
Ein europaweites Netzwerk erfahrener Forscher ist ja durchaus gut. Aber egal wie erfahren die Forscher und europaweit das Netzwerk ist: Das alles wird nicht dafür sorgen, dass ich mich als Person von dieser Meldung direkt angesprochen fühle. Die Universität verlautbart hier etwas und erklärt mir, dass ihre Wissenschaftler wichtige Sachen gemacht haben. Das ist ok – aber ich kann nicht mehr tun, als diese Verlautbarung zur Kenntnis zu nehmen. Ich will auch nicht mehr tun. Der Stil der Nachricht ist maximal abstrakt gehalten und mir ist zwar klar, dass irgendeine konkrete Person ihn verfasst haben muss; von dieser Person merkt man aber überhaupt nichts. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, die Nachricht zu kommentieren (was ich nicht habe), dann hätte ich keine Veranlassung, das zu tun. Was sollte ich mit der “Universität Jena” bereden? Ich will mit Menschen reden und nicht mit Institutionen! Hätte Frau Dr. Hebecker einen Text über ihre Arbeit geschrieben (und ich sag sicherheitshalber dazu, dass ich ihr natürlich keinesfalls vorwerfe, das nicht getan zu haben – siehe dazu weiter unten) und hätte sie darin über die Dinge gesprochen, die ich vorhin erwähnt habe: Dann hätte man dort genau die gleichen wissenschaftlichen Informationen transportieren können. Man hätte darüber hinaus aber auch noch transportiert, dass hier eine konkrete Person über ihre ganz konkrete Arbeit spricht. Arbeit, die ihr manchmal leicht fällt und manchmal nicht. Arbeit, bei der Probleme auftauchen die gelöst werden muss. Eine Person, die sich überlegt hat, ihren Wohn- und Arbeitsort zu wechseln, und so weiter. Eine Person also, die jede Menge Sachen macht und erlebt hat, die ich auch gemacht und erlebt habe. Selbst wenn man kein Wissenschaftler ist, kann man sich in so einem Fall viel leichter mit der Wissenschaft auseinandersetzen, weil man sie von einer Person präsentiert wird und nicht von einer unpersönlichen Institution. Ich hätte dann im Kommentarbereich (sofern vorhanden) vielleicht ein paar Fragen an Frau Hebecker gestellt. Frau Hebecker hätte sie mir beantwortet und ich hätte mich gefreut, mit einer Expertin persönlich kommunizieren zu können. Andere Leute hätten das vielleicht auch getan und vielleicht hätte ich dann auch mit denen über die Forschungsarbeit diskutiert. Am Ende hätten wir das gehabt, was eigentlich das Ziel der Wissenschaftskommunikation sein soll: Menschen die keine Wissenschaftler sind, aber trotzdem miteinander und mit den Wissenschaftlern über Wissenschaft diskutieren!
Die Unis müssen die Menschen sein, aus denen sie bestehen
Ich weiß, mir fällt es leicht, so etwas zu fordern. Ich schreibe seit zehn Jahren genau auf diese Weise über Wissenschaft. Wenn ich hier in meinem Blog schreibe, dann tue ich das als ich selbst und meine Texte sind im Allgemeinen immer so verfasst, dass man mich und meine Meinung dazu finden kann. Sie sind ganz explizit subjektiv, aber das ist volle Absicht. Denn – und auch das habe ich im Laufe meiner Arbeit als Wissenschaftsautor immer wieder erlebt – es ist eben viel einfacher, Menschen zur Diskussion zu bewegen, wenn da tatsächlich auch ein Mensch ist, den sie ansprechen können! Jetzt habe ich das Glück, einen relativ anarchistischen Zugang zur Wissenschaftsvermittlung folgen zu können. Ich bin selbstständig, ich habe keine Vorgesetzten und keine Institution, die ich vertreten muss. Ich schreibe einfach über das, was ich erzählen will und ich tue das so, wie ich das möchte. Ich habe aber auch durchaus Erfahrung mit dem, was auf Universitäten typischerweise so passiert. Ich habe jahrelang selbst an verschiedenen Unis gearbeitet und danach immer wieder mal im Rahmen meiner selbstständigen Tätigkeit Forschungseinrichtungen in Sachen Wissenschaftskommunikation beraten, Workshops gehalten, etc. Und bin dabei immer wieder auf das gestoßen, was ich vorhin das “Unbehagen angesichts der Öffentlichkeit” genannt habe.
Wenn ich in Workshops zum Wissenschaftsbloggen an Unis Mitarbeiterinnen und Studenten erkläre, wie sie ihre Artikel verfassen können, dann ermuntere ich sie immer auch dazu, selbst echte Texte zu schreiben, die dann auch im Rahmen des Workshops als Gastartikel in meinem Blog veröffentlicht werden. So würden die Leute sehr schnell wertvolles echtes Feedback echter Leserinnen und Leser kriegen. Aber vielen bereitet diese Vorstellung Unbehagen (was interessant sind, weil sie sich ja extra dazu entschieden haben, an einer Veranstaltung zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit teilzunehmen). Sie sind sich unsicher, was sie denn jetzt genau schreiben “dürfen” und wen sie eventuell vorab noch informieren müssen. Sie machen sich Sorgen, wie die Kollegen und Vorgesetzten reagieren, wenn sie als Person öffentlich auftreten und über Wissenschaft reden. Und wenn dann ganze Institutionen involviert sind (zum Beispiel wenn ich gefragt werde, wie man ein Institutsblog o.ä. einrichtet), wird es wirklich schwierig. Da kann kaum irgendwas getan werden, ohne das ganze Hierarchien von Leuten involviert sind. Da kann man nicht einfach einen Artikel schreiben und ihn veröffentlichen. Der muss dann gegengelesen werden, kommentiert werden, korrigiert werden, genehmigt werden, und so weiter. Und am Ende kommt ein dann eben irgendein vielleicht durchaus informatives aber extrem unattraktives und unpersönliches Stück Text heraus, das von der Öffentlichkeit weitestgehend ignoriert wird.
Ich habe jetzt ziemlich lange über Pressemitteilungen und Blogs geredet. Das sind natürlich sehr spezielle Wege der Wissensvermittlung, aber das, was ich hier gesagt habe, gilt auch allgemein. Ursprünglich war die Frage ja: Wie kriegt man die Wissenschaft in den Alltag der Menschen hinein? Die Antwort darauf weiß ich immer noch nicht, aber ich weiß, dass man es nicht schaffen wird, wenn man Wissenschaft weiter so unpersönlich präsentiert. Solange die Trennung zwischen “Der Wissenschaft” und “Der Öffentlichkeit” existiert, kommt man nicht weiter. Aber Wissenschaftler sind ganz normale Menschen, die halt nur einen Job machen, den die meisten anderen Menschen nicht so wirklich verstehen. Aber das macht nichts, wenn man die Kommunikation auf der menschlichen Ebene beginnen kann! Denn dann können zwei Menschen miteinander reden und dann kann man anfangen, Wissenschaft zu vermitteln.
(Übrigens: Ein sehr schönes Projekt das genau in diese Richtung geht, ist “Plötzlich Wissen”, über das ich an anderer Stelle noch einmal ausführlich berichten werde)
Mein Vorschlag an alle, die Wissenschaft vermitteln wollen lautet also: Werdet sichtbar! Und zwar als die Personen, die ihr seid – nicht als anonyme Verfasser irgendwelcher neutraler Texte. Und ja, es geht bei der Vermittlung von Wissenschaft natürlich um die Wissenschaft. Ich kann das Unbehagen verstehen, dass viele befällt, die einfach nur über ihre Forschung reden wollen und nicht über sich selbst. Aber es muss ja auch niemand komplett transparent und zur öffentlichen Person werden. Aber alle die in der Forschung tätig sind, sind das, weil sie fasziniert davon sind. Irgendetwas hat all die Menschen dazu gebracht, jahrelang an Unis zu lernen während andere schon längst “normale” Jobs haben und Geld verdienen. Irgendwas hat die Menschen dazu gebracht, die Unannehmlichkeiten und langen Arbeitstage auf sich zu nehmen um forschen zu können. Und ich möchten ihnen sagen: Wollt ihr Menschen vermitteln will, warum Wissenschaft faszinierend ist, dann müsst ihr eure Faszination vermitteln. Mit neutralen Pressemitteilungen erreicht man das nicht. Die Universitäten müssen sich trauen, die Menschen zu sein, aus denen sie bestehen anstatt sich hinter der neutralen Fassade einer Institution zu verstecken!
Erlaubt Wissenschaftskommunikation!
Und das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber was ich bis jetzt geschrieben habe, ist natürlich alles ein wenig naiv und idealistisch. Die Wissenschaftskommunikation läuft ja nicht deswegen so ab, wie sie es tut, weil alle Beteiligten zu dumm sind, es anders zu machen. Sondern weil die universitären Strukturen so sind, wie sie sind. Und wer da öffentlich sichtbar “zu viel” Zeit mit der Vermittlung von Wissenschaft verbringt, muss sich durchaus immer noch fragen lassen, ob man denn überhaupt noch Zeit für die Forschung habe, wenn man so viel anderen Kram macht. Für Engagement in der Wissenschaftskommunikation gibt es keinen Eintrag auf der Publikationsliste und man erhöht damit nicht seine Chancen auf die nächste PostDoc-Stelle. Und natürlich wollen weder alle Wissenschaftler direkt mit der Öffentlichkeit über ihre Forschung kommunizieren, noch können das alle vernünftig tun. Ich schlage selbstverständlich nicht vor, dass in Zukunft alle Forscherinnen und Forscher genötigt werden sollen, sich mit Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen. Aber die, die es wollen und können, sollten die Möglichkeit dazu haben, ohne das es ihrem Ansehen und ihrer Karriere schadet.
Es sollte Geld dafür vorhanden sein, solche Leute auch vernünftig zu bezahlen. Anstatt eine PR-Abteilung zu beschäftigen, die “Neuigkeiten aus der Forschung” veröffentlicht, die an der Öffentlichkeit vorüber gehen, könnte man die Ressourcen nutzen um Wissenschaftler animieren und es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit selbst und persönlich vorzustellen. Bessere PR als jede Menge Forscherinnen und Forscher die begeistert mit der Öffentlichkeit über ihre Arbeit sprechen, kann eine Universität gar nicht kriegen. Und diejenigen Forscherinnen und Forscher, die dieses Angebot annehmen, sollten dadurch keine schlechteren Karrierechancen haben. Will man Wissenschaft nachhaltig an die Öffentlichkeit vermitteln, dann braucht es Menschen, die aus den Unis heraus kommen und mit den Menschen in der Öffentlichkeit reden.
Fragen an die Menschen
Jetzt hab ich ziemlich viel geschrieben – aber bin noch gar nicht auf die Fragen eingegangen, die auf der Podiumsdiskussion diskutiert werden sollen. Laut Ankündigung sind das dieser hier:
- Wie denken PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, StudientInnen und MedienvertreterInnen über Autonomie und Freiheit von Wissenschaft und Forschung?
- (Wie) Soll die Öffentlichkeit mit Prinzipien und Werten der Wissenschaft vertraut gemacht werden, gerade bei kontroversen Themen und Zweifeln an wissenschaftlichen Befunden?
- Welche Handlungsstrategien in Bezug auf Diversity, Integration und Gleichstellung sind vorhanden und erfolgversprechend durchsetzbar?
- Welche Problemlösungen bieten Wissenschaft, Politik und Medien konkret an – international, auf Bundes-, Landes- und Lokalebene?
Mit Frage Nr. 1 kann ich wenig anfangen. Entweder ich verstehe sie nicht ganz, oder sie ist einfach viel zu vage formuliert. Wie soll ich denn über Autonomie und Freiheit der Wissenschaft denken? Ich denke, dass es gut ist, dass sie existiert und dass die Wissenschaft ihre Arbeit nicht mehr erledigen kann, sollte sie nicht mehr autonom und frei sein.
Bei Frage 2 irritiert mich das eingeklammerte “Wie”. Selbstverständlich SOLL die Öffentlichkeit auch über kontroverse Themen und Zweifel an wissenschaftlichen Befunden informiert werden. Alles andere wäre Irrsinn! Alles andere würde all die Vorurteile nur noch viel mehr befeuern! Die Menschen müssen die Wissenschaft kennenlernen, so wie sie ist, nicht so wie sie in der Erfolgsgeschichten von Lehrbüchern und Pressemitteilungen präsentiert werden. Das erreicht man einerseits durch all das, was ich weiter oben so ausführlich erklärt habe: Man soll nicht nur über die Forschung reden, sondern auch über die Menschen die sie gemacht haben und darüber, WIE sie die Forschung gemacht haben. Und idealerweise redet man nicht über die Menschen, sondern lässt sie selbst darüber reden. Frage 2 fasst eigentlich das, was ich weiter oben kritisiert habe, recht gut zusammen. “Die Wissenschaft” fragt sich hier, ob man es verantworten kann, “Die Öffentlichkeit” mit kontroversen Themen zu belasten. Das klingt so wie Eltern, die darüber diskutieren, ob sie irgendein Thema mit ihrem Kind besprechen sollen oder ob es dafür nicht vielleicht noch zu dumm ist. Genau diese elitäre Haltung ist es, die so viele Probleme bei der Wissenschaftsvermittlung verursacht.
Frage 3 ist einerseits komplex, andererseits auch wieder nicht. Ich hab keine Ahnung, welche “Strategien” die Institutionen oder die Politik haben. Aber wenn man sichtbar machen will, wie divers und integrativ die Wissenschaft ist, dann zeigt das eben! Lasst Frauen in der Öffentlichkeit über ihre Forschung reden, und je mehr Frauen das tun, desto mehr junge Mädchen werden sehen, dass das ein möglicher Karriereweg für sie sein kann. Und so weiter… Natürlich braucht es noch viel mehr, aber abgesehen davon, dass das etwas, was eher die Politik und die Medien angeht, kann ich aus Sicht der Wissenschaftskommunikation nur sagen: Ermöglicht und animiert möglichst viele Menschen dazu, in der Öffentlichkeit sichtbar sein zu können und über ihre Forschung reden zu können – dann wird auch die Diversität der Wissenschaft sichtbar und je sichtbarer sie wird, desto integrativer und diverser wird auch ihre Zukunft sein.
Frage 4 verstehe ich nicht, weil nicht angegeben ist, welches Problem es denn ist, das gelöst werden soll. Da ich auch weder “Wissenschaft”, noch “Politik” oder “Medien” bin sondern nur ich selbst, fühle ich mich da auch nicht wirklich angesprochen. Die Probleme die ich sehe, habe ich in meinem Artikel ausführlich dargelegt und auch die Lösungen die mir dafür einfallen.
Was mich jetzt aber zum Abschluss noch interessieren würde: Was würdet ihr denn gerne wissen oder zu der Diskussion beitragen? Ihr, also die Leserschaft, seid ja “Die Öffentlichkeit” um die es geht (zumindest ein Teil davon). Wenn ich am 12.4. dann mit den ganzen Politikerinnen, Ministern, Professoren und Wissenschaftlerinnen auf der Bühne sitze: Was sollte da eurer Meinung nach angesprochen werden?

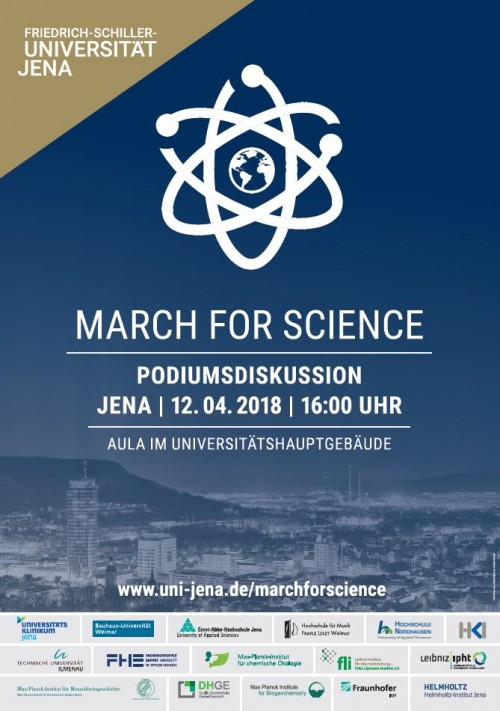






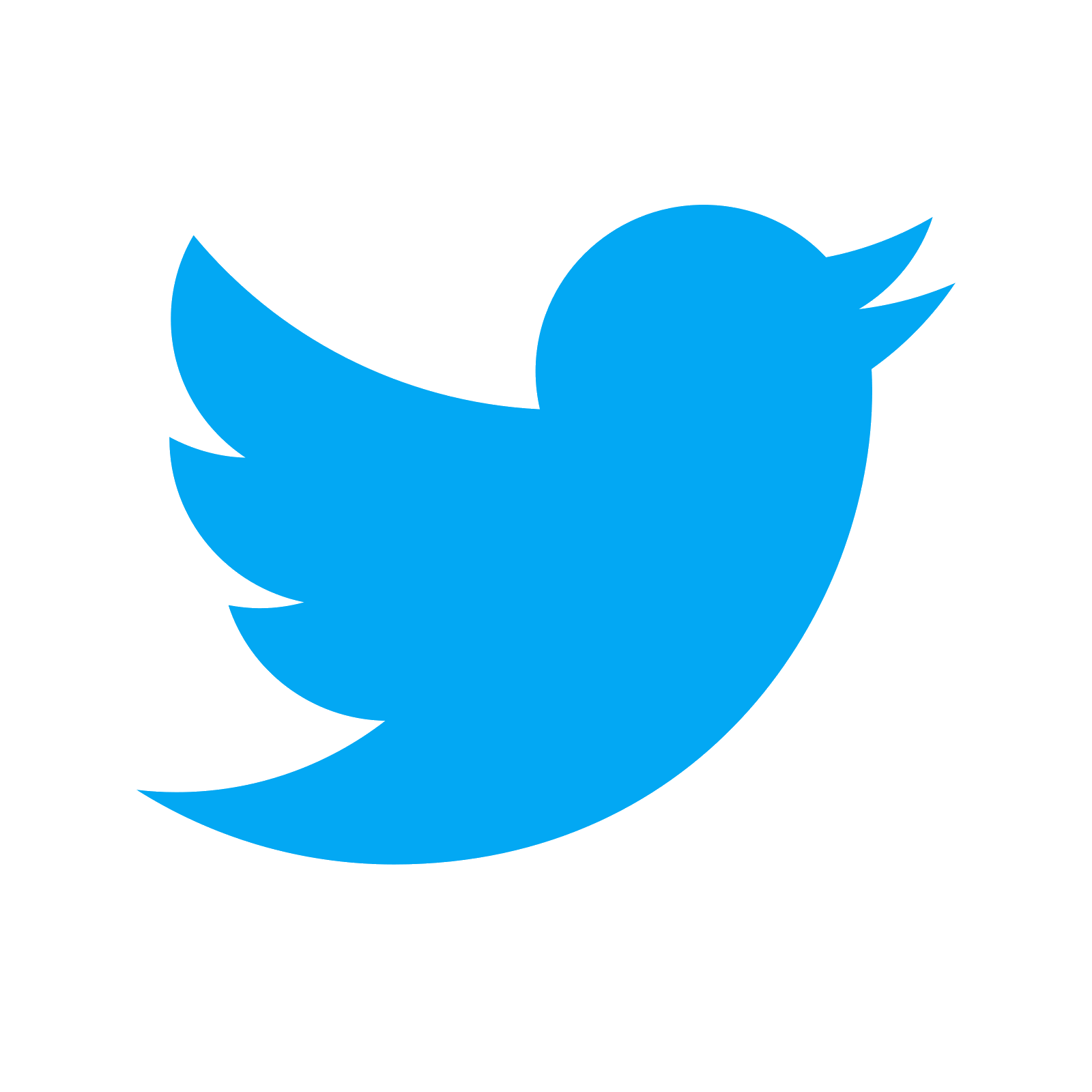

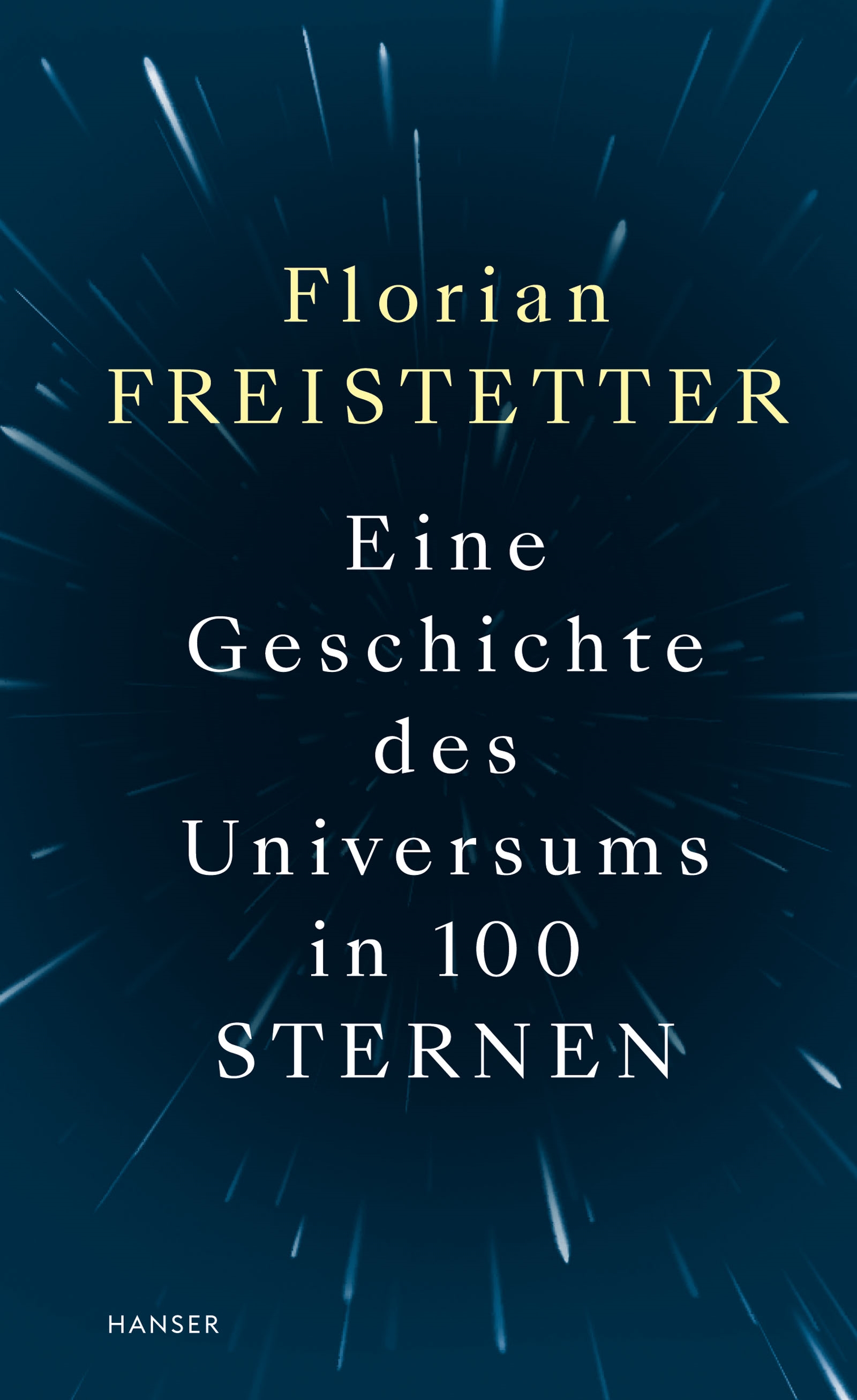
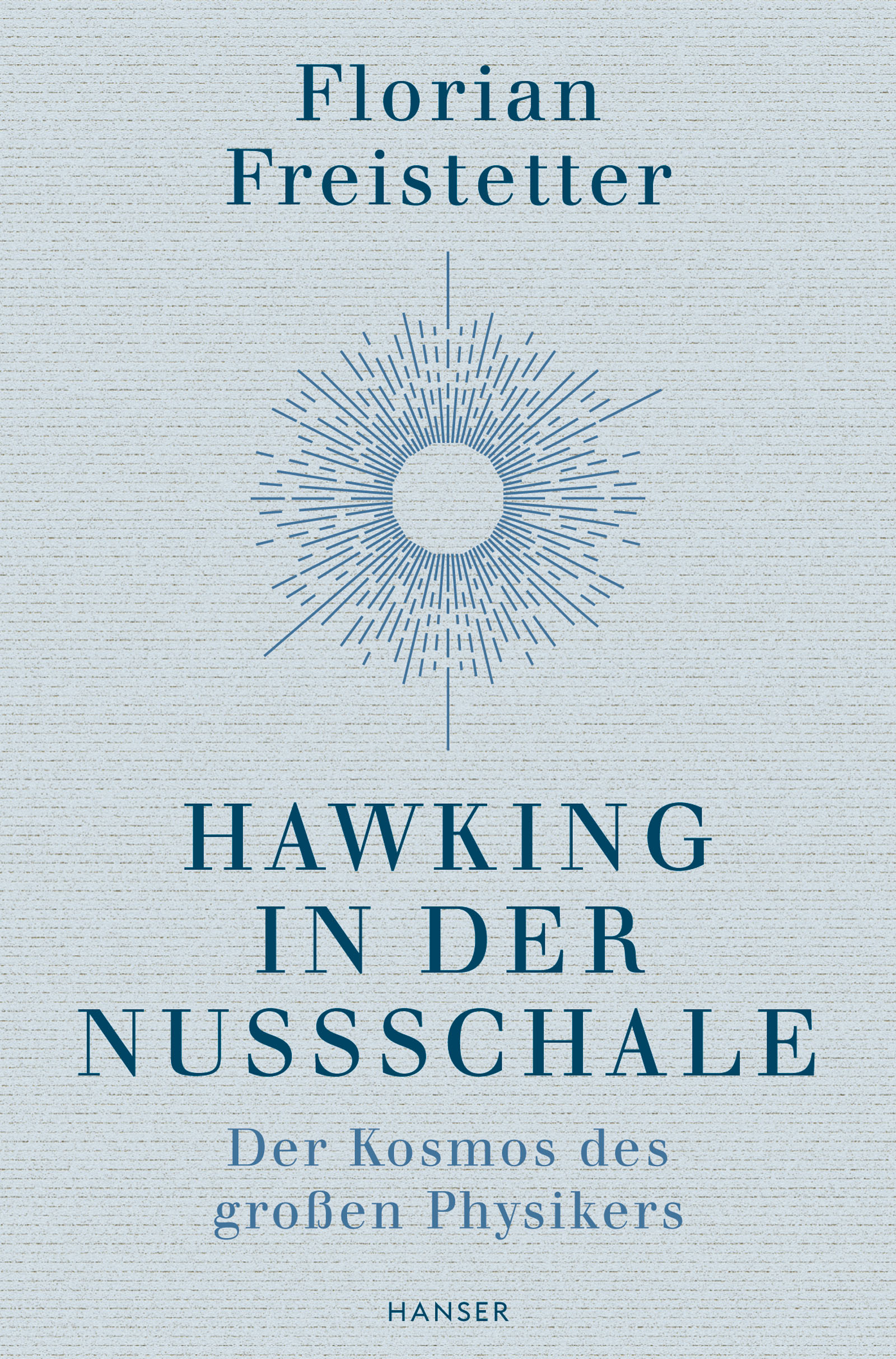
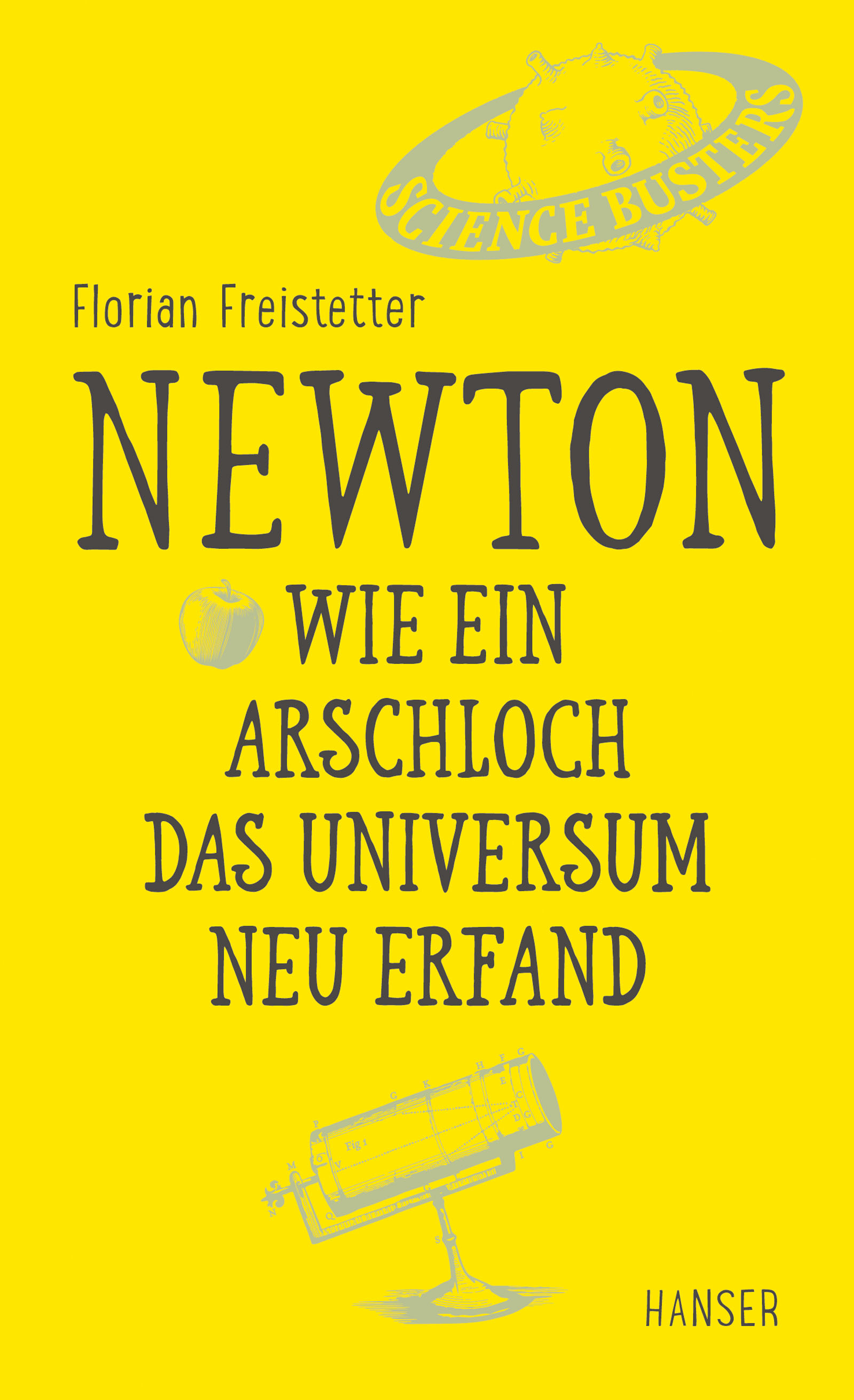
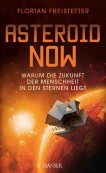

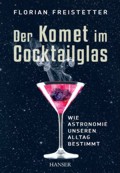
Kommentare (215)