Nur ein Jahr nach der englischen Erstveröffentlichung ist “Die verflixte Mathematik der Demokratie” jetzt auch auf Deutsch im Springer-Verlag erschienen.
Das englische Original, bei Princeton University Press, hieß Numbers Rule: the vexing mathematics of democracy from Plato to the present.
Die Mathematik der Demokratie – wie der Titel vermuten läßt, geht es um verschiedene Wahlsysteme und letztlich darum, weshalb es keine perfekten Abstimmungsmechanismen geben kann. Die Vor- und Nachteile vieler Abstimmungsverfahren werden diskutiert – dabei spielen Mathematik und Zahlen natürlich immer eine große Rolle, aber (um dies vorwegzuschicken) die Mathematik im Titel braucht und sollte niemanden vom Lesen abschrecken: man benötigt keinen Mathematik-Leistungskurs, um den Erläuterungen zu folgen; alles was an Mathematik gebraucht wird ist das Rechnen mit und Vergleichen von (meist ganzen) Zahlen, also Formeln wie 51>49>24. (Ausnahme vielleicht die Kapitel 11 und 12, in denen es um Axiomatisierung und um ganzzahlige Optimierung geht.)
Das Buch ist chronologisch gegliedert und widmet viel Platz den Personen hinter den jeweiligen Verfahren. In den meisten Kapiteln geht es jeweils um einen Menschen, dessen Biografie zunächst ausführlich dargestellt wird (es muß wohl Zufall sein, daß alle bekannten Wahlsysteme von Menschen mit sehr ungewöhnlichen Biografien entwickelt wurden), um dann das von ihm vorgeschlagene Abstimmungsverfahren und seine Vor- und Nachteile gegenüber anderen Verfahren zu beschreiben.
Im ersten Kapitel “Der Anti-Demokrat” geht es um Platon und seine Vorstellungen vom Staat, speziell seine Abneigung gegenüber einfachen Volksabstimmungen. Kapitel 2 ist den Römern gewidmet und wie Plinius (vergeblich) versuchte in einem Strafprozeß statt dreier Alternativen (Tod, Verbannung, Freispruch) durch Auswahl zweier Alternativen das gewünschte Ergebnis zu erreichen.
Nach diesen Ausflügen in die Klassik geht es dann ab Kapitel 3 wirklich zum Thema, nämlich Wahlverfahren, die komplizierter sind als die bei den Griechen üblichen einfachen Mehrheitsentscheidungen. Bis vor kurzem hätten Historiker geglaubt, daß die Beschäftigung mit Wahlverfahren erst zur Zeit der französischen Revolution einsetzte, inzwischen weiß man es durch Quellenfunde in der Vatikanischen Bibliothek besser: schon im 13. Jahrhundert hat Ramon Llull im Roman “Blanquerna” (der in einem Kloster spielt) ein Verfahren zur Wahl der Äbtissin beschrieben: jede Kandidatin tritt gegen jede andere an, bei 7 Kandidatinnen also 7×6/2=21 Abstimmungen, im Prinzip wie in der Fußball-Bundesliga, aber natürlich ohne Heim- und Auswärtsspiel. Gewählt ist die Kandidatin mit den meisten Siegen.
Auch in einem früher als der Roman geschriebenen (und 1959 wiederentdeckten) Traktat hatte Llull dieses Verfahren schon erläutert und dabei auch diskutiert, wie ein Unentschieden im ‘Zweikampf’ zu werten ist.
Llull beeinflußte auch Nikolaus von Kues (eigentlich Nikolaus Krebs), um den es im 4. Kapitel geht und von dem die einzige erhaltene Abschrift von Llulls Buch stammt. In Kapitel 36-37 von De Concordantia Catholica hat er sich dann selbst mit dem Problem gerechter Wahlen befaßt und kam zu einem anderen Vorschlag: die Wahlmänner sollten jeweils Wahlzettel mit einer Reihenfolge der Kandidaten erstellen und daraus ergibt sich dann ein Gesamtergebnis. Im Gegensatz zu den von Llull angestrebten offenen Wahlen hielt Cusanus geheime Wahlen für gerechter.
Im 5. Kapitel geht es um Borda, der im 18. Jahrhundert (bereits vor der französischen Revolution, nämlich in einem Vortrag 1770, veröffentlicht 1781) die Methode von Cusanus wiederentdeckte – als Antwort auf das von ihm aufgeworfene Problem, daß bei mehreren zur Wahl stehenden Kandidaten das Mehrheitswahlrecht nicht immer zum richtigen Ergebnis führt.
Bordas Gegner war Condorcet, die Hauptperson von Kapitel 6. Nach ihm ist das Condorcet-Paradoxon benannt, eine Situation, in der kein Wahlergebnis die Mehrheit der Wähler zufriedenstellen wird: was immer man auswählt, es gibt eine Mehrheit, die etwas anderes vorziehen würde. Solche Situationen sind natürlich manipulationsgefährdet, denn die Auswahl des Abstimmungsverfahrens wird das Ergebnis stärker beeinflussen als wenn ohnehin eine Mehrheit derselben Meinung ist. Concordat, der sein Paradoxon 1785 veröffentlicht hatte, gründete 1793 eine Zeitschrift, die die Bürger über eben diese Gefahren aufklären sollte. Letztlich kam er dort zu einem Wahlverfahren, das genau dem von Llull (dessen Traktat Condorcet natürlich nicht kannte) vorgeschlagenen Verfahren entspricht.
Im 7. Kapitel geht es dann um einen bekannten Mathematiker, Pierre-Simon Laplace, der in seiner 1812 veröffentlichten “Théorie analytique des probabilités” (und schon seit 1795 in Vorlesungen) die ‘Manipulierbarkeit’ der Borda-Wahl aufdeckte und stattdessen im Prinzip das heute noch bei französischen Parlaments- und Präsidentenwahlen angewandte Prinzip der absoluten Mehrheit (in einem eventuell notwendigen zweiten Wahlgang) vorschlug.
Das 8. Kapitel widmet sich Charles Dodgson, bekannter unter dem Pseudonym Lewis Carroll als Autor von ‘Alice im Wunderland’, der sich sich im Zusammenhang mit Abstimmungen über Personalentscheidungen seines Colleges mit dem Thema beschäftigt und auch eine Abhandlung darüber geschrieben hat, die inhaltlich eine Variation der Methoden von Condorcet und Borda ist.
Soweit ging es um Historisches und um eher simple Verfahren. In den folgenden Kapiteln kommen dann aber auch noch aktuell verwendete Wahlverfahren vor und die Frage, wie gerecht sie sind. Die amerikanische Verfassung fordert, daß mindestens 30000 Bürger auf einen Vertreter im Repräsentantenhaus kommen (und jeder Staat mindestens einen Vertreter hat). Das läßt viel Spielraum, im Gegensatz zur alles genau regelnden Schweizer Verfassung. Im 9. und 10. Kapitel geht es darum, wie diese Verfassunsregeln historisch umgesetzt wurden und heute umgesetzt werden. (Wir hatten über die mathematische Gerechtigkeit amerikanischer Präsidentenwahlen hier schon mal geschrieben.)
Mathematiker haben sich (schon seit Euklid, aber vor allem in den letzten 100 Jahren seit Hilbert) nicht nur mit der Entwicklung von Rechenverfahren, sondern vor allem mit dem Aufbau von Theorien aus Axiomen und ggf. mit Unmöglichkeitsbeweisen für Lösungen verschiedener Probleme befaßt. Da blieb es dann natürlich nicht aus, daß auch eine Axiomatisierung demokratischer Prozesse versucht wurde. Eine sehr einfache Axiomatik stellte Kenneth Arrow in seinem Buch “Social Choice and Individual Values” auf: er postulierte zwei Axiome, wie Menschen Entscheidungen treffen und fünf Anforderungen an eine “gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion”, deren Maximierung das Ziel demokratischer Prozesse sein solle. Und bewies dann, daß es unmöglich ist, einen allgemeinen Mechanismus der Entscheidungsfindung anzugeben, der seinen (sehr natürlichen) Anforderungen genügt. Das und auch verschiedene Ansätze, Entscheidungsmechanismen für etwas schwächere ‘Axiomensysteme’ zu finden, wird in Kapitel 11 (“Die Pessimisten”) diskutiert.
Um einen anderen Unmöglichkeitsssatz geht es in Kapitel 12, nämlich das “Apportionment Paradox”. Dabei geht es um Paradoxa, die durch das notwendige Runden auf ganze Zahlen entstehen, wenn Parlamentssitze auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden. Balinski und Young haben 1982 mit Methoden der ganzzahligen Optimierung bewiesen, daß es kein Quotenverfahren geben kann, welches das Wählerzuwachsparadox vermeidet.
Nachdem man dann also gelernt hat, daß perfekte Demokratie unmöglich ist, werden im letzten Kapitel schließlich noch drei Fallstudien aktueller Demokratien(die Schweiz, Israel und Frankreich) diskutiert und auch noch zwei weitere häufig genutzte Verfahren, nämlich die übertragbare Einzelstimmgebung und die Wahl durch Zustimmung.
Diese Inhaltsangabe der einzelnen Kapitel vermittelt einen sehr unvollständigen Eindruck vom Stil des Buches. In Wirklichkeit kommt der Autor keineswegs so direkt (wie es meine Zusammenfassungen oben vielleicht nahelegen) zu seinen Themen, sondern benutzt die Personen und die politischen Umstände als Aufhänger, um ein sehr detaillreiches Bild der jeweiligen Epochen zu zeichnen, aufgelockert durch viele mehr oder weniger relevante Anekdoten. Manchmal gerät man dabei dann auch schon mal vom Hundertsten in Tausendste, etwa wenn man im 10. Kapitel über Marston Morse erfährt
Als Mitglied der zweiten NAS-Kommission könnte man sagen, dass auch Morse die Kontinuität zur ersten herstellte, da er der erste Ehemann der zweiten Frau von William Osgood war, der in der ersten NAS-Kommission tätig war, dann aber davon zurücktrat.
und das (sicher auch durch die neuen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung im Internet ermöglichte) überbordende Ausmaß zusätzlicher Informationen zu den einzelnen Akteuren verstellt sicherlich schon (zumindest beim ersten Lesen) ein wenig den Blick aufs Wesentliche.
So geht es im zweiten Kapitel sehr ausführlich um den Untergang von Pompeji – mit dem eigentlichen Thema des Kapitels, dem römischen Rechtssystem, hat das aber nur insofern zu tun, daß es dabei um eine von Plinius geleitete Abstimmung geht und daß derselbe Plinius als Geschichtsschreiber die Katastrophe von Pompeji für die Nachwelt beschrieben hat. Im vierten Kapitel wird zunächst die Geschichte des Konstanzer Konzils 1414-1418 (die Absetzung dreier konkurrierender Päpste und Wahl von Martin V) und kurz auch der fast 3 Jahre dauernden Papstwahl 1268-1271 erzählt – mit beiden hatte Cusanus zwar nichts zu tun, aber vielleicht haben sie ihn ja beim Wunsch nach einer effektiven Wahlmethode motiviert. Man weiß es nicht.
Aber man liest das Buch ja auch nicht, um sich zum Experten in der Bewertung von Wahlverfahren ausbilden zu lassen. Auf jeden Fall ist “Die verflixte Mathematik der Demokratie” ein unglaublich faktenreiches Buch, aus dessen Lektüre man nicht nur etwas über die verschiedenen Wahlverfahren, sondern auch sehr viel über Geschichte, Politik, Wissenschaft und die handelnden Personen lernen kann.
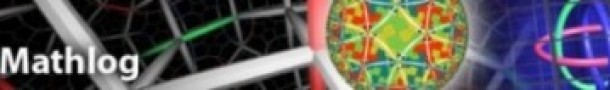

Kommentare (11)