Als Modell bezeichnet man in der Mathematik ein Modell eines Axiomensystems. Beispielsweise ist die Geometrie der euklidischen Ebene ein Modell des euklidischen Axiomensystems. Wenn man auf das Parallelenaxiom verzichtet, ist auch die Geometrie der hyperbolischen Ebene ein Modell des übrigbleibenden Axiomensystems. Die Existenz eines Modells beweist die Widerspruchsfreiheit eines Axiomensystems.
In der Modelltheorie als Teilgebiet der mathematischen Logik geht es um Beziehungen zwischen den rein formalen Ausdrücken einer Sprache (syntaktische Ebene) und deren Bedeutung (semantische Ebene). Unter anderem will man Modelle für ein vorgegebenes Axiomensystem konstruieren und bestimmen, wie viele (nichtisomorphe) Modelle eines Axiomensystems es gibt. In ihrer heutigen mathematischen Formulierung geht die Modelltheorie auf Alfred Tarski zurück, der 1936 in seiner Arbeit „Über den Begriff der logischen Folgerung“ einen formalen (statt umgangssprachlichen) Betriff von logischer Folgerung definierte: die Aussage X folgt genau dann logisch aus den Aussagen der Klasse K, wenn jedes Modell der Klasse K zugleich ein Modell der Aussage X ist.
Im Nachhinein kann man manche der in den 30er Jahren schon bekannten Sätze der mathematischen Logik als Sätze der Modelltheorie interpretieren. Der Gödelsche Vollständigkeitssatz besagt, dass jede syntaktisch konsistente Theorie (also jede Menge von geschlossenen Formeln, aus der kein logischer Widerspruch herleitbar ist) ein Modell hat. Der aus dem Satz von Tichonow folgende Kompaktheitssatz der mathematischen Logik besagt, dass ein unendliches Axiomensystem genau dann ein Modell hat, wenn jedes endliche Teilsystem ein Modell hat. Der Satz von Löwenheim-Skolem besagt darüber hinaus, dass jede Theorie in einer abzählbaren Sprache der Prädikatenlogik, die überhaupt ein unendliches Modell hat, auch ein Modell jeder unendlichen Kardinalität hat.
Modelltheorie ist eine Kombination aus universeller Algebra und Logik. Man startet mit einer Sprache aus Symbolen für Operationen, Konstanten und Relationen und sucht dann nach Modellen für diese Sprache. Zum Beispiel ist der Körper der rationalen Zahlen (ebenso wie jeder andere Ring) ein Modell für die Sprache {+,x,0,1}. In der Logik erster Ordnung hat man dann zusätzlich noch Variablen, Junktoren, Quantoren und ein Gleichheitszeichen. Damit kann man Terme, Formeln und Sätze definieren. Die zentrale Frage der Modelltheorie ist dann, welche Sätze in einem Modell richtig sind. Eine Menge von Sätzen ist eine Theorie und man fragt, ob ein gegebenes Modell ein Modell dieser Theorie ist.
Abraham Robinson, der ursprünglich bei der britischen Luftwaffe über Deltaflügel für Überschallströmungen gearbeitet hatte, zeigte in Arbeiten seit den späten 40er Jahren, dass man Methoden der Logik zur Lösung von Problemen in Analysis und Algebra anwenden kann. Er entwickelte grundlegende Begriffe der Modelltheorie und zeigte damit, dass es eine konsistente Nichtstandard-Analysis gibt, also ein Modell der Axiome der reellen Zahlen mit Ausnahme des archimedischen Axioms, das unendliche und infinitesimale Zahlen enthält. Das ermöglicht nicht nur eine anschauliche Beschreibung grundlegender Begriffe wie Grenzwerte, Differential und Integral, sondern hat auch zahlreiche Anwendungen in Maßtheorie, Stochastik und Funktionalanalysis.
In den 60er Jahren wurde die Modelltheorie zu einem nützlichen Werkzeug. Morley gab eine Definition für den Rang einer Formel in einem Modell, als Verallgemeinerung der Krull-Dimension algebraischer Varietäten. Damit konnte er zeigen, dass eine Theorie mit einem Modell überabzählbarer Kardinalität auch ein Modell jeder anderen überabzählbaren Kardinalität haben muß. Für algebraische Strukturen kann man ihren Morley-Rang definieren als Rang der Formel x=x. (Zum Beispiel haben einfache algebraische Gruppen über algebraisch abgeschlossenen Körpern endlichen Morley-Rang und man vermutet, dass für unendliche Gruppen auch die Umkehrung gilt.) Daraus entwickelte sich dann Shelahs Stabilitätstheorie.
Keisler bewies 1961, dass zwei Modelle genau dann elementar äquivalent sind, wenn es einen Ultrafilter gibt, so dass die entsprechenden Ultraprodukte isomorph sind. Sein Beweis benutzte allerdings die verallgemeinerte Kontinuumshypothese. Die Kontinuumshypothese besagt, dass die Mächtigkeit der Potenzmenge der Menge der natürlichen Zahlen die erste überabzählbare Kardinalszahl ist, es also keine dazwischenliegenden Kardinalitäten gibt. Sie war 1878 von Cantor aufgestellt worden, war 1900 das erste der Hilbertschen Probleme gewesen und 1939 hatte Gödel gezeigt, dass sie im Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem mit Auswahlaxiom widerspruchsfrei ist (wenn diese Axiome widerspruchsfrei sind). Paul Cohen bewies 1963, dass auch ihre Verneinung widerspruchsfrei ist, dies war das erste spektakuläre Unbeweisbarkeitsresultat der Mathematik. Cohen erhielt dafür 1966 die Fields-Medaille. Die von ihm für diesen Beweis entwickelte Erzwingungsmethode hatte enormen Einfluß auf die Entwicklung der axiomatischen Mengenlehre, und dann auch auf die Modelltheorie. Die Idee war, dass man jedem Modell M der Mengenlehre eine Menge G hinzufügen kann, so dass wieder ein Modell der Mengenlehre entsteht. Dieser Erzwingungsoperator M——->M[G] bildet beispielsweise die Axiome der Körpertheorie auf die Theorie der algebraisch abgeschlossenen Körper – die Modellvervollständigung – ab. Gödel hatte 1938 ein Modell der Zermelo-Frenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom konstruiert, in dem die Kontinuumshypothese gilt. Mit Cohens Methode bekam man viele weitere Modelle, insbesondere solche, in denen die Kontinuumshypothese nicht gilt. Deshalb ist die Kontinuumshypothese aus den Axiomen der Mengenlehre nicht entscheidbar.
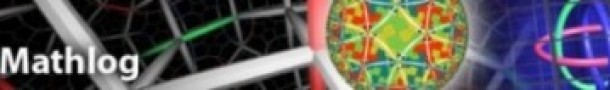

Kommentare (1)