Wäre er noch am Leben gewesen, hätte keine ausgefeilte ästhetische Theorie mich schützen können – nicht vor einer Verleumdungsklage, nicht vor seinem Zorn.
Daniel Kehlmann: Wo ist Carlos Montufar? Über Bücher. Rowohlt, 2005.
Die Vermessung der Wirklichkeit
So (Zitat oben) beschreibt Daniel Kehlmann in einem Essay seine Gedanken, als er (erst) kurz vor Ende der Arbeit an seinem Roman “Die Vermessung der Welt” zum ersten Mal Gauß’ Wirkungsstätte – die Göttinger Sternwarte – betrat.
Ein Erzähler operiert mit Wirklichkeiten. Aus dem Wunsch heraus, die vorhandene nach seiner Vorstellung zu korrigieren, erfindet er eine zweite, private, die in einigen offensichtlichen Punkten und vielen gut versteckten von jener ersten abweicht. […] Zum Beispiel, die unerwartete Konfrontation mit einer sehr realen Maschine, entwickelt von jemandem, den er in manchen Augenblicken bereits für seine eigene Erfindung hielt.
In der Sternwarte habe er die Telegraphenanlage besichtigt, die in einer Szene des Romans vorkommt, wo der gebrechlich gewordene Gauß mit seinem Mitarbeiter Weber über diese Anlage kommuniziert, dabei aber eigentlich mehr mit sich selbst und mit bereits verstorbenen Kollegen spricht. Vor der Anlage stehend wird ihm unmittelbar klar, dass es solche Szenen nicht gegeben haben kann. Der Ausschlag der Nadel ist so schwach, dass der Empfänger ihn nur wahrnehmen würde, wenn er ihm – etwa durch einen Boten – vorher angekündigt worden wäre. Spontane Gedankensplitter eines alten Mannes konnten so also nicht übertragen werden, jedenfalls hätte sie niemand gehört. Kehlmann blieb für den Roman trotzdem bei seiner Version.
Narrativisierung in Journalismus und Forschung
Ende Dezember löste die Relotius-Affäre des SPIEGEL eine Diskussion über “schöpferischen Journalismus” (Alexander Wendt) aus. Im Nachhinein schien es eigentlich klar, dass diese Geschichten “von einer Glätte, Perfektion und Detailbesessenheit” (Giovanni di Lorenzo) waren, dass sie so eigentlich nicht passiert sein konnten. Dass es eigentlich nicht glaubhaft war, wenn Relotius etwa in den USA ein 99-jähriges Mitglied der Weißen Rose fünf Stunden lang interviewt haben wollte und diese dabei über die aktuellen Ereignisse in Deutschland auf dem Laufenden gewesen sei und diese mit passenden Kommentaren versieht. Oder wenn er in einer Kriegsreportage noch die genaue Anzahl der in einen bestimmten Keller führenden Stufen anzugeben vermag: 15. (Im SPIEGEL-Artikel über Relotius nach dessen Enttarnung wurde sogar dessen genaue Büronummer 09-161 erwähnt. Anscheinend geben exakte Zahlen dieser Art Reportage eine besondere Glaubwürdigkeit.)
Für die Wissenschaftskommunikation stieß die Affäre des SPIEGEL in eine bereits existierende Diskussion. Julika Griem, Vizepräsidentin der DFG, hatte (noch wenige Wochen vor dem Bekanntwerden der Relotius-Affäre) auf dem Forum Wissenschaftskommunikation die “Narrativisierung und Eventisierung” der Forschung beklagt.
Ist ein Modus, mit dem Ereignisse nicht nur chronologisch, sondern auch kausal so angeordnet werden, dass eine Ordnung aus Anfang, Mitte und Ende und ein Fluchtpunkt der Auflösbarkeit und Schließung entsteht, wirklich der einzig geeignete zur Vermittlung wissenschaftlicher Komplexität?
(Die Rede ist online auf www.dfg.de/download/pdf/dfg im profil/reden stellungnahmen/2018/181107_keynote_fwk18_griem.pdf)
Dagegen wandte sich Tobias Maier vom Karlsruher Institut für Wissenschaftskommunikation (nach Bekanntwerden der Relotius-Affäre) auf weitergen.de/2018/12/keine-geschichten-mehr-relotius-und-wissenschaftskommunikation/ gegen diejenigen, “die es immer schon wussten” und nun meinten, dass “die Reportage […] als Format ausgedient hat.”
Wer als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler Zielgruppen jenseits der eigenen Fachcommunity erreichen will, muss lernen, die sachliche Wohlfühlecke zu verlassen. Eine gute Geschichte bleibt eine gute Geschichte. Sie soll das erzählen, was die Daten aussagen. Und wahr muss sie sein.
Wahr oder nicht wahr
Oft sind es gerade die zweifelhaften und unbelegten Geschichten, die die größte Wirkung entfalten und die größte Bekanntheit erlangen. Hat Thales wirklich den Ägyptern erklärt, wie die Höhe der Cheops-Pyramide zu bestimmen sei? Mußte Carl Friedrich Gauß wirklich als Neunjähriger im Schulunterricht die Zahlen von 1 bis 100 addieren? Hat Hilbert schon 1891 von Tischen, Stühlen und Bierseideln gesprochen? Und stimmt es wirklich, dass er dem Minister Rust auf eine entsprechende Frage geantwortet habe, das Institut in Göttingen gebe es nicht mehr? (Für die erste Anekdote gibt es immerhin Hilberts eigene Bestätigung, für die zweite wohl nicht einmal das.) Hat Lorenz wirklich nur aus Versehen die letzten drei Nachkommastellen einzutippen vergessen? Glaubte Donaldson tatsächlich, er habe die Diagonalisierbarkeit aller positiv definiten, unimodularen quadratischen Formen bewiesen?
Das ist keine Mathematik!
In den 15 Beiträgen eines
2012 bei Princeton University Press unter dem auf Archimedes anspielenden Titel Circles disturbed. The interplay of mathematics and narrative. erschienenen Sammelbandes wird überwiegend mit viel Sympathie auf die Bedeutung von Narrativen für die Mathematik eingegangen. Allerdings wird in einem der Artikel (Theology and its Discontents: the Origin Myth of Modern Mathematics., urspr\”unglich verfa\ss t 2007 von Colin McLarty) auch die Geschichte und Herkunft eines “Gründungsmythos der modernen Mathematik” dekonstruiert.
Es geht um den Beweis des Basissatzes in der Invariantentheorie. Da hatte es im 19. Jahrhundert einen Erlanger Mathematiker gegeben, Paul Gordan, der ein Meister in der Manipulation langer algebraischer Ausdrücke war. Manche seiner Gleichungen erstreckten sich über mehrere Seiten. Und er soll sich angeblich komplett verweigert haben, als David Hilbert zu dieser Theorie dann einen algebraischen Zugang ganz ohne Rechnungen fand.
In der Invariantentheorie geht es um Invarianten von Polynomen, die unter linearen Transformationen invariant sind. Zum Beispiel ist für quadratische Polynome
Die weitere Geschichte nach Hilberts Entdeckung wird in verschiedenen Lehrbüchern wie auch populären wissenschaftsgeschichtlichen Werken so dargestellt, dass Gordan die neuen Methoden Hilberts rundweg abgelehnt habe und zu der ihm zugeschickten Arbeit nur lapidar meinte “Das ist keine Mathematik, das ist Theologie!”, womit er ihren Abdruck in den Mathematischen Annalen verweigert hätte. Erst später, als Hilbert mit seinen Methoden dann doch einen konstruktiven Algorithmus fand, habe er eingeräumt, dass “auch die Theologie ihre Verdienste” habe.
In C. Reids Hilbert-Biographie wird diese Geschichte dann auf eine Art ausgeschmückt (und mit Bewertungen versehen), die durchaus an die Reportagen Relotius’ erinnert.
A one-sided, impulsive man, Gordan was to leave a curiously negative mark upon the history of mathematics; but he had a sharp wit, a deep capacity for friendship, and a kinship with youth. Walks were a necessity of life for him. When he walked by himself, he did long computations in his head, muttering aloud. In company, he talked all the time. He liked to “turn in” frequently. Then, sitting in some cafe in front of a foaming stein of the famous Erlangen beer, surrounded by young people, a cigar always in his hand, he talked on, loudly, with violent gestures, completely oblivious of his surroundings. Almost all of the time he talked about the theory of algebraic invariants.
[…]
The reaction of some mathematicians was similar to what must have been the reaction of the Phrygians to Alexander’s “untying” of the knot. They were not at all sure that he had untied it. […] Gordan himself announced in a loud voice that has echoed in mathematics long after his own mathematical work has fallen silent: “Das ist nicht Mathematik. Das ist Theologie.” Hilbert had now publicly taken a position in the current controversy provoked by Kronecker over the nature of mathematical existence. Kronecker insisted that there could be no existence without construction. For him, as for Gordan, Hilbert’s proof of the finiteness of the basis of the invariant system was simply not mathematics.
In Wirklichkeit war es allerdings ganz anders. Gordan war von Hilberts Arbeit sehr angetan und wollte sie nur deshalb nicht sofort in den Annalen veröffentlichen, weil er kleinere Fehler fand, die zuvor korrigiert werden sollten. Der Vergleich mit der Theologie sollte gerade seine Bewunderung ausdrücken. In schriftlicher Form erschien das Zitat erst nach Gordans Tod als Randnotiz in einer Laudatio Max Noethers. Eine Reihe von Göttinger Mathematikern nahm es in den folgenden Jahrzehnten auf. Die Geschichte war einfach zu schön und es störte auch nicht, dass jeder sie etwas anders erzählte.
Ein Primzahlknochen
Vor dem Naturkundemuseum in Brüssel steht ein Denkmal für eines der im Museum verwahrten Exponate, einen Knochen mit Einritzungen, die in Gruppen zu 19, 17, 13 und 11 Strichen (oder 5, 14, 17, 13 und 11 Strichen, je nach Sichtweise) angeordnet sind. Der Knochen stammt aus dem Kongo, ist etwa zweiundzwanzigtausend Jahre alt, und es ist natürlich bemerkenswert, dass Menschen damals schon bis 19 gezählt haben sollen. (Wobei diese Deutung aber durchaus umstritten ist.)

In Brüssel geht man allerdings noch weiter und behauptet, dass dieser Knochen sogar schon eine Beschäftigung mit Primzahlen belegt – es könne ja kein Zufall sein, dass dort alle Primzahlen zwischen 10 und 20 vorkommen. Nun hat mensch nach Stand der historischen Forschung ungefähr vor 2500 Jahren begonnen, sich mit Teilbarkeit zu befassen und eine Beschäftigung mit Primzahlen vor mehr als 20000 Jahren ist ungefähr so plausibel wie die These, dass Fermat die Modularität elliptischer Kurven vorhergesehen hat – da er ja eine der Folgerungen schon kannte – oder Pythagoras die Definition metrischer Räume, aber man wird wohl auch das Gegenteil nicht beweisen können. Trotzdem ist die Geschichte vom Primzahlknochen keine gut erfundene: was soll man aus ihr lernen?
Eine Schulbuchreihe und ihre Geschichte
Der Lambacher-Schweizer ist vermutlich die am längsten bestehende Schulbuchreihe. Dessen Geschichte geht in den Sommer 1945 zurück, als die Alliierten Wilhelm Schweizer anfragten, neue – von politischen Inhalten bereinigte – Mathematiklehrbücher für die gymnasiale Mittelstufe zu verfassen. Gemeinsam mit Theophil Lambacher verfaßte Schweizer dann bis 1947 drei Bände, die sich inhaltlich stark am bis dahin verwendeten {em Kölling-Löffler} orientierten, freilich ohne dessen Sachaufgaben. In den Folgejahren bis 1952 wurde dann unter Mitarbeiter verschiedener Autoren die Lehrbuchreihe komplettiert. 1958 entschloß sich der Verlag, die Reihe neu herauszubringen, Schweizer wurde alleiniger Herausgeber und inzwischen blickt die Lehrbuchreihe auf eine dreistellige Zahl an Büchern von sehr viel mehr (aktuell 80) Autoren zurück.
Erstaunliches über die Entstehung dieser Reihe erfuhr man vor einigen Jahren aus einem 11 DIN A4-Seiten langen Interview mit einem damals 97-jährigen Emeritus, erschienen im Mitgliederblatt eines deutschen Fachverbandes.
Theophil Lambacher hatte nur die Lizenz beschafft, weil er politisch eine blütenweiße Weste hatte. Wilhelm Schweizer hingegen ist nach 1945 aus dem Schuldienst entfernt worden. […] Zu dem berühmten Lehrwerk hat Lambacher so gut wie nichts beigetragen.
In der nach dem Tod des Interviewten geschriebenen Übersetzung wurde der letzte Satz dann noch “verbessert” zu “He contributed nothing at all to the textbook mentioned above.”
Anders als beim Ishango-Knochen ist hier jedenfalls klar, was der Leser aus der Geschichte lernen soll. Aber – ebenfalls anders als beim Ishango-Knochen – läßt sich hier durchaus noch herausfinden, wie es wirklich gewesen ist. Zur Geschichte des “Lambacher Schweizer” gibt es eine von Jörg Stark recherchierte und 2011 vom Klett-Verlag herausgebrachte Broschüre mit einer Reihe von Original-Dokumenten (online auf
www.klett.de/sixcms/media.php/185/Festschrift_LS65_Internet.pdf). Aus diesen Dokumenten ergibt sich eine völlig andere Geschichte. Schweizer ist 1945 keineswegs aus dem Schuldienst entlassen worden. Er war seit 1943 in einem Forschungsprojekt beschäftigt und wurde gleich nach Kriegsende stellvertretender Schuldirektor. Nach seinen online vorliegenden Erinnerungen war es ein Vertreter eines vom neuen Kultusministerium eingesetzten Ausschusses, welcher ihn darum bat oder eher dazu drängte, neue Lehrbücher zu verfassen weil die alten “politisch verseucht” seien und von den Alliierten nicht genehmigt würden. Lambacher wurde also keineswegs (nur) benötigt, um die Lizenz zu erhalten, und dessen politische Haltung – er war Gründungsmitglied der lokalen CDU – spielte dafür auch keine Rolle. Und schließlich handelte es sich nicht um ein “textbook”, sondern eine ganze Buchreihe.
Alle lieben Maja
In Bayern wurden im Februar Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt, um Biotope im ländlichen Raum zu erhalten bzw. anzulegen und so die Artenvielfalt zu sichern – unter dem Slogan “Rettet die Bienen!”
Nun wird ja gerade das Symbolthema „Bienensterben“ gerne in den Bereich der Fake-News einzusortieren versucht. Einstein habe gar nicht – wie oft behauptet – gesagt, dass nach den Bienen auch der Mensch stirbt. Die für den Menschen wirklich wichtigen Pflanzen (Getreide) würden nicht von Bienen bestäubt. Nicht 50 Prozent der Bienen, sondern nur 6 Prozent der Bienenarten seien vom Aussterben bedroht, was sich dann noch – mathematisch sehr exakt bis auf die Nachkommastellen der Prozentzahlen – auf zehn verschiedene Gefährdungsstufen aufschlüsseln läßt. “Die Lüge vom Bienensterben” titelte die von Sven von Storch betriebene Online-Zeitung Freie Welt.
Den meisten Abstimmenden waren solche Feinheiten – unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt – offensichtlich egal. Anders als im vorherigen Abschnitt kann auch falsches in einem höheren Sinne wahr sein. Bei der Abstimmung ging es um mehr Hecken und Bäume, Kleingewässer und Blühwiesen. Die Biene war dafür nicht mehr als ein griffiger Slogan. Eigentlich ein ungeschickt gewählter, ist doch die Artenabnahme bei Tagfaltern oder Fluginsekten deutlich höher als bei den Honigbienen. Aber Biene Maja ist eben doch beliebter als Raupe Nimmersatt und das Ergebnis gibt den Initiatoren recht.

Der Schmetterlingseffekt
Bienenmetaphern in der Mathematik kenne ich keine, dafür gilt aber der Schmetterlingseffekt – der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien könne einen Hurrikan in Texas auslösen, oder ein in Shanghai umgekippter Sack Reis einen Tornado in Oklahoma – manchen als die “erfolgreichste Metapher der Wissenschaftsgeschichte”. Es gibt viele Varianten dieses Spruches, bemerkenswerterweise immer mit Schmetterlingen in Entwicklungsländern und Wirbelstürmen in Industrieländern. (Mir fällt dazu ein, dass regelmäßig Ende November Luftverschmutzung bei Beginn der Heizperiode in Peking zehn Tage später ganz unmetaphorisch zu Smog in Seoul führt.)
Der Effekt findet sich – ohne den Schmetterling – eigentlich schon bei Poincare in “Wissenschaft und Methode”.
Die Meteorologen sehen sehr wohl, dass das Gleichgewicht instabil ist, dass irgendwo ein Zyklon gebildet wird. Aber wo genau dort, das können sie nicht sagen; ein Zehntel Grad mehr oder weniger an einem bestimmten Punkt, und der Zyklon wird hier und nicht dort losbrechen und seine Verwüstungen über Gebiete bringen, die er sonst verschont hätte.
Und in einem zeitgenössischen Buch des Wissenschaftsphilosophen Pierre Duhem wurden Hadamards geschlossene Geodäten in jeder Homotopieklasse von Kurven auf einer negativ gekrümmten Fläche als Beispiel des Chaos und der Unberechenbarkeit angeführt: eine geringe Richtungsänderung im gleichen Startpunkt führt zu einem völlig anderen Verhalten. Duhem veranschaulichte das damals mit einer Zeichnung von Kurven auf einem Ochsenkopf, das dem nachempfundene Bild unten stammt aus dem Video https://youtu.be/yDAVwUHxmfw.

Diese Fragen kamen damals aber weder in die öffentliche Diskussion, noch spielten sie in der mathematischen Forschung eine zentrale Rolle, wo Stephen Smale Anfang der 60er Jahre zunächst zahlreiche schon zu Zeiten Poincares bekannte Effekte wiederentdeckte, um dann freilich mit dem Hufeisen und der Frage nach struktureller Stabilität über diesen hinauszugehen. Populär wurde das Chaos erst mit Edward Lorenz’ Geschichte vom falsch berechneten Wettermodell und eben dem Bild vom Schmetterlingseffekt.
Sicher lag es nicht nur an Lorenz’ Metapher vom Schmetterlingseffekt, dass die Theorie der dynamischen Systeme damals einen solchen Aufschwung nahm. Das Aufkommen der Computer, wodurch die mathematischen Effekte jetzt auch anschaulich begreifbar wurden, half zweifellos der Popularisierung. (Andererseits: Duhems Ochsenkopf hatte auch nichts anderes gezeigt als Lorenz’ Computerbilder.) Und innerhalb der Mathematik konnte man plötzlich auch das Chaos mathematisch berechnen. Zunächst mit dem Lorenz-Attraktor, gegen den jede Lösungskurve konvergiert, und dann mit den SRB-Ma\ss en (nach Sinai-Ruelle-Bowen), welche mutmaßlich die Orbiten beschreiben: man also zwar nicht ohne genaue Kenntnis der Anfangsbedingungen den weiteren Orbit eines Punktes berechnen kann, dafür aber zumindest eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie oft er sich langfristig in den einzelnen Bereichen des Attraktors aufhalten wird.

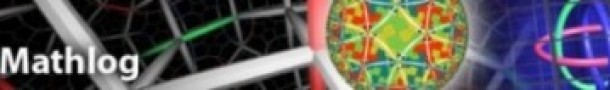


Kommentare (5)