Das 19. Jahrhundert war die goldene Zeit der projektiven Geometrie. Deren Entwicklung war ursprünglich von der École Polytechnique ausgegangen (Monge, Poncelet, …) und überhaupt war die hohe Wertschätzung der Geometrie auch in der dominierenden Rolle der darstellenden Geometrie an technischen Hochschulen begründet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte man dann nicht nur die euklidische, sondern auch die „nichteuklidische“ Geometrie (mittels des Beltrami-Klein-Modells) in die projektive Geometrie einbetten können und Felix Klein hatte in seinem Erlanger Programm die projektive Geometrie neben der Gruppentheorie als einheitlichen Rahmen aller Geometrien gesehen.
Es gab Sätze der projektiven Geometrie, in deren Beweisen Abstände vorkamen, die sich also nicht in der Sprache der projektiven Geometrie formulieren ließen. Ein solcher Satz ist der aus dem 4. Jahrhundert stammende Satz von Pappos: wenn sechs Punkte einer projektiven Ebene abwechselnd auf zwei Geraden g und h liegen, so liegen die im Bild gezeigten drei Schnittpunkte der sechs Verbindungsgeraden auf einer gemeinsamen Geraden.

Man kann diesen Satz beweisen, indem man in der projektiven Ebene die Gerade durch P7 und P9 als Gerade im Unendlichen auffaßt, womit sich das Schneiden in P7 und P9 als Parallelität der entsprechenden Geraden (in der euklidischen Ebene) manifestiert und man also die Parallelität der sich in P8 schneidenden Geraden beweisen muß. Das wiederum beweist man mit dem Strahlensatz und dessen Umkehrung, für den man die Verhältnisse von Streckenlängen benötigt. Diese sind aber keine projektiven Invarianten, nur das Doppelverhältnis ist eine projektive Invariante.
Ein anderes Beispiel ist der aus dem 17. Jahrhundert stammende Satz von Desargues: wenn sich die Verbindungsgeraden der korrespondierenden Eckpunkte zweier in einer projektiven Ebene liegenden Dreiecke in einem Punkt schneiden, so liegen die Schnittpunkte der entsprechend verlängerten Seiten auf einer Geraden.

Auch hier hat man einen ähnlichen Beweis, wo man die gewünschte Gerade als Gerade im Unendlichen auffaßt und dann Parallelität zweier Geraden beweisen muß, wofür man wieder den Strahlensatz und also die projektiv nicht invarianten Verhältnisse von Streckenlängen verwenden muß.
“Die Geometrie bedarf – ebenso wie die Arithmetik – zu ihrem folgerichtigen Aufbau nur weniger und einfacher Grundsätze. Diese Grundsätze heißen Axiome der Geometrie.” begann David Hilbert die Einleitung seines Bändchens über die “Grundlagen der Geometrie” (der er ein Zitat Kants – „So fängt denn alle menschliche Erkenntnis mit Anschauungen an, geht von da zu Begriffen und endigt mit Ideen.“ – vorangestellt hatte). Und weiter “Die vorliegende Untersuchung ist ein neuer Versuch, für die Geometrie ein vollständiges und möglichst einfaches System von Axiomen aufzustellen und aus denselben die wichtigsten geometrischen Sätze in der Weise abzuleiten, dass dabei die Bedeutung der verschiedenen Axiomgruppen und die Tragweite der aus den einzelnen Axiomen zu ziehenden Folgerungen möglichst klar zutage tritt.” Auch einst als selbstverständlich angesehene Tatsachen formulierte er als Axiome der Inzidenz, der Anordnung („wenn B zwischen A und C liegt, so liegt B auch zwischen C und A“ usw.) und der Stetigkeit.
Die „Grundlagen der Geometrie“ bestanden aus sieben Kapiteln:
I: Die fünf Axiomgruppen.
II: Die Widerspruchslosigkeit und gegenseitige Unabhängigkeit der Axiome.
III: Die Lehre von den Proportionen.
IV: Die Lehre von den Flächeninhalten in der Ebene.
V: Der Desarguessche Satz.
VI: Der Pascalsche Satz.
VII: Die geometrischen Konstruktionen auf Grund der Axiome I-IV.
Im zweiten Kapitel bewies Hilbert die Widerspruchsfreiheit der euklidischen Geometrie unter der Annahme, dass die Arithmetik der reellen Zahlen widerspruchsfrei sei, indem er nämlich aufbauend auf den Eigenschaften reeller Zahlen die Ebene R2 als Modell der euklidischen Geometrie betrachtete und aus dessen Existenz die Widerspruchsfreiheit der Axiome folgerte. (Die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik wurde erst 1936 von Gerhard Gentzen bewiesen.) Durch Hinzunahme eines „Vollständigkeitsaxioms“ – „Die Elemente (Punkte, Geraden, Ebenen) der Geometrie bilden ein System von Dingen, welches bei Aufrechterhaltung sämtlicher genannten Axiome keiner Erweiterung mehr fähig ist“ – wurde Hilberts Axiomensystem „optimal“ in dem Sinne, dass es keine kleineren Modelle gibt: jedes Modell muß isomorph zum R2 mit seinen Anordnungs-, Inzidenz- und Stetigkeitseigenschaften sein. (Die Erfüllbarkeit des Vollständigkeitsaxioms war durch das diesem vorangestellte Archimedische Axiom bedingt.) Die logische Unabhängigkeit der Axiome folgt aus der Existenz weiterer Modelle nach Weglassen einzelner Axiome, beispielsweise der Modelle der nichteuklidischen Geometrie nach Weglassen des Parallelenaxioms.
Diese im 19. Jahrhudert gefundenen nichteuklidischen Geometrien widersprachen nun freilich der von Immanuel Kant postulierten a-priori-Existenz des Raumes. Physikalisch orientierte Mathematiker wie Henri Poincaré vertraten dazu einen konventionalistischen Standpunkt. Die Existenz von Dreiecken aus Lichtstrahlen, deren Innenwinkelsumme kleiner als 180 Grad ist, ließe sich erklären durch eine nichteuklidische Geometrie des Raumes, aber auch dadurch dass Licht nicht auf Geodäten reist. Im zweiten Fall könnte der Raum immer noch flach sein. Poincaré schrieb später in seinem populärwissenschaftlichen Werk „Wissenschaft und Hypothese“, es gäbe keine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu entscheiden. Der Raum würde nur durch unsere Wahrnehmungen geschaffen.
Hilberts Schrift wurde schon damals als paradigmatisch für den modernen axiomatischen Stil der Mathematik angesehen. Die axiomatische Methode zur Grundlegung der Geometrie war bereits bei Moritz Pasch, einem Gießener Professor, und auch in anderen Arbeiten umrissen worden, Peano hatte sogar Paschs Arbeit in symbolische Logik übersetzt. Hilbert selbst ging es aber auch darum, spezifische Fragen zur inneren Architektur der Geometrie zu klären.
Insbesondere konnte er erklären, warum die Sätze von Pappos und Desargues sich nicht innerhalb der projektiven Geometrie beweisen lassen. So wie man einerseits über jedem Schiefkörper K und auch jedem „Zahlensystem“ (so nannte er Mengen mit Addition und Multiplikation, in denen jeweils Inverse und neutrale Elemente existieren und 0 ≠ 1 ist, aber Assoziativität und Kommutativität der Multiplikation nicht notwendig gelten müssen) eine projektive Ebene P2K definieren kann, so kann man umgekehrt auch jeder axiomatisch definierten projektiven Ebene ein Koordinatensystem in einem solchen „Zahlensystem“ zuordnen. Es stellt sich heraus, dass die geometrischen Eigenschaften einer projektiven Ebene von den algebraischen Eigenschaften dieses Zahlensystems abhängen. Hilbert bewies, dass in einer projektiven Ebene der Satz von Desargues genau dann gilt, wenn dieses „Zahlensystem“ assoziativ, also ein Schiefkörper ist, und dass der Satz von Pappos genau dann gilt, wenn der Schiefkörper kommutativ, also ein Körper ist.
Beide Sätze gelten also nicht für alle projektiven Ebenen, man kann sie insbesondere nicht aus der abstrakten Axiomatik der projektiven Ebene herleiten. (Bemerkenswerterweise gelten aber beide Sätze in jedem 3-dimensionalen projektiven Raum und sie haben dort auch einen projektiven Beweis.)
Wedderburn und Veblen zeigten später, dass in endlichen projektiven Geometrien der Satz von Pappos (und allgemeiner der Satz von Pascal) aus dem Satz von Desargues folgt (Satz von Wedderburn) und konstruierten projektive Geometrien, in denen beide Sätze nicht gelten. Der Beweis des Satzes über endliche projektiven Geometrien folgt aus dem von Wedderburn und Dickson bewiesenen algebraischen Satz, dass es keine nichtkommutativen endlichen Schiefkörper gibt, und es gibt für diesen Satz bis heute keinen geometrischen Beweis.
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_Hilbert,_c._1900.png
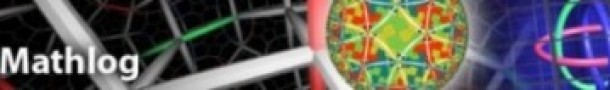

Kommentare (2)