In seinem 1879 erschienenen Buch “Kalkül der abzählenden Geometrie” hatte der Hamburger Gymnasialprofessor Hermann Schubert Methoden für Abzählprobleme der algebraischen Geometrie entwickelt. Seine Beweise beruhten auf dem “Prinzip der Erhaltung der Anzahl”: die Anzahl der Lösungen eines geometrischen Problems bleibe bei Deformationen erhalten; man könne also so deformieren, dass man ein einfach zu lösendes Problem bekommt.
Die Frage, wieviele Geraden (im projektiven Raum) vier gegebene Geraden l1,l2,l3,l4 schneiden, würde Schubert so beantworten: nach Deformation der Geraden könne man annehmen, dass l1 und l2 sich schneiden und ebenso l3 und l4. Dann gibt es genau zwei Lösungen, nämlich die Verbindungsgerade der beiden Schnittpunkte und die Schnittgerade der Ebenen durch l1,l2 mit der Ebene durch l3,l4. Diese Anzahl “Zwei” soll dann auch die allgemeine Lösung sein außer in speziellen Fällen, wo es unendlich viele Lösungen gibt.
Tatsächlich gibt es auch Fälle, wo die ersten drei Geraden windschief sind und wie im Bild eine aus Geraden gebildete “Regelfläche” bestimmen. Die Regelfläche schneidet die vierte Gerade in zwei Punkten, es gibt also auch in diesen Fällen – wie vom „Prinzip der Erhaltung der Anzahl“ postuliert – zwei Lösungen m1,m2. Es kann aber auch ausgeartete Fälle geben, wo die beiden Lösungen zusammenfallen – in Schuberts Buch wurden keine Vielfachheiten definiert.

Der Schubert-Kalkül beruht darauf, dass man die Lösungen geometrischer Probleme oft als Zykel in der Graßmann-Mannigfaltigkeit G(d,n), dem Raum der d-dimensionalen Unterräume im n-dimensionalen Raum, auffassen kann. Mehrere solcher Bedingungen zu stellen heißt dann die Schnittmengen der entsprechenden Zykel zu bestimmen.
Beispielsweise bilden diejenigen Geraden, die eine gegebene Gerade schneiden, einen Zykel in G(1,3). (Um in projektiven Koordinaten zu rechnen, kann man G(1,3) mittels Plücker-Koordinaten in den P5 einbetten. Das funktioniert ähnlich auch für höhere G(d,n).) Zu den vier Geraden l1,l2,l3,l4 bilden die jeweils eine von ihnen schneidenden Geraden also jeweils einen Zykel in G(1,3). Die alle vier schneidenden Geraden bilden dann den Durchschnitt dieser vier Zykel. Man will also die Anzahl der gemeinsamen Schnittpunkte dieser vier Zykel im G(1,3) bestimmen.
Schuberts Kalkül soll in heutiger Sprache solche Schnittzahlen von Zykeln in G(d,n) berechnen. Seinerzeit fanden die Algebraiker seine auf dem “Prinzip der Erhaltung der Anzahl” beruhenden Berechnungen kaum nachvollziehbar. Beispielsweise wurde erst mehr als dreißig Jahre nach Erscheinen von Schuberts Buch die dort geäußerte Behauptung bewiesen, dass es genau 92 Kegelschnitte gibt, die acht gegebene windschiefe Geraden schneiden.
Hilbert machte die mathematische Begründung des Schubert-Kalküls zu einem seiner 23 Jahrhundertprobleme. Die Geometer der italienischen Schule gaben später einige Gegenbeispiele zu Berechnungen aus Schuberts Buch. Severi, der innerhalb der italienischen Schule den topologischen Zugang zur algebraischen Geometrie propagierte, schrieb 1912 eine Arbeit „Il Principio della Conservazione del Numero“, wo er Vielfachheiten eindeutig definieren konnte. Das war ein erster Schritt zu einer formalen Grundlegung der algebraischen Geometrie und erlaubte in späterem Verständnis einen Abzählkalkül im Homologiering einer singularitäten-freien algebraischen Varietät.
Beim Schubert-Kalkül geht es um die Berechnung von Schnittzahlen, ein wichtiges technisches Problem war also die Entwicklung einer Schnitttheorie. Dieses Problem wurde von Solomon Lefschetz in Angriff genommen, einem in Paris aufgewachsenen und in die USA ausgewanderten Sohn aus Moskau stammender Eltern türkischer Staatsangehörigkeit, der als ausgebildeter Elektroingenieur in algebraischer Geometrie promoviert hatte und als Professor an der Universität Kansas die Anwendung der topologischen Methoden Poincarés in der algebraischen Geometrie entwickelte. „Es war mein Los, die Harpune der algebraischen Topologie in den Körper des Wals der algebraischen Geometrie zu pflanzen.„ schrieb er später.
Um die Schnittzahl zweier Untervarietäten X und Y zu definieren, betrachtete er lineare Systeme (also linear von Parametern abhängende Familien definierender Polynome, die zum Nullwert des Parameters die Untervarietät X definieren) und bewies, dass für generische Werte des Parameters t die Varietät Xt transversal zu Y und der Durchschnitt wieder eine Varietät der passenden Kodimension ist. Allerdings gab es dabei Probleme in Umgebungen von Singularitäten, weshalb er für seinen Beweis annehmen mußte, dass X und Y singularitäten-freie Varietäten sind. (Heute würde man das in der Kategorie der differenzierbaren Mannigfaltigkeiten beweisen und den Thomschen Transversalitätssatz verwenden, demzufolge X mittels einer beliebig kleinen Homotopie transversal zu Y gemacht werden kann.) Mit dieser generischen Transversalität konnte er dann insbesondere die Schnittzahl für Untervarietäten komplementärer Dimension definieren. (Heinz Hopf formulierte diese Definition später als ein Produkt auf Homologiegruppen. Lefschetz hatte den Begriff der Homologiegruppen noch nicht zur Verfügung, seine Definition gab deshalb zunächst nur eine Familie homologer Zykel.)

Die wichtigste Anwendung seiner Schnitttheorie wurde die Fixpunktformel. Dafür interpretierte er die Fixpunkte einer Abbildung f:X—>X als Schnittpunkte ihres Graphen mit der Diagonale (dem Graphen der Identitätsabbildung) im Produktraum XxX. Der Beitrag eines (isolierten) Fixpunktes x zur Schnittzahl (des Graphen und der Diagonale) ist ein gewisser “lokaler Fixpunktindex”

In der Summe über alle Fixpunkte
Wenn L(f)≠0, dann muss es mindestens einen Fixpunkt geben, da man ja auf der anderen Seite über die lokalen Fixpunktindizes der einzelnen Fixpunkte summiert.
Für die Identitätsabbildung f=Id und zu ihr homotope Abbildungen erhält man die Wechselsumme über die Dimensionen der Homologiegruppen, also die Euler-Charakteristik χ(X). Wenn χ(X)≠0, dann muß also jede zur Identität homotope Abbildung Fixpunkte haben.
Eine unmittelbare Folgerung ist beispielsweise, dass auf gerade-dimensionalen Sphären S2n nur Z/2Z fixpunktfrei wirken kann, da χ(S2n)≠0 und es nur zwei Homotopieklassen von Homöomorphismen der Sphäre gibt. Für die 2-Sphäre S2 hatten das zuvor Brouwer und Kérékjártó bewiesen.
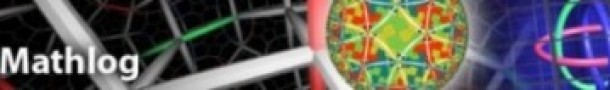

Kommentare (3)