Die Maxwell-Gleichungen beschreiben die Phänomene des Elektromagnetismus, man formuliert sie elegant mit Hilfe der Operatoren div, grad, rot aus der Vektoranalyis. Beispielsweise beschreibt
Die drei Operatoren der Vektoranalyis lassen sich mittels des folgenden kommutativen Diagramms alle als Spezialfälle des äußeren Differentials auf Differentialformen interpretieren, wobei # der mittels einer Riemannschen Metrik definierte Isomorphismus zwischen Vektoren und Kovektoren sowie * der Hodge-*-Operator ist:
Die Beziehung, dass ein divergenzfreies Vektorfeld eine Rotation und ein rotationsfreies Vektorfeld ein Gradient ist, ergibt sich dann unmittelbar aus dem Poincaré-Lemma im R3.
Differentialformen waren in der Mathematik seit dem Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder mal benutzt worden, etwa für die Beantwortung der Frage, wann ein Hyperebenfeld H einer n-dimensionalen Mannigfaltigkeit durch eine Blätterung integrierbar ist. Diese Frage hatte eine elegante Antwort, wenn man das Hyperebenenfeld in lokalen Koordinaten als Kern H=ker(α) einer 1-Form α beschreibt: H ist genau dann integrierbar, wenn α∧dα=0. (Dieser Satz wird Frobenius zugeschrieben, der aber meinte, er sei schon Jahrzehnte zuvor bekannt gewesen.) Das Hyperebenenfeld unten wird durch α=dz-xdy beschrieben und ist wegen α∧dα=dxdydz nicht integrierbar.

Élie Cartan hatte Differentialformen in seinem Buch über Integralinvarianten verwendet, ebenfalls nur in lokalen Koordinaten oder global für Lie-Gruppen. (Er hatte auch schon 1899 beobachtet, dass sich die klassischen Sätze von Green, Gauß und Stokes in Differentialformen formulieren lassen. Erst 1917 hatte Goursat erkannt, dass sie alle Spezialfälle der allgemeinen, 1889 von Volterra gefundenen, Version des Satzes von Stokes sind.) Zuvor hatte Poincaré schon beobachtet gehabt, dass Integration von “geschlossenen” Differentialformen ω (in späterer Notation denen mit dω=0) auf Homologiegruppen definiert werden kann, denn das Integral von ω über einen Rand ∂W ist das Integral von dω über das Innere W (das folgt in seiner heutigen Formulierung aus dem Satz von Stokes) und damit Null. Poincaré und zuvor schon Volterra hatten für sternförmige Gebiete bewiesen, dass geschlossene Differentialformen (dω=0) stets „exakt“ sind (von der Form ω=dα für eine Differentialform α). Beide hatten festgestellt, dass das auf der Sphäre nicht mehr zutrifft. Das war aber kein verbreitetes Wissen, es dauerte eine Weile, bis Mathematiker verstanden, dass lokale Integrierbarkeit von Differentialformen nicht die globale Integrierbarkeit gibt.
In einer Veröffentlichung in den Comptes Rendus hatte Cartan Vermutungen aufgestellt, die letztlich darauf hinausliefen, dass eine mittels Differentialformen definierte Kohomologietheorie dual zur Homologie mit reellen Koeffizienten sein sollte. Er hatte nämlich vermutet, dass eine geschlossene p-Form, deren Integral über alle p-Zykel verschwindet, exakt sein muß, und weiterhin dass für n unabhängige p-Zykel Zi und n reelle Zahlen ri eine geschlossene p-Form gibt, deren Integral über alle Zi jeweils gleich ri ist. Das bewies dann Georges deRham, damals Lehrer an einer Schule in Lausanne, in der in seiner Freizeit verfaßten (und an der Sorbonne 1931 bei Lebesgue und Cartan eingereichten) Dissertation “Sur l’analysis situs des variétés à n dimensions”.
Die komplexen algebraischen Geometer hatten Differentialformen als Integrale über Zykel betrachtet. Entsprechend bezeichneten sie 1-Formen als einfache Integrale und 2-Formen als Doppelintegrale. Die Werte der Integrale über die verschiedenen Homologieklassen von Zykeln Zi bezeichneten sie als die Perioden des Integrals. (Aus dem Satz von Stokes
Lefschetz hatte 1927 eine Arbeit geschrieben, in der er die Riemannschen Periodenrelationen und Integralungleichungen mit rein topologischen Methoden bewies. Für eine komplexe Kurve X vom Geschlecht g betrachtete er eine Basis ω1,…,ωg der holomorphen 1-Formen. Aus ωi∧ωj=0 folgen unmittelbar die klassischen Riemannschen Periodenrelationen. Und aus der Negativität von
Hodge befaßte sich dann die gesamten 30er Jahre mit der Frage, für eine Riemannsche Mannigfaltigkeit in der Kohomologieklasse jeder geschlossenen Form modulo exakter Formen einen kanonischen Repräsentanten zu finden, nämlich ein “harmonisches Integral”, in heutiger Sprache eine harmonische Form.
Die grundlegende Idee war, dass man auf dem Raum der Differentialformen einer orientierten Riemannschen Mannigfaltigkeit eine kanonische Metrik definieren kann. Zunächst definiert die Riemannsche Metrik ein punktweises Skalarprodukt auf TM und damit auch auf dem Dualraum T*M, der dem Raum der 1-Formen entspricht. Für eine Orthonormalbasis in einem Punkt definiert man dann ihre Produkte als Orthonormalbasis des Raums der punktweisen k-Formen. Das definiert eine Metrik auf den k-Formen in jedem Punkt und durch Integration über die Mannigfaltigkeit eine Metrik auf den global definierten k-Formen.
Bereits punktweise kann man den Hodge-*-Operator dadurch definieren, dass für eine positiv orientierte Orthonormalbasis e1,…,en gelten soll
Als harmonische Form bezeichnet man dann Differentialformen, die gleichzeitig im Kern von d und d*, also (da die Operatoren in unterschiedliche Zielräume abbilden) im Kern des Operators d+d* oder äquivalent im Kern des Operators Δ=dd*+d*d liegen. Hodge wollte beweisen, dass es in jeder Äquivalenzklasse geschlossener Formen (modulo exakter Formen) eine eindeutige harmonische Form gibt, man also die Dimension der Kohomologiegruppen auch als Dimension des Raums des harmonischen Formen berechnen kann.
Die Idee dahinter ist einfach. Die Kohomologieklasse ist ein affiner Unterraum im Raum der glatten k-Formen, dessen zugehöriger Vektorraum das Bild der (k-1)-Formen unter d ist. Ein Repräsentant minimaler Norm sollte orthogonal zum Bild von d sein, also im Bild von d* liegen. Dieses Argument könnte man jedenfalls anwenden, wenn der Raum der Differentialformen ein Hilbert-Raum wäre: dann wäre ker(d*) tatsächlich das orthogonale Komplement von im(d) und man könnte durch orthogonale Projektion des eines beliebigen Elements auf ker(d) den harmonischen Repräsentanten finden.
Die versteckte Problematik dieses Arguments ist, dass die C∞-Differentialformen mit dem L2-Skalarprodukt keinen Hilbert-Raum bilden und deswegen die Existenz einer orthogonalen Projektion in diesem unendlich-dimensionalen Vektorraum nicht offensichtlich ist. Tatsächlich ist sie im wesentlichen äquivalent zu einer Variante des Dirichlet-Prinzips, mit dem ja in der Funktionentheorie die Existenz harmonischer Funktionen mit vorgegebenen Randwerten bewiesen wird.
Für die Existenz der orthogonalen Projektion hatte Hodge zunächst einen direkten Beweis veröffentlicht. Nachdem Zweifel am Argument aufkamen, folgte er in einer weiteren Veröffentlichung einem Vorschlag Hellmuth Knesers, eine von E.E.Levi und Hilbert für elliptische partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung entwickelte Parametrixmethode anzuwenden. Diesen Beweis verwendete er dann in seinem 1941 veröffentlichten Buch “Theorie und Anwendungen harmonischer Integrale”, dessen zentrales Resultat der Existenz- und Eindeutigkeitssatz für harmonische Formen mit vorgeschriebenen Perioden war.
Es stellte sich heraus, dass auch dieser Beweis fehlerhaft war. Hermann Weyl übernahm es, einen korrekten Beweis unter Verwendung der Parametrixmethode aufzuschreiben. Dass Weyl als führender Mathematiker seiner Zeit es übernahm, einen vollständigen Beweis aufzuschreiben, überzeugte viele zeitgenössische Mathematiker von der Bedeutung des Resultats. (De Rham gab später die eleganteste Fassung des Beweises.) Der Beweis selbst war aus analytischer Sicht nicht besonders schwierig und das eigentlich bemerkenswerte war, dass Hodge als algebraischer Geometer und eigentlich hauptsächlich an algebraischer Geometrie Interessierter einen grundlegenden analytischen Satz gefunden hatte.
Es stellte sich später heraus, dass gleichzeitig mit Weyl auch Kunihiko Kodaira in Japan einen vollständigen Beweis aufgeschrieben hatte und zwar entlang Hodges erstem, ursprünglichem Ansatz. Kriegsbedingt wurde das in Europa und den USA zunächst nicht bekannt. Kodairas Beweis hatte den großen Vorteil, auch auf nichtkompakte Mannigfaltigkeiten anwendbar zu sein.
Nachdem in der algebraischen Geometrie lange algebraische Methoden dominiert hatten, zeigte die Hodge-Theorie wieder die Möglichkeiten der schon von Riemann entwickelten transzendenten Methoden. Beispielsweise bewies Hodge mit seinen Methoden den Indexsatz von Hodge, eine von den italienischen Geometern vermutete Formel für die Signatur der durch die Schnittzahl von Kurven auf Flächen definierten quadratischen Form.
Hodge wandte seine Theorie auf glatte algebraische Varietäten an. Als Riemannsche Metrik g betrachtete er die Funini-Study-Metrik des projektiven Raumes, die sich dann auf die im projektiven Raum liegenden Varietäten vererbt. Diese Riemannsche Metrik hat spezielle Eigenschaften, insbesondere ist die zugeordnete 2-Form
Hodge bemerkte, dass algebraische Varietäten nicht nur diese Bedingung (ω harmonisch) erfüllen, sondern dass die Form ω außerdem auch ganzzahlige Perioden hat. Damit war also die allgemeinere Klasse der Kähler-Mannigfaltigkeiten tatsächlich größer als die der algebraischen Varietäten, während sich aber die Hodge-Theorie genauso auch auf Kähler-Mannigfaltigkeiten anwenden ließ.
Für komplexe Mannigfaltigkeiten kann man n-Formen noch danach unterscheiden, für welches (p,q) sie sich in lokalen Koordinaten als
Aus der durch komplexe Konjugation vermittelten Symmetrie hp,q=hq,p folgt insbesondere, dass die ungeraden Bettizahlen b2k-1 gerade Zahlen sein müssen. Damit konnte man zeigen, dass manche komplexe Mannigfaltigkeiten keine glatten projektiven Varietäten (und keine Kählermannigfaltigkeiten) sein konnten. Zum Beispiel ist die Hopf-Fläche
In seinem Buch gab Hodge auch den ersten korrekten Beweis des schon 1924 von Lefschetz behaupteten schweren Lefschetz-Theorems. Es besagt im wesentlichen, dass die Schnittpaarung auf Verschwindungszykeln eines Lefschetz-Büschels nicht-ausgeartet ist, und hat zahlreiche Konsequenzen für die Topologie projektiver Varietäten bzw. allgemeiner dann auch die Topologie von Kähler–Mannigfaltigkeiten. Seine heute übliche Formulierung ist, dass für die durch das Cup-Produkt mit der Kähler-Form gegebene Abbildung
Bild: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hodge/pictdisplay/
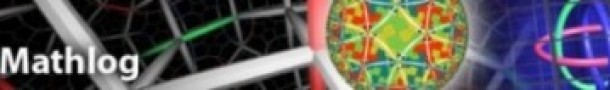

Kommentare (4)