Die Lösung der linearen Differentialgleichung x‘(t)=Ax(t) im Rn mit einer nxn-Matrix A ist bekanntlich x(t)=etAx(0), wobei das Matrixexponential etA definiert ist als die Reihe
Dagegen läßt sich der Logarithmus einer beliebigen Matrix nicht einfach durch die Potenzreihe
Gegeben eine Funktion f, ist es offensichtlich eine notwendige Bedingung für eine sinnvolle Definition einer Matrix f(A), dass die Funktion f zumindest auf dem Spektrum von A definiert sein muß. (Als Spektrum eines Operators bezeichnet man die Menge der komplexen Zahlen λ, für die λ.id-A nicht invertierbar ist. Ende der 30er Jahre bewiesen Gelfand und Mazur, dass das Spektrum jedes Operators nicht leer ist.)
Für normale Matrizen ist diese Bedingung auch hinreichend, weil sie sich diagonalisieren lassen und für Diagonalmatrizen die Einträge zum Spektrum gehören, auf dem sich f anwenden läßt.
Der Versuch, diesen Ansatz von endlich-dimensionalen Matrizen auf Operatoren zwischen unendlich-dimensionalen Vektorräumen zu verallgemeinern, führt auf verschiedene Funktionalkalküle.
Beim stetigen Funktionalkalkül möchte man Operatoren in (zumindest auf dem Spektrum definierte) stetige Funktionen einsetzen. Für die von einem Operator A und seinem Adjungierten A* (im Fall von Matrizen
Der naheliegende Ansatz beginnt natürlich mit Polynomen, in die man Operatoren auf die offensichtliche Weise einsetzen kann. Stetige Funktionen sind zwar im Allgemeinen keine Potenzreihen, sie lassen sich aber jedenfalls nach dem Satz von Stone-Weierstraß durch Polynome
Israel Gelfand war Student Kolmogorows gewesen, hatte 1938 im Alter von 25 Jahren über kommutative normierte Algebren habilitiert und war 1941 auf einen Lehrstuhl an der Moskauer Staatsuniversität befördert worden. Zwei Jahre später gründete er sein Forschungsseminar zur Funktionalanalysis.
Mit Naimark bewies er 1943 einen Satz, der zum Ausgangspunkt der Theorie der C*-Algebren werden sollte.
C*-Algebren sind Banach-Algebren (vollständige normierte Algebren mit submultiplikativer Norm), für die es eine anti-multiplikative, konjugiert-lineare Involution * mit
Das einfachste Beispiel ist die Algebra C0(X) der komplex-wertigen, im Unendlichen verschwindenden, stetigen Funktionen auf einem lokalkompakten topologischen Raum X. Diese Algebra ist kommutativ. Gelfand und Naimark bewiesen, dass man jede kommutative C*-Algebra A als C0(X) für einen lokalkompakten Raum X (den man sogar Hausdorffsch wählen kann) bekommt. Man kann für X nämlich die Menge aller von der Nullabbildung verschiedenen *-Homomorphismen von A in die komplexen Zahlen (oder äquivalent die Menge aller maximalen Ideale in A) mit einer geeigneten Topologie wählen.
Dieser Satz ermöglichte die Übersetzung algebraischer Eigenschaften kommutativer C*-Algebren in topologische Eigenschaften lokalkompakter Räume. Die Algebra A hat ein Einselement genau dann, wenn X kompakt ist. Die Adjunktion eines Einselements entspricht der Einpunktkompaktifizierung. Die Algebra ist endlich erzeugt genau dann, wenn X Teilmenge eines endlichdimensionalen Vektorraums ist. Die Algebra ist separabel genau dann, wenn X dem zweiten Abzählbarkeitsaxiom genügt.
Die zunächst interessantere Anwendung war aber der stetige Funktionalkalkül. Im Allgemeinen hat man für Banach-Algebren nur einen holomorphen Funktionalkalkül, d.h. für holomorphe auf dem Spektrum eines Elements a definierte Funktionen f kann man f(a) definieren. Für C*-Algebren bekommt man aber mit der Arbeit von Gelfand-Naimark sogar einen stetigen Funktionalkalkül, also ein Element f(a) schon für stetige Funktionen auf dem Spektrum des Elements a.
Wenn nun N ein beliebiger normaler Operator auf einem Hilbertraum ist, dann ist der Abschluß der von N und N* erzeugten Operatorenalgebra eine kommutative C*-Algebra E(N,N*), auf die man die Konstruktion von Gelfand-Naimark anwenden kann. Der im Beweis des Satzes von Gelfand-Naimark konstruierte Raum X ist gerade das Spektrum von N. Der Satz von Gelfand-Naimark gibt insbesondere den (schon 1939 von Gelfand bewiesenen) Isomorphismus
Kommutative C*-Algebren sind natürlich sehr speziell. Zusammen mit Resultaten von Irving Segal erhielten Gelfand und Naimark aber eine Charakterisierung aller C*-Algebren: zu jeder C*-Algebra A gibt es einen Hilbert-Raum H, so dass A zu einer selbstadjungierten, in der Normaltopologie abgeschlossenen Unteralgebra der Algebra der beschränkten Operatoren auf H isomorph ist. Segal war es auch, der die Bedeutung der C*-Algebren als Observablen-Algebren für die Formulierung einer axiomatischen Quantenfeldtheorie erkannte.
C*-Algebren waren ursprünglich in der Quantenmechanik verwendet worden. In von Neumanns Ansatz betrachtete man von Lösungen der Schrödinger-Gleichung aufgespannte Hilbert-Räume von Wellenfunktionen, und repräsentierte die Observablen durch Hermitesche Operatoren. Die algebraischen Relationen in den Operatoralgebren sind dann von grundlegender Bedeutung, zum Beispiel konnte von Neumann die Heisenbergsche Unschärferelation algebraisch ableiten. (Eine besondere Rolle spielten bei ihm die später als von-Neumann-Algebren bezeichneten W*-Algebren.) Von Neumanns Ansatz, die Theorie der Operatoralgebren zur Entwicklung einer „algebraischen Quantenmechanik“ zu verwenden war zwar letztlich nicht erfolgreich, durch die Arbeiten von Gelfand und anderen wurden C*-Algebren aber auch innerhalb der Mathematik populär, weil sie einheitliche Ansätze und oft kürzere Beweise für Tatsachen aus unterschiedlichen Bereichen der Mathematik ermöglichten.
Beispielsweise trug Gelfands einfacher Beweis des Satzes von Wiener zur Popularisierung der C*-Algebren bei. Der Satz von Wiener besagt, dass für eine absolut konvergente Fourier-Reihe
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Izrail_Gel%27Fand.jpg
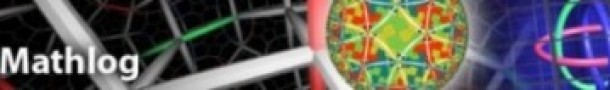

Kommentare (14)