Die Geschichte der Mengenlehre begann ursprünglich mit Fragestellungen, die aus der Analysis reeller Funktionen stammten, speziell aus der Fourier-Analyse, in der es um die Entwicklung 2π-periodischer Funktionen in Fourier-Reihen
Umgekehrt kann man fragen, ob zu einer gegebenen Funktion die Zerlegung in eine trigonometrische Reihe eindeutig ist. Diese Eindeutigkeit hatte Heine für gleichmäßige und Cantor für punktweise Konvergenz bewiesen. Cantor hatte dann festgestellt, dass es bereits genügt, punktweise Konvergenz außerhalb gewisser Ausnahmemengen zu haben. Anders als von ihm zunächst vermutet, muß die Ausnahmemenge nicht diskret sein, sondern es müssen lediglich die „Ableitungen“ (die Menge der Häufungspunkte) nach endlich vielen Schritten verschwinden. In diesem Zusammenhang entdeckte er die Cantor-Menge, die diese Eigenschaft nicht hat. Das war ursprünglich Cantors Motivation für die Entwicklung seiner Theorie der Punktmengen, bevor er sich später aus eher metaphysischen Motiven der abstrakten Mengenlehre zuwandte.
Während man sich im 19. Jahrhundert mit punktweiser Konvergenz von Potenzreihen – die freilich oft nicht zutrifft – befaßte, war nach den Arbeiten von Lebesgue die Frage der Konvergenz “fast überall” und mit der Entwicklung der Funktionalanalysis auch die Frage nach der Norm-Konvergenz in den Vordergrund gerückt.
Mengenlehre als Theorie der Punktmengen mit Anwendungen in der Analysis reeller Funktionen wurde Anfang des Jahrhunderts vor allem in Frankreich betrieben, beispielsweise spielen Borel-Mengen eine zentrale Rolle in der Maßtheorie. Daraus entwickelte sich die beschreibende Mengenlehre. Nikolai Lusin, stark von einem Paris-Aufenthalt und den französischen Analytikern beeinflußt, wurde damals der führende russische Mathematiker und interessierte sich neben der beschreibenden Mengenlehre auch für trigonometrische Reihen. 1915 stellte er in seiner Habilitationsschrift „Интеграл и тригонометрический ряд“ die Vermutung auf, dass jedenfalls für L2-Funktionen fast-überall punktweise Konvergenz der Fourier-Reihe gegen die Funktion vorliegen sollte. (Es ist leicht zu zeigen, dass sie in der L2-Norm konvergiert.) Das wurde dann bis zur Lösung als Lusins Vermutung bezeichnet.
An der Moskauer Universität organisierte Lusin ein berühmtes Forschungsseminar zur Theorie reeller Funktionen. Er war sehr extrovertiert und hielt schöne Vorlesungen, manche meinten sogar, dass sie seine Theatralität nicht mochten. Er machte kolossalen Eindruck auf Studenten, besonders die Jüngeren. Aus denen wurde eine kleine Sekte von Bewunderern, unter seinen Doktoranden war eine Reihe der später bekanntesten sowjetischen Mathematiker.
Zu Lusins ersten Studenten gehörte der vielseitig interessierte Andrei Kolmogorow. Der wurde 1923 auf einen Schlag international bekannt, als er als erst 19-Jähriger eine L1-Funktion konstruierte, deren Fourier-Reihe nicht überall gegen die Funktion konvergiert. 1926 fand er sogar eine Funktion, deren Fourier-Reihe überall divergiert. Das galt als eine große Leistung, aber die wahre Bedeutung dieses Resultats würde man erst später erkennen: für alle
In den 30er Jahren gelang es Kolmogorow dann mit seinem Freund Pawel Alexandrow und anderen jungen Wissenschaftlern, Lusin von seiner Position als führender sowjetischer Mathematiker zu verdrängen.
Zu Lusins Vermutung gab es einige Abschätzungen der Partialsummen von Kolmogorow-Seliverstnow-Plessner, Hardy und Littlewood-Payley, danach aber jahrzehntelang keine Fortschritte, so dass man schließlich glaubte, die Abschätzungen seien optimal und die Vermutung müsse falsch sein. Man wußte nicht einmal, ob eine Fourier-Reihe überhaupt in nur einem Punkt konvergieren mußte. Viele gingen davon aus, dass sich Kolmogorows Gegenbeispiel zu einem stetigen Gegenbeispiel verbessern lassen würde. Das vertrat vor allem Antoni Zygmund, der als der führende Experte der harmonischen Analyse galt nachdem er 1935 die Monographie „Trigonometric series“ verfaßt und später mit Calderón die Theorie singulärer Integraloperatoren entwickelt hatte. Angeregt von Zygmund begann auch Lennart Carleson Anfang der 50er Jahre an der Suche nach einem Gegenbeispiel zu arbeiten.
Carleson wurde zunächst 1962 durch die Lösung des Corona-Problems bekannt. (Der Name bezieht sich darauf, dass man die Corona des Hardy-Raums – einem gewissen Funktionenraum – definiert als Menge derjenigen Maximalideale, die nicht im Abschluß der Menge der einen Punkt annullierenden Maximalideale liegen. Carleson bewies, dass letztere dicht liegen, es also keine Corona gibt.)
Seine Suche nach einem Gegenbeispiel zu Lusins Vermutung war zwar nicht erfolgreich, stattdessen gelang ihm aber 1966 überraschend ein Beweis von Lusins Vermutung für L2-Funktionen.
Der Beweis war sehr schwer zu lesen, er wurde im Folgejahr noch von Hörmander vereinfacht. Carleson ging davon aus, dass sein Beweis für alle p>1 funktioniert und tatsächlich wurde das zwei Jahre später von Richard Hunt bewiesen. Der Satz in seiner allgemeinen Form wird deshalb als Satz von Carleson-Hunt bezeichnet.
Bild: https://digitaltmuseum.se/011014036411/professor-lennart-carleson-uppsala-mars-1966
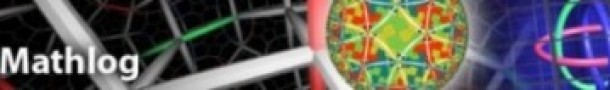

Kommentare (5)