Die klassische Mechanik geht auf Isaac Newton zurück. Er beobachtete, dass sich Körper unter der Wirkung eines Kraftfeldes F gemäß der Differentialgleichung
Man kann diesen Formalismus mathematisch so fassen, dass man auf dem Phasenraum R3xR3 die symplektische Form
Das kann man genauso machen, wenn der Ortsraum nicht R3, sondern eine Mannigfaltigkeit M ist. In diesem Fall ist der Phasenraum der Kotangentialraum T*M, auf diesem hat man eine kanonische symplektische Form ω und der symplektische Gradient einer Hamilton-Funktion beschreibt wieder den Hamiltonschen Fluss. Die Zeit-t-Abbildung des Flusses ist ein Symplektomorphismus, d.h. ein Diffeomorphismus f mit f*ω=ω.
Man hat symplektische Formen auch auf 2n-dimensionalen Mannigfaltigkeiten, die keine Kotangentialbündel sind, zum Beispiel ist die Volumenform einer Fläche eine symplektische Form oder allgemeiner die Kähler-Form einer Kähler-Mannigfaltigkeit.
Auf einem 2-dimensionalen Torus kann man einen Hamiltonschen Fluss nahe der Identität näherungsweise durch eine erzeugende Funktion H und die Gleichungen X=x+dH/dX(x,y), Y=y-dH/dY(x,y) beschreiben. Die Fixpunkte des Flusses entsprechen den kritischen Punkten von H, von denen es mindestens 3 und im nicht-ausgearteten Fall mindestens 4 geben muß.
Symplektomorphismen des 2n-Torus wurden wohl erstmals 1965 von Wladimir Arnold untersucht (damals noch unter der Bezeichnung „global kanonische Abbildung“): er bewies 1965, dass gewisse Symplektomorphismen des 2n-Torus mindestens 22n Fixpunkte haben und vermutete, dass dies für alle durch Hamiltonsche Flüsse erzeugte Symplektomorphismen des 2n-Torus (mit nicht-ausgearteten Fixpunkten) der Fall sei.
Symplektomorphismen verallgemeinern volumenerhaltende Abbildungen von Flächen. Für n=1, also den 2-Torus, folgt aus Arnolds Vermutung insbesondere „Poincarés letzter geometrischer Satz“, demzufolge eine volumenerhaltende Abbildung des Kreisrings, welche die beiden Randkomponenten in entgegengesetzte Richtungen dreht, mindestens zwei Fixpunkte haben muß. Den 2-Torus bekommt man durch Verkleben zweier Kreisringe und die Bedingung über die entgegengesetzt gedrehten Ränder ist notwendig, damit die Abbildung durch einen Hamiltonschen Fluß entstehen kann. In seinen Arbeiten zum Dreikörperproblem hatte Poincaré festgestellt, dass man die Suche nach periodischen Bahnen in 3-dimensionalen dynamischen Systemen auf die Bestimmung von Fixpunkten einer 2-dimensionalen flächenerhaltenden Abbildung (des Poincaré-Schnitts) zurückführen kann. Seinen „letzten geometrischen Satz“ über die volumen-erhaltenden Abbildungen des Kreisrungs hatte er 1912 formuliert, vollständig bewiesen wurde er dann von Birkhoff.
Symplektische Geometrie hat sich heute etabliert als die universelle geometrische Sprache der klassischen Mechanik, aber sie hat auch enge Verbindungen zu zahlreichen Gebieten innerhalb der Mathematik von Variationsrechnung über Quantisierung oder Darstellungstheorie bis zur mikrolokalen Analysis von Differentialgleichungen. Wladimir Arnold hatte die vereinheitlichende Natur der symplektischen Geometrie früh erkannt und in seinem 1974 (zunächst auf Russisch) erschienenen Lehrbuch “Mathematische Methoden der klassischen Mechanik” einen Paradigmenwechsel vollzogen. Statt des traditionellen analytischen Zuganges zur theoretischen Mechanik verwendete es Ansätze der modernen Mathematik wie Lie-Gruppen, Differentialformen und Symplektomorphismen. Arnold popularisierte auch die symplektische Topologie, die ihre wesentlichen Anstöße von einem einzelnen Problem bekam, der von ihm 1974 in ihrer Allgemeinheit formulierten Arnold-Vermutung: ein durch einen Hamiltonschen Fluss zur Identitätsabbildung homotoper Symplektomorphismus (d.h. ein Symplektomorphismus, der die Zeit-1-Abbildung eines Hamiltonschen Flusses ist) soll mindestens soviele Fixpunkte haben, wie die Summe der Dimensionen der Homologiegruppen der zugrundeliegenden symplektischen Mannigfaltigkeit angibt. (Unter der generisch erfüllten Voraussetzung, dass alle Fixpunkte nicht-ausgeartet sind.) Das verallgemeinert seine ursprüngliche Vermutung für 2n-Tori und es ist eine sehr viel stärkere Aussage als der Lefschetzsche Fixpunktsatz, demzufolge in der stetigen Kategorie Abbildungen, welche homotop zur Identität sind, mindestens soviele Fixpunkte haben wie die Euler-Charakteristik der zugrundeliegenden Mannigfaltigkeit (also die Wechselsumme über die Dimensionen der Homologiegruppen) angibt.
Für die S2 war die Arnold-Vermutung bereits vor ihrer Formulierung 1972 von Nikishin bewiesen worden. Für beliebige Flächen bewies sie 1979 Eliashberg und für den 2n-Torus bewiesen sie Conley und Zehnder 1983, indem sie die von Conley für beliebige von Flüssen erzeugte Diffeomorphismen entwickelte Index-Theorie auf ein bestimmtes von Rabinowitz definiertes Wirkungsfunktional anwandten. Diese Arbeit wird von manchen als Beginn der symplektischen Topologie angesehen, weil sie (weiterhin mit variationellen Methoden) die Arnold-Vermutung nicht nur für Symplektomorphismen nahe der Identität angehen konnte.
Michail Gromov war durch Probleme mit gewissen Differentialgleichungen auf die symplektische Geometrie gestoßen. Die Lösungen dieser Differentialgleichungen sollten quasianalytisch sein, was analytisch schwer zu beweisen war, aber in geometrischen Begriffen einfach daraus folgte, dass es sich um pseudoholomorphe Kurven für gewisse fastkomplexe Strukturen handelte, ein elliptisches System wie man es aus den klassischen Holomorphie definierenden Cauchy-Riemann-Gleichungen kennt. Zu einer symplektischen Struktur hat man eine fastkomplexe Struktur mit einer gewissen Kompatibilitätsbedingung und kann dann also über pseudoholomorphe Kurven bezüglich dieser fastkomplexen Struktur sprechen. Gromovs Intuition war nun, dass pseudoholomorphe Kurven in der symplektischen Geometrie eine ähnliche Rolle spielen sollten wie die holomorphen Kurven in der klassischen komplexen Geometrie. Typisch für Gromov war, dass es sich hier um eine aufgeweichte Geometrie handelt: die fast-komplexe Struktur ist durch die symplektische Struktur nur bis auf Homotopie festgelegt, aber diese Uneindeutigkeit erweist sich nicht als Problem. (Ähnlich wie in der Theorie der hyperbolischen Gruppen die Metrik nur bis auf Quasi-Isometrie festgelegt ist, was bei der Entwicklung der Theorie aber kein Problem darstellt.) Mit diesem Ansatz konnte Gromov beispielsweise symplektische Starrheit zeigen – Symplektomorphismen bilden eine abgeschlossene Untergruppe der Diffeomorphismen, was überhaupt den Begriff “Symplektische Topologie” rechtfertigt – oder die Existenz einer spezifisch symplektischen Invariante, der “Weite”, mit der er dann bewies, dass es keine symplektischen Einbettungen
Eliashbergs Beweis der Arnold-Vermutung für Flächen höheren Geschlechts fanden viele Mathematiker unverständlich, weshalb Zehnder seinem Diplomanden Andreas Floer die Aufgabe stellte, Eliashbergs Behauptungen zu verifizieren, was diesem mit vielen neuen Ideen auch gelang.
Um die Arnold-Vermutung anzugehen, muss man für ein auf dem Schleifenraum einer symplektischen Mannigfaltigkeit definiertes Wirkungsfunktional eine untere Schranke für die Anzahl kritischer Punkte beweisen, was auf schwere analytische Probleme stößt. (Fixpunkte der Zeit-1-Abbildung eines Hamiltonschen Flusses entsprechen periodischen Bahnen des Flusses, weshalb man nach kritischen Punkten auf dem Schleifenraum suchen kann.) Die kritischen Punkte des Wirkungsfunktionals sind durch Kurven verbunden, die durch eine elliptische partielle Differentialgleichung beschrieben werden, welche eine Störung niederer Ordnung der von Gromov betrachteten Gleichung für pseudoholomorphe Kurven ist. Aus dieser Beobachtung entwickelte Floer ein Analogon der Morse-Theorie für Gradientenflüße basierend auf einer algebraischen Zählung der Lösungen endlicher Energie für diese Gleichung.
Die Grundidee dieses Ansatzes ist eine Verallgemeinerung der Morse-Homologie. In der Morse-Theorie betrachtet man eine Funktion, deren kritische Punkte nicht-ausgeartet sind. Man kann dann den Kettenkomplex nehmen, dessen k-Ketten von kritischen Punkten vom Index k erzeugt werden und dessen Randoperator angewandt auf solch einen Punkten die Flußlinien des Gradientenflusses zählt, welche jeweils in einem kritischen Punkt vom Index k-1 enden. (Mit diesem Koeffizienten kommt der kritische Punkt vom Index k-1 dann im Rand des kritischen Punktes vom Index k vor.) Die mit diesem Randoperator definierte Homologie ist für kompakte Mannigfaltigkeiten isomorph zur Homologie der zugrundeliegenden Mannigfaltigkeit (während man für nichtkompakte Mannigfaltigkeiten die Homologie des Conley-Index erhält). Weil die Dimension der Homologie nicht größer werden kann als die Dimension des Kettenkomplexes, erhält man die Morse-Ungleichungen, denenzufolge es mindestens soviele kritische Punkte vom Index k gibt wie die Dimension der k-ten Homologiegruppe.

Diese Idee versuchte Floer also zu verallgemeinern. Die kritischen Punkte des Wirkungsfunktionals erzeugen einen Kettenkomplex. Das erste Problem bei der Verallgemeinerung der Morse-Theorie ist die Definition des Index, da die Vektorräume, auf denen die zweite Ableitung positiv und negativ definit ist, unendlichdimensional sind. Er konnte aber einen relativen Index verwenden, den Maslov-Index. Der Randoperator soll dann statt der Flußlinien eines Gradientenflusses die (gestörten) pseudoholomorphen Kurven zählen, welche kritische Punkte vom Index k und k-1 verbinden (in dem Sinne, dass sie zylindrische Enden haben, die gegen die zu den Fixpunkten gehörenden periodischen Bahnen des Hamilton-Flusses konvergieren). Man muß einen Kompaktheitssatz für pseudoholomorphe Kurven beweisen, damit der Randoperator wirklich endliche Summen gibt, und man muß eine Verklebeformel beweisen, damit der Randoperator d2=0 erfüllt. Der Kompaktheitssatz für pseudoholomorphe Kurven war gerade zuvor von Gromov bewiesen worden, allerdings unter der Voraussetzung, dass es keine Blasenbildung gibt. Diese Blasenbildung konnte man ausschließen, wenn die zweite Homotopiegruppe der Mannigfaltigkeit verschwindet. Unter dieser zusätzlichen Voraussetzung konnte Floer also die Existenz seiner Homologietheorie beweisen. Aus der Existenz der Floer-Homologie und ihrer Isomorphie zur singulären Homologie (für von einem Hamiltonschen Fluss erzeugte Symplektomorphismen) folgt dann unmittelbar die Arnold-Vermutung: die Anzahl der kritischen Punkte ist die Dimension des Kettenkomplexes und damit mindestens so groß wie die Dimension der Homologie.
Floer bewies die Existenz der Floer-Homologie und damit die Arnold-Vermutung nicht nur unter der Voraussetzung π2=0, sondern allgemeiner auch noch für sogenannte monotone symplektische Manigfaltigkeiten, wo über eingebetteten 2-Sphären die symplektische Form ein nichtnegatives Vielfaches der ersten Chern-Klasse ist. Hofer konnte diese Voraussetzungen dann noch etwas abschwächen.
Floer wandte seine Methoden auch in der Eichtheorie an. Statt des Wirkungsfunktionals auf dem Schleifenraum betrachtet er dort das Chern-Simons-Funktional auf dem Raum der SU(2)- oder SO(3)-Zusammenhänge einer 3-Mannigfaltigkeit M. Die kritischen Punkte sind die flachen Zusammenhänge und der Randoperator wird definiert durch Zählen der Yang-Mills-Zusammenhänge auf MxR, die zwei flache Zusammenhänge auf M “verbinden”. Dies führte zur Definition der Instantonenhomologie, nützlich für das Studium von 4-Mannigfaltigkeiten mit Rand.
Floer-Homologie ist nicht eine einzelne Theorie, sondern eine neue Herangehensweise an das Studium kritischer Punkte bestimmter geometrischer Funktionale und eines Weges aus ihnen algebraische Invarianten zu erzeugen. Auf einer Hermann Weyl gewidmeten Konferenz 1987 an der Duke University erklärte Atiyah, dass die Floer-Theorie in das Konzept der topologischen Quantenfeldtheorien passen sollte. Die waren ursprünglich physikalisch über das nicht rigoros definierte Pfadintegral konstruiert, aber physikalische Argumente lieferten eine Axiomatik für topologische Quantenfeldtheorie, die Atiyah in einer Arbeit in Publ. IHÉS veröffentlichte. Es wurden dann zum Beispiel mit kombinatorischen Zustandssummen zahlreiche solcher Feldtheorien konstruiert, die bekannte oder neue topologische Invarianten gaben.
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andreas_Floer_1986_Bochum.JPG
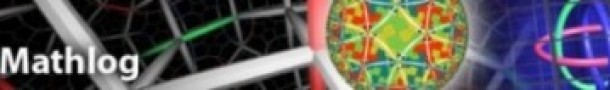

Kommentare (5)