In der algebraischen Geometrie behandelt man Räume mittels der algebraischen Untersuchung der Ringe der auf ihnen definierten (algebraischen) Funktionen. Auch in anderen Gebieten der Mathematik betrachtet man oft geeignete Funktionenräume (in physikalischer Sprache: Observablen) statt der zugrundeliegenden Räume, zum Beispiel einfach die Algebra C0(X) der komplexwertigen stetigen Funktionen mit kompaktem Träger auf X. Diese Algebra ist eine C*-Algebra und kommutativ. Gelfand und Naimark bewiesen 1943, dass man jede kommutative C*-Algebra als C0(X) für einen geeigneten lokalkompakten Hausdorff-Raum X realisieren kann.
Auch nichtkommutative C*-Algebren sind in der Topologie von Nutzen. Wenn man etwa Gruppenwirkungen auf einem topologischen Raum oder Blätterungen auf einer Mannigfaltigkeit hat, dann ist der Quotientenraum oder der Raum der Blätter oft kein vernünftiger topologischer Raum (z.B. kann er eine antidiskrete Topologie haben, in der nur die leere Menge und der ganze Quotientenraum offen sind), man hat aber nichtkommutative C*-Algebren, die in gewisser Weise den Quotientenraum beschreiben.
Alain Connes hatte 1982 die Fields-Medaille für seine Arbeiten über von-Neumann-Algebren bekommen. Nach von Neumann und Murray werden Faktoren (von-Neumann-Algebren, deren Zentrum nur aus Vielfachen der 1 besteht) in drei Typen unterschieden, Typ I sind diejenigen mit abelscher Kommutante (das sind Algebren beschränkter Operatoren auf einem Hilberts-Raum), Typ II sind Algebren mit nichttrivialen endlichen, aber ohne minimale Projektionen, Typ III ist der Rest, also Algebren ohne endliche Projektionen. Connes hatte 1973 die Faktoren vom Typ III klassifiziert. Seit Anfang der 80er Jahre bewarb er den Ansatz, man solle die Theorie der C*-Algebren als eine Theorie nichtkommutativer Räume interpretieren, so wie die kommutativen C*-Algebren gerade den Algebren stetiger Funktionen auf lokalkompakten Hausdorff-Räumen entsprechen. Insbesondere wollte er mit geeigneten C*-Algebren wilde Quotientenräume oder Blatträume von Blätterungen untersuchen. Oft ging es aber auch nur darum, nichtkommutativen Algebren eine geometrische Bedeutung zuzuweisen. Populärstes Beispiel wurde der nichtkommutative Torus, die Algebra <U,V: VU=e2πiαVU> für irrationales α. Den assoziierte Connes zur Blätterung des Torus druch Geraden mit Anstieg α, dem einfachsten Beispiel einer Blätterung mit dichten Blättern.
Die wohl wichtigste Anwendung in der Theorie der Blätterungen war der 1986 von Connes und Skandalis bewiesene Indexsatz für Blätterungen. Der klassische Atiyah-Singer-Indexsatz, der den Index dim(Kern(D))-dim(Bild(D)) des Dirac-Operators D (oder allgemeiner eines elliptischen Differentialoperators) mit einer charakteristischen Klasse gleichsetzt, bedeutet die Gleichheit eines analytischen und eines topologischen Indexes für den Operator. Atiyah und Singer hatten dies 1971 verallgemeinert auf einen Indexsatz für Familien, wo man eine durch Punkte b eines topologischen Raumes B parametrisierte Familie von elliptischen Operatoren Db hat. Der Index ist dann keine Zahl, sondern ein Element der K-Theorie K0(B): zwar sind die Familien Kern(Db) und Bild(Db) keine Vektorbündel, weil die Dimension in einzelnen Punkten springen kann; sie springt allerdings in denselben Punkten, so dass die formale Differenz Kern(Db)-Bild(Db) ein wohldefiniertes virtuelles Vektorbündel ist, also ein Element in K0(B) – das ist der Satz von Atiyah-Jänich. Die Aussage des Familien-Indexsatzes war dann, dass dieser analytische Index mit einem topologischen Index übereinstimmt.
Die „Familien über B“ sind formal definiert als Faserbündel über B, also besonders einfache Blätterungen. Für beliebige Blätterungen hat man einen Raum der Blätter B, aber die Quotiententopologie kann zum Beispiel antidiskret sein. Connes verwendete statt K0(B) die K-Theorie der zur Blätterung assoziierten C*-Algebra und konnte so einen longitudinalen Indexsatz formulieren und mit Skandalis beweisen.
Die äquivariante Version des Atiyah-Singer-Indexsatz verallgemeinert die Fixpunktformel von Atiyah-Bott und gilt für Wirkungen kompakter Lie-Gruppen auf Mannigfaltigkeiten. Statt der Dimensionen des Kerns und Kokerns eines Dirac-Operators kommen dort (für Gruppenelemente g) die Spuren der Wirkung von g auf Kern und Kokern vor; die Aussage des äquivarianten Indexsatzes ist dann, dass der analytische und topologische Index als Abbildungen von der äquivarianten K-Theorie in den Darstellungsring der Gruppe übereinstimmen, mit anderen Worten dass die Differenz der Spuren durch Integration gewisser charakteristischer Formen berechnet werden kann.
In einer 1982 geschriebenen, aber bis 2000 unveröffentlichten Arbeit schlugen Baum und Connes vor, diese Indextheorie auf (kokompakte, eigentlich diskontinuierliche) Wirkungen beliebiger lokalkompakter Gruppen G auszudehnen. Statt den Wirkungen kompakter Gruppen betrachtet man also in der Regel unendliche, aber endlich erzeugte Gruppen. Dort definierten sie den äquivarianten topologischen Index als ein Element aus der äquivarianten K-Theorie des universellen eigentlichen G-Raums, und den äquivarianten analytischen Index als ein Element in der K-Theorie der reduzierten C*-Algebra von G. (Diese C*-Algebra ist definiert als Abschluß des Bildes von L1(G) in der Algebra der beschränkten Operatoren auf L2(G), für die reguläre Darstellung von G und damit L1(G) auf L2(G).) Zwischen diesen beiden K-Theorien gibt es eine Vergleichsabbildung, die den äquivarianten topologischen auf den äquivarianten analytischen Index abbildet. Die Baum-Connes-Vermutung besagt, dass diese Vergleichsabbildung ein Isomorphismus sei. Da die äquivariante K-Theorie mit topologischen Methoden berechnet werden kann, würde das die Berechnung der K-Theorie von Gruppen-C*-Algebren ermöglichen.
Aus der Baum-Connes-Vermutung folgt die Novikov-Vermutung über die Homotopie-Invarianz höherer Signaturen von Mannigfaltigkeiten. Diese höheren Signaturen sind gewisse in Abhängigkeit von der Fundamentalgruppe gebildete Kombinationen von Pontrjagin-Klassen. Pontrjagin-Klassen sind nicht homotopie-invariant, Sergei Novikov hatte aber 1966 ihre topologische Invarianz bewiesen und später vermutet, dass zumindest die höheren Signaturen auch homotopie-invariant sind, was er zunächst für abelsche Fundamentalgruppen bewies. Novikovs früherer Student Gennadi Kasparow entwickelte seit Ende der 70er Jahre die KK-Theorie, eine bivariante K-Theorie für Operatoralgebren, mit der er die Novikov-Vermutung angehen wollte. Connes und Skandalis hatten diese Theorie zum Beweis ihres Indexsatzes für Blätterungen verwendet. Kasparow bewies 1988 mit Hilfe der KK-Theorie die Novikov-Vermutung für Gruppen, die eine eigentliche Wirkung als Isometrien einer einfach zusammenhängenden Mannigfaltigkeit nichtpositiver Krümmung besitzen.
Die KK-Theorie wurde auch zum zunächst einzigen effektiven Zugang zur Baum-Connes-Vermutung. Die Idee war, darstellungstheoretische Methoden zu benutzen, um beide Seiten des mutmaßlichen Isomorphismus einzeln zu berechnen. Beispielsweise im Fall symmetrischer Räume G/K kann man jeder Darstellung von K den G-Index des getwisteten Dirac-Operators auf G/K zuordnen und die Baum-Connes-Vermutung ist (modulo einer K-theoretischen Vermutung) äquivalent dazu, dass dieses einen Isomorphismus des Darstellungsrings von K mit der K-Theorie der reduzierten C*-Algebra induziert. Für die von Harish-Chandra parametrisierte diskrete Serie von Darstellungen von K und auch in allgemeineren Fällen kann man das auch zeigen, aber das gibt noch nicht die gesamte Zerlegung der regulären Darstellung.
Tatsächlich stellte sich (vor allem durch Einsichten Weinbergers, der Indextheorie mit Chirurgietheorie verknüpfte) heraus, dass die Novikov-Vermutung aus der Baum-Connes-Vermutung folgen würde und man dafür von der Baum-Connes-Vermutung nur die Injektivität (sogar nur nach Tensorieren mit Q) benötigen würde, die viele für einfacher hielten als die Surjektivität. (Aus der Surjektivität würde aber eine andere Vermutung folgen, nämlich die Kaplansky-Vermutung, derzufolge es für torsionsfreie Gruppen G und beliebige Körper k keine Nullteiler im Gruppenring kG gibt.)
Unabhängig von der Baum-Connes-Vermutung bewiesen Connes und Moscovivi 1990 die Novikov-Vermutung für hyperbolische Fundamentalgruppen. Nichtkommutative Geometrie kam hier in Form der Vervollständigung des Gruppenrings der Fundamentalgruppe ins Spiel. Ihr Beweis benutzte Beschränktheit der Kohomologieklassen hyperbolischer Gruppen, was für negativ gekrümmte Mannigfaltigkeiten aus klassischen Vergleichssützen folgt, aber für hyperbolische Gruppen erst 1999 von Mineyev bewiesen wurde.
Alle Versuche, die Baum-Connes-Vermutung zu beweisen, bauten bis dahin auf einem Ansatz auf, den man als nichtlineare Version eines von Atiyah gefundenen indextheoretischen Beweises der Bott-Periodizität ansehen kann. Kasparows Methode benötigte die Konstruktion einer Homotopie zwischen der regulären und der trivialen Darstellung einer Gruppe. Sie konnte also nicht für Gruppen mit Eigenschaft T funktionieren, bei denen nach Definition die triviale Darstellung im Raum aller unitären Darstellungen isoliert ist. Diese Eigenschaft T haben zum Beispiel Gitter in symmetrischen Räumen vom Rang r>1 wie SL(r+1,R)/SO(r).
Gromov hatte (als Argument für die Beschäftigung mit hyperbolischen Gruppen) polemisiert, dass Aussagen über beliebige Gruppen ohne zusätzliche Annahmen entweder trivial oder falsch seien. Er war auch der Meinung, dass die Baum-Connes-Vermutung nur für bestimmte (möglichst geometrisch definierte) Klassen von Gruppen richtig sein würde und nicht für völlig beliebige Gruppen. So definierte er den Begriff der a-T-menabilität: Gruppen, die in einem starken Sinn die Eigenschaft T nicht erfüllen. Dazu gehören mittelbare Gruppen, Gitter in SO(n,1) oder SU(n,1), Spiegelungsgruppen und Gruppen, die eigentlich auf Bäumen oder Räumen mit Wänden wirken. Aus a-T-menabilität folgt die Einbettbarkeit der Gruppe in den unendlich-dimensionalen Hilbert-Raum l2. Für solche Gruppen kann man, wie Higson und Kasparow in den 90er Jahren (veröffentlicht 2001) bewiesen, zwischen trivialer und regulärer Darstellung interpolieren, woraus mit Kasparows Methode also die Baum-Connes-Vermutung (sogar in einer allgemeineren Version mit Koeffizienten) folgt.
Eigenschaft T galt bis dahin als kaum zu überwindendes Hindernis für einen Beweis der Baum-Connes-Vermutung. Umso frappierender waren die Ergebnisse der Doktorarbeit „K-théorie bivariante pour les algèbres de Banach et conjecture de Baum-Connes“ von Vincent Lafforgue. Er bewies die Vermutung für Gruppen, die zwei Bedingungen erfüllen: sie sollen eigentlich, kokompakt, isometrisch auf stark bolischen Räumen (einer Verallgemeinerung hyperbolischer Räume) wirken und eine “schnelle Abfallbedingung” erfüllen, die besagt, dass für jedes Element des Gruppenrings CG die Operatornorm in der regulären Darstellung sich abschätzen läßt gegen ein Vielfaches der (mittels einer Längenfunktion auf der Gruppe) gewicheten l2-Norm. Damit bekam er die Vermutung nicht nur für kokompakte Gitter in SO(n,1) oder SU(n,1), sondern auch in Sp(n,1) und damit erstmals Beispiele mit Eigenschaft T. Lafforgue bewies seine Bedingungen auch für Gitter in SL(3,Qp) und für kokompakte Gitter in SL(3,R) und SL(3,C) und damit also die Baum-Connes-Vermutung für diese Gruppen, die alle Eigenschaft T haben. (Für SL(3,Z) blieb die Vermutung offen.) Weiterhin konnte Lafforgue aber mit Higson und Skandalis Gegenbeispiele zu der allgemeineren Version mit Koeffizienten – die Kasparow in seinen Arbeiten für seine Beispiele gezeigt hatte – finden. Die Gegenbeispiele benutzten die von Gromov entwickelte Theorie der Zufallsgruppen, die für Existenzbeweise von Expandern benutzt werden kann, welche insbesondere nicht in l2 eingebettet werden können.
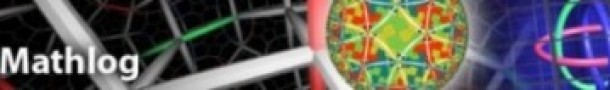
Kommentare (1)