Quantenkohomologie wurde ursprünglich von den Physikern Vafa und Witten vorgeschlagen als Konzept, mit dessen Hilfe man das von Physikern beobachtete Phänomen der Mirrorsymmetrie von Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten angehen wollte: man wollte verstehen, wie sich die Korrelationsfunktionen einer topologischen Feldtheorie verhalten, wenn man Riemannsche Flächen zusammenklebt.
Quantenkohomologie ist eine formale Deformation des Kohomologierings (also des Cupprodukts auf der Kohomologie) projektiver Varietäten. Ihre für die physikalischen Anwendungen wesentliche Eigenschaft ist die Assoziativität der Verknüpfung. Die Idee ist, holomorphe Kurven (Riemannsche Flächen) in einer projektiven Varietät zu zählen, aber mit diesem naiven Ansatz bekommt man nicht die von den Physikern gewünschten Eigenschaften.
Eine mathematische Theorie der Quantenkohomologie wurde 1994 von Ruan und Tian entwickelt. Sie betrachteten nicht nur projektive Varietäten, sondern allgemeiner semi-positive symplektische Mannigfaltigkeiten X, und definierten auf deren zweiter Homologie (von weiteren Daten abhängende) Invarianten, die sie Gromov-Witten-Invarianten nannten, weil sie in unterschiedlichen Spezialfällen mit zuvor von Gromov und Witten untersuchten Invarianten übereinstimmten. Mit Hilfe dieser Invarianten konnten sie dann das Quantenprodukt auf der Kohomologie definieren und sie bewiesen seine Assoziativität. Mit einem anderen Zugang entwickelten Kontsevich und Manin eine axiomatische Theorie von Gromov-Witten-Invarianten und damit auch der Quantenkohomologie.
Für eine Homologieklasse
Nachdem Physiker Anfang der 90er Jahre Mirrorsymmetrie zur Berechnung der Anzahl Nd der rationalen Kurven vom Grad d auf der Quintik z05+…+z45=ψz0…z4 verwenden konnten, war Mirrorsymmetrie für die algebraische Geometrie interessant geworden. Neben dem von Kontsevich 1994 vorgeschlagenen Zugang mittels homologischer Mirrorsymmetrie gab es auch die von Yau und den Physikern Strominger und Zaslow aufgestellte Vermutung, dass man komplex n-dimensionale Spiegelpaare in n-dimensionale Tori fasern könne und dass die Fasern der Spiegelpaare jeweils dual zueinander seien. Für Quintiken konnte das dann auch bewiesen werden. Dominic Joyce, ein junger Differentialgeometer aus Oxford, der in der Differentialgeometrie Beispiele für die noch fehlenden Holonomiegruppen aus Bergers Liste gefunden hatte und in diesem Zusammenhang auch auf weitere Spiegelpaare gestoßen war, zeigte aber, dass die technische Formulierung der SYZ-Vermutung noch komplizierter sein musste als zunächst angenommen.
Es stellte sich heraus, dass die ursprüngliche (und noch unbewiesene) von Physikern aufgestellte Vermutung über das Abzählen von rationalen Kurven (d.h. Geschlecht 0) in Quintiken so nicht stimmte. Die Zahl Nd, die man aus der bekannten Differentialgleichung enthielt, zählte die rationalen Kurven vom Grad d, wenn die Kurven alle nichtsingulär, disjunkt und isoliert mit balanziertem Normalenbündel waren. Das ist aber nicht immer der Fall, weshalb man eine bessere Definition von Nd, also die richtige Art Kurven zu zählen, brauchte. Dafür hatte Kontsevich die Idee, stabile Abbildungen zu betrachten, also Abbildungen von CP1 mit markierten Punkten, für die es nur endlich viele die markierten Punkte erhaltende Automorphismen gibt.
Mit der von Kontsevich entwickelten Theorie stabiler Abbildungen hatten dann Kontsevich und Manin ihre axiomatische Theorie der Gromov-Witten-Invarianten begründet. Die Verwendung des Modulraums stabiler Abbildung ermöglichte es, alle von Entartungen kommenden Relationen auf eine stringente Weise zu formulieren. Die Gromov-Witten-Invarianten sollen pseudoholomorphe Kurven in einer gegebenen Homologieklasse einer symplektischen Mannigfaltigkeit zählen oder eben rationale Kurven vom Grad d (durch 3d+1 gegebene Punkte) in CP2. (Die Anzahl 3d+1 ist so gewählt, dass der Modulraum die vom Riemann-Roch-Theorem gegebene Dimension hat.) Die Assoziativität des mit den Gromov-Witten-Invarianten definierten Quantenprodukts folgt aus einem Verklebesatz für pseudoholomorphe Kurven, der WDVV-Gleichung.
Kontsevich entwickelte auch die Methode der Toruslokalisierung, um Mirrorsymmetrie anzugehen, und er konnte insbesondere die Zahlen Nd durch eine komplizierte Summation über Graphen berechnen. Alexander Givental bewies dann die als Anwendung der Mirrorsymmetrie vermutete Interpretation der Nd durch eine klassische Differentialgleichung, sein Hauptwerkzeug war eine explizite Lokalisierungsformel in äquivarianter Kohomologie (für die natürliche Toruswirkung auf dem Modulraum des CPn). Sein Beweis war nicht leicht zu verstehen, aber die Fachleute waren überzeugt von seiner Korrektheit.
Im Jahr darauf gab Liu, ein früherer Student Yaus, einen Vortrag in Harvard, wo er seine gemeinsame Arbeit mit Yau und Lian (ebenfalls ein früherer Student Yaus) vorstellte. Die Zuhörer fanden, die Argumente seien identisch mit denen Giventals, während Liu diesen nur in einer Reihe weiterer Mathematiker erwähnte, auf deren Vorarbeiten ihre Arbeit aufbauen würde. Auch in ihrer dann erscheinenden Serie von Preprints war das ähnlich formuliert. Etwa zu dieser Zeit erhielt dann auch Givental eine e-Mail von Yau, in der dieser ihm mitteilte, seine Argumente seien unvollständig und unverständlich, ihm gleichzeitig für seine geniale Idee dankte und die Preprints ankündigte. Die Experten kamen jedoch nach einigen Monaten zu dem Schluß, dass die Argumente dieselben wären und Giventals Beweis vollständig sei. Der Beweis der Chinesen habe nur die analytischen Details ausgearbeitet. Die waren freilich ziemlich schwer und von Givental teils dem Leser überlassen worden.
Grundlegend für die Theorie der Gromov-Witten-Invarianten sind die Invarianten der projektiven Gerade CP1. Diese wurden durch Arbeiten von Okunkow und Pandharipadne verstanden.
Partitionen, also Zerlegungen einer natürlichen Zahl n in positive ganze Zahlen, kommen in der Mathematik überall vor. In der Darstellungstheorie entsprechen die irreduziblen Darstellungen der symmetrischen Gruppe Sn den Partitionen von n. Diese werden durch Young-Tableaus veranschaulicht, in denen jeweils die entsprechende Anzahl Einheitsquadrate für jeden Summanden der Partition verwendet wird. Wenn man dieses Diagramm um 135 Grad gedreht und mit n-1/2 auf Fläche 1 normiert wird, dann erhält man den Graphen einer stückweise stetigen Funktion.

Die Gleichverteilung auf der Menge der irreduziblen Darstellungen von Sn kann man so als Maß auf der Menge der Funktionen auffassen. Und man kann fragen, was der Grenzwert für n gegen Unendlich ist. Verschiedene Mathematiker hatten in den 70er Jahren gezeigt, dass der Grenzwert ein auf einem Punkt (also einer Funktion) konzentriertes Maß ist. Die Grenzfunktion ist
Über die Asymptotik der Maße für große n war einiges bewiesen worden, intensive Untersuchungen und numerische Experimente gab es insbesondere zum Verhalten nahe der Ränder des Intervalls (-2,2). Die Baik-Deift-Johansson-Vermutung besagte, dass man hier dasselbe Verhalten hat wie bei den Eigenwerten zufälliger komplexer konjugiert-symmetrischer Matrizen. Diese Vermutung wurde 1999 von André Okunkow bewiesen und nahm verschiedene Ideen seiner späteren Arbeiten über Gromov-Witten-Invarianten vorweg. Okunkow hatte 1995 an der Lomonossow-Universität über Darstellungstheorie promoviert und ging nach seiner Dissertation zahlreiche weitere Probleme mit seinen Methoden an. In Berkeley arbeitete er mit Reshetikhin über Dimerkonfigurationen von Graphen, nach Princeton gewechselt dann mit Pandharipadne über abzählende Geometrie. Insbesondere interessierten sie sich für die Gromov-Witten-Invarianten einer symplektischen Mannigfaltigkeit X. Formal definiert als Integral der konstanten Funktion 1 über die virtuelle Fundamentalklasse des Modulraums der stabilen Abbildungen einer Fläche vom Geschlecht g in die Mannigfaltigkeit X, kann man dann die Partitionsfunktion Σβ≠0 Σg≥0 Ng,β u2g-2 vβ betrachten.
Donaldson und Thomas hatten andere Invarianten von Schemata definiert, die ebenfalls als Integral von 1 über die virtuelle Fundamentalklasse eines Modulraums definiert waren. Sie betrachteten den Modulraum der idealen Garben (d.h. torsionsfreie Garben vom Rang 1 mit trivialer Determinante) von fester holomorpher Charakteristik n und deren Quotient OX/I isomorph zu OY für ein Unterschema Y sind, dessen maximale Komponenten einer Homologieklasse β entsprechen. Auch hier hat man eine Partitionsfunktion und in einer gemeinsamen Arbeit von Maulik, Nekrasow, Okunkow und Pandharipadne wurde vermutet, dass sie bei 3-Faltigkeiten durch eine Variablentransformation aus der Partitionsfunktion der Gromov-Witten-Invarianten hervorgeht. Sie bewiesen dies in Spezialfällen.
Am bekanntesten wurden aber Okunkows und Pandharipadnes gemeinsame Arbeiten über die Berechnung der Gromov-Witten-Invarianten glatter projektiver Varietäten. Insbesondere betrachteten sie den Fall, dass X eine komplexe Kurve ist. Nach der von Kontsevich bewiesenen Witten-Vermutung wird die Schnittheorie im Modulraum stabiler Kurven (also die Gromov-Witten-Theorie des Punktes) durch die Korteweg-de-Vries-Gleichung bestimmt – dafür gaben sie einen neuen Beweis. Allgemeiner wollten sie die Schnittheorie im Modulraum der stabilen Abbildungen einer gegebenen topologischen Fläche nach X verstehen. Für X=CP1 bewiesen sie, dass diese ebenfalls durch eine Differentialgleichung der Physik bestimmt werden. Im Fall der C*-äquivarianten Theorie auf CP1 durch eine Gleichung, die Toda betrachtet hatte und spezielle Solitonen betraf, wie sie seinerzeit in den numerischen Experimenten in Los Alamos betrachtet worden waren. Die Verbindung wurde durch mehr als hundert Jahre alte von Hurwitz untersuchte Invarianten hergestellt, die die Anzahl verzweigter Überlagerungen einer gegebenen Fläche zählen. Aus den äquivarianten kann man die nicht-äquivarianten Gromov-Witten-Invarianten der projektiven Gerade berechnen und diese sind fundamental für das Verständnis der Gromov-Witten-Theorie anderer Mannigfaltigkeiten, fundamentaler als die des Punktes.
Einer der Gründe, sich für Gromov-Witten-Invarianten zu interessieren, war ihr Vorkommen in der rekursiven Formel für die Anzahl der Kurven. Zur Berechnung solcher Anzahlen entwickelte sich vor allem durch Arbeiten von Michalkin noch ein weiterer kombinatorischer Ansatz, die tropische Geometrie. Bei dieser handelt es sich um algebraische Geometrie über dem tropischen Semiring, also den positiven reellen Zahlen mit der Addition x+y=max(x,y) und der Multiplikation x.y=x+y. (Ihren Namen hatte sie erhalten, weil ein in Brasilien lebender ungarischer Informatiker – ohne Bezug zur algebraischen Geometrie – über diesen Semiring gearbeitet hatte.)
In der tropischen Geometrie entsprechen Monome linearen Polynomen, und Summen von Monomen – also beliebige Polynome – entsprechen dem Maximum mehrerer linearer Polynome. Als tropische Varietät eines Polynoms bezeichnet man diejenigen reellen Punkte, in denen das Maximum von mindestens zwei linearen Polynomen gleichzeitg angenommen wird. Die Bilder unten zeigen die tropischen Varietäten von 0+x+(-2)x2, 0+x+y und 0+x+y+(-1)x2+1xy+(-1)y2.

Die Multiplikation im tropischen Semiring entspricht der Multiplikation in einer logarithmischen Skala, für die Addition gilt das zumindest näherungsweise, wenn die Basis des Logarithmus sehr groß ist.
Man kann nun von komplexen Zahlen zu positiven reellen Zahlen übergehen, indem man den Logarithmus des Betrags nimmt (dabei vergißt man das Argument der komplexen Zahl) und erhält damit aus einer komplexen Varietät eine reelle, die als Amöbe der Varietät bezeichnet wird.

Wenn man die Basis des Logarithmus gegen Unendlich gehen läßt, erhält man im Grenzwert die dem Polynom zugeordnete tropische Varietät.
Diese Theorie war schon älter, populär wurde sie in den Nuller Jahren durch Anwendungen auf das Kurvenzählen, insbesondere durch Arbeiten von Michalkin zur Gromov-Witten-Theorie. Statt algebraische Varietäten mit gewissen Eigenschaften zu zählen, kann man die entsprechenden tropischen Varietäten zählen. Das ist im Prinzip ein endliches kombinatorisches Problem, auch wenn seine Lösung im konkreten Fall natürlich immer noch schwierig sein kann. Es eröffneten sich so Verbindungen zu anderen Gebieten der Mathematik. Beispielsweise bewiesen Speyer und Sturmfels, dass das tropische Äquivalent des Raums 2-dimensionaler Ebenen im Cn dem Raum phylogenetischer Bäume entspricht.
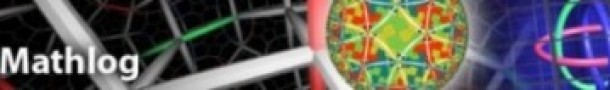
Kommentare (4)