Die Laplace-Gleichung Δu=0 im R3 beschreibt in der Physik das elektrostatische Potential im ladungsfreien Raum. Die Lösungen dieser Gleichung (auf einem beliebigen Rn) heißen harmonische Funktionen.
Die harmonischen Funktionen auf dem R2 sind in der Funktionentheorie von Bedeutung, etwa beim Beweis des Riemannschen Abbildungssatzes. Die Real- und Imaginärteile komplex differenzierbarer Funktionen sind harmonisch und umgekehrt ist jede harmonische Funktion der Realteil einer komplex differenzierbaren Funktion.
Nun weiß man aus der Funktionentheorie, dass komplex differenzierbare Funktionen nicht nur einmal, sondern unendlich oft differenzierbar und sogar analytisch (d.h. mit ihrer Taylor-Reihe übereinstimmend) sein müssen. Daraus folgt, dass auch harmonische Funktionen auf dem R2 analytisch sein müssen.
Allgemeiner läßt sich auch für harmonische Funktionen auf einem beliebigen Rn Analytizität beweisen. Obwohl die Gleichung Δu=0 eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist und ihre Lösungen zunächst nur zweimal differenzierbar sein müßten, sind ihre Lösungen also stets analytisch.
Einen ähnlichen Effekt hat man bei Minimalflächen, wo ebenfalls bereits im 19. Jahrhundert bekannt war, dass sie stets analytisch sind, obwohl sie nur durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung beschrieben werden.
Das führt zu der Frage, für welche allgemeinen Klassen von Differentialgleichungen solche Regularitätssätze bewiesen werden können.
Man unterscheidet Differentialgleichungen von elliptischem, parabolischem und hyperbolischem Typ. Partielle Differentialgleichungen haben je nach Typ sehr unterschiedliche Eigenschaften. Die Laplace-Gleichung ist von elliptischem Typ wie auch allgemein Differentialgleichungen
Motiviert durch die Laplace-Gleichung und die Minimalflächengleichung hatte Hilbert 1900 als neunzehntes seiner dreiundzwanzig Probleme die Vermutung aufgestellt, dass die Lösungen elliptischer partieller Differentialgleichungen (mit analytischen Koeffizienten) stets analytisch sein sollen.
Hilberts Problem wurde bereits 1903 von Sergei Bernstein (damals Doktorand in Göttingen, er promovierte dann 1904 an der Sorbonne und noch einmal 1913 in Charkow, weil ausländische Doktortitel dort nicht anerkannt wurden) gelöst unter der zusätzlichen Annahme, dass die dritten Ableitungen der Lösungen existieren und beschränkt sind.
Bernsteins Beweis nutzte Techniken für a-priori-Abschätzungen für Lösungen und ihre Ableitungen mittels Linearisierungen nichtlinearer Gleichungen in einer Umgebung der Lösung. Der Name “a-priori-Abschätzung” bezieht sich darauf, dass man a priori von Existenz und Glattheit der Lösung ausgeht um Abschätzungen für die zweiten und höheren Ableitungen von f in Abhängigkeit von Schranken für f und die ersten Ableitungen (sowie die Ableitungen der Koeffizienten) zu beweisen. Bernstein wandte seine Methoden dann auf die (quasilineare) Minimalflächengleichung an und bewies 1915, dass ein Funktionengraph im R3 nur dann eine Minimalfläche ist, wenn er eine Ebene, die Funktion also linear ist.
Die Gründe für die Bedeutung von a-priori-Abschätzungen wurden eigentlich erst mit den Arbeiten von Leray und Schauder verstanden: man kann Fixpunktsätze anwenden sobald man die richtigen a-priori-Abschätzungen hat.
Der 1930 bewiesene Fixpunktsatz von Schauder ist eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes auf unendlich-dimensionale Räume. Er besagt, dass für eine kompakte, konvexe Teilmenge C eines Banach-Raumes jeder stetige Operator T:C–>C einen Fixpunkt hat. Insbesondere kann man das auf kompakte Operatoren auf Banach-Räumen X anwenden, sobald das Bild C:=T(X) konvex ist.
Eine elementare Anwendung ist der Beweis des Satzes von Peano, dass eine gewöhnliche Differentialgleichung mit stetiger (nicht notwendig Lipschitz-stetiger) rechter Seite eine lokale Lösung hat. Man betrachtet den Operator
Ein interessanteres Beispiel: für eine geeignete Funktion f auf einem Gebiet Ω sucht man Lösungen von
Auf ähnliche Weise bekommt man auch Lösungen hochgradig nichtlinearer Gleichungen. Ein einfaches Beispiel sei die Differentialgleichung
Schauder, damals Gymnasiallehrer in Lviv, hatte dank eines Stipendiums mit Lichtenbaum in Leipzig und mit Leray an der Sorbonne zusammenarbeiten können. Mit Leray definierte er 1933 einen Abbildungsgrad für Operatoren der Form Id+K:M—>Y mit K kompakt. Ihre Definition hängt von zunächst von einem Punkt y in Y ab und sie nahmen an, dass es keine Urbilder von Id+K für y auf dem Rand von M gäbe; nur unter dieser Bedingung ist der Abbildungsgrad deformationsinvariant. Diese Annahme sollte gerechtfertigt werden, indem sie mit a-priori-Abschätzungen erreichten, dass alle Bildpunkte in einer Kugel (und nicht auf dem Rand) liegen – dann kann man Fixpunktsätze anwenden.
Ist der Abbildungsgrad nicht Null, folgt aus der Deformationsinvarianz (letztlich also aus den a-priori-Abschätzungen) die Lösbarkeit für jede rechte Seite y. Damit bewiesen sie Existenzsätze für quasilineare Gleichungen 2. Ordnung in der Ebene.
Für lineare, gleichmäßig elliptische Gleichungen bewies Schauder a-priori-Abschätzungen in Abhängigkeit der Hölder-Normen der Koeffizienten. Eine Anwendung auf nichtlineare Gleichungen gelang erstmals 1938 Morrey.
Neben der Theorie der Minimalflächen, wo Radó und Douglas 1930 erstmals allgemeine Existenzsätze bewiesen, blieb die Leray-Schauder-Theorie noch für lange Zeit die einzige entwickelte Theorie für partielle Differentialgleichungen.
Ein weiteres der Hilbertschen Probleme hatte nach der Existenz von Lösungen von Randwertproblemen gefragt. Klassisches Beispiel ist das Dirichlet-Problem Δu=0 auf D2 mit vorgegebenen Randwerten f. Die Lösung dieses Problem ist äquivalent dazu, das Integral
Als großer Durchbruch und ihrer Zeit lange voraus galt die 1934 in Acta Mathematica veröffentlichte Arbeit „Sur le mouvement d’un liquide visqueux emplissant l’espace“. Jean Leray fand dort schwache Lösungen für die Navier-Stokes-Gleichungen, die die Strömung von linear-viskosen Flüssigkeiten oder Gasen beschreiben. Angeblich soll er durch die Beobachtung von Strudeln und Wirbeln der Seine an den Pfeilern des Pont Neuf zur Suche nach nichtglatten Lösungen der die Strömung linear-viskoser Flüssigkeiten beschreibenden Navier-Stokes-Gleichungen
Eine schwache Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen ist eine L2-Funktion, deren schwache Ableitung (im Sinne der später von Schwartz definierten Distributionen) wieder L2 ist und die die schwache Version der Gleichungen erfüllt, also
für alle
Leray dachte sich diese schwachen Lösungen als Fortsetzung der glatten Lösung über die Singularitäten hinaus und bezeichnete sie als “turbulente Lösungen”: ihre Singularitäten sollten die Turbulenz beschreiben.
Schwache Lösungen waren schon früher betrachtet worden, das Konzept des Funktionals ging auf Hadamard zurück. Sergei Sobolew war dann aber der erste, der in seinen Arbeiten über hyperbolische Differentialgleichungen dieses Konzept ausarbeitete und systematisch anwandte.
Aus der Hölder-Ungleichung folgt, dass für 1/p+1/q=1 der Raum der Lq-Funktionen das Dual des Raums der Lp-Funktionen ist, wobei die Dualität durch Integration des in L1 liegenden Produktes realisiert wird. Man betrachte nun nur Funktionen mit kompaktem Träger, die also im Unendlichen verschwinden. (Für solche Funktionen folgt aus Differenzierbarkeit automatisch die Lq-Bedingung.) Wenn die Funktionen f aus Lp und g aus Lq differenzierbar wären, hätte man durch partielle Integration die Identität
Die Crux dieses Ansatzes ist, dass man auf diese Weise häufig nicht nur schwache, sondern auch “echte” Lösungen der Differentialgleichung bekommt. Sobolew bewies nämlich mittels Normabschätzungen einen Einbettungssatz: sobald (für die Dimension d des zugrundeliegenden Raumes) die Ungleichung k-d/p > m gilt, hat man eine stetige Einbettung des Raums Wk,p der k-fach differenzierbaren Lp-Funktionen (mit der naheliegenden Norm, in der er dann die Vervollständigung des Raums der unendlich oft differenzierbaren Funktionen ist) in den Raum der Cm-Funktionen. Mit anderen Worten: jede im obigen Sinne k-fach differenzierbare Lp-Funktion ist eine Cm-Funktion, also m-mal “echt” differenzierbar.
Um eine Differentialgleichung m-ter Ordnung mit m-fach differenzierbaren Funktionen zu lösen, mußte man also nur k groß genug wählen – so dass k-d/p>m – und dann die entsprechende Differentialgleichung für k-fach differenzierbare Lp-Funktionen lösen. Der neue Ansatz demzufolge: finde schwache Lösungen einer Differentialgleichung und beweise anschließend ihre Regularität. Weiter hat man nach dem Satz von Rellich-Kondrachov für passende p,q kompakte Einbettungen von W1,p in Lq (der klassische Fall bei Rellich war p=q=2), was nützlich sein kann, um mit dem Schauderschen Fixpunktsatz Lösungen von Differentialgleichungen zu bekommen.
Wenn man beispielsweise nach (zweimal differenzierbaren) Lösungen von Δu=0 sucht, dann verschwindet einerseits das Integral von grad(u).grad(φ), was aber immer noch u einmal differenzerbar voraussetzt, und aber auch das Integral von u.Δφ, was für jede L2-Funktion u Sinn macht. Ein zu dieser Zeit von Hermann Weyl bewiesenes Lemma für die Gleichung Δu=0 zeigt, dass selbst diese schwächstmögliche Formulierung noch klassische Lösungen liefert.
(Später fand man heraus, dass man für elliptische Operatoren D oft eine Ungleichung der Form
Mit Sobolews Ansatz bekam man im Prinzip beliebig gute Differenzierbarkeitsresultate, aber keine Analytizität. Hilberts ursprüngliches Problem über Analytizität der Lösungen elliptischer partieller Differentialgleichungen war im Laufe der Jahre in verschiedener Hinsicht verallgemeinert worden. Einen gewissen Höhepunkt erreichten diese Verallgemeinerungen dann mit der Arbeit von Morrey, der einen allgemeinen Regularitätssatz für quasi-lineare elliptische partielle Differentialgleichungen bewies. Dabei führte er ähnliche Funktionenräume wie Sobolew ein.
Sobolews Arbeiten brachten ihm in der Sowjetunion große Anerkennung. Nachdem er schon mit 27 Jahren die Abteilung für Differentialgleichungen am Steklow-Institut geleitet hatte, wurde er mit 31 Jahren Vollmitglied der Akademie und blieb dort viele Jahre das jüngste Mitglied. Nach Kriegsausbruch wurde er dann bis zum Kriegsende Direktor des Instituts und war in dieser Zeit in das Atombombenprojekt eingebunden. Als einer der ersten sah er die Bedeutung des Wissenschaftlichen Rechnens und der Kybernetik voraus. Dabei formulierte er deren Probleme aber stets im Rahmen der theoretischen Mathematik: “Die numerische Mathematik ohne Banach-Räume zu begreifen ist ebenso unmöglich wie sie ohne Rechenmaschinen zu begreifen.” In der Grundlagenforschung war er aber während des Krieges und in den Jahren danach nicht aktiv, seine Arbeiten blieben im Westen unbekannt.
In den 40er Jahren arbeitete Laurent Schwartz in Frankreich die Theorie der “Distributionen” (verallgemeinerten Funktionen) aus, nicht wissend, dass diese bereits in der Sowjetunion von Sobolew entwickelt worden war. Seine Theorie – die wie bei Sobolew verallgemeinerte Funktionen als Elemente im Dualraum der “Testfunktionen” (unendlich oft differenzierbarer Funktionen mit kompaktem Träger) ansah – betonte im Stil Bourbakis sehr viel mehr die strukturellen Aspekte und systematisierte damit auch andere frühere Ansätze. Physiker beispielsweise hatten häufig mit einer Dirac-Funktion gerechnet, die in einem Punkt x0 unendlich groß und sonst überall Null ist. Er formalisierte das als verallgemeinerte Funktion δ, die jeder Testfunktion f den Wert f(x0) zuordnet. Das wurde dann nützlich für die Konstruktion von Fundamentallösungen zu partiellen Differentialgleichungen.
Leser seiner Arbeit waren beeindruckt, wie harmonisch der gesamte Kalkül zusammenpaßte. Beispielsweise konnte er für eine Teilmenge seiner Distributionen eine Transformation definieren, die im klassische Fall der Zerlegung einer Funktion in die Koeffizienten trigonometrischer Polynome entsprach, und unter der die (analog zur Faltung von Funktionen definierte) Faltung von Distributionen gerade der Multiplikation von Funktionen entsprach. Eine der zahlreichen Anwendungen (neben der Lösbarkeit von Differentialgleichungen) war etwa, dass sich Hadamards Begriff des endlichen Anteils eines divergenten Integrals jetzt sehr viel natürlicher formulieren ließ.
Bild: https://www.math.nsc.ru/conference/sobolev/100/english/Sobolev_SL_2.jpg
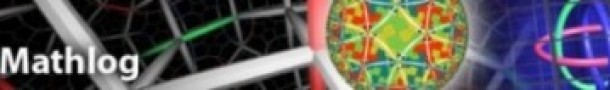

Kommentare (27)