Der Entwurf des „Gesetzes zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit“, der sich bis zum 2. Juli in der Verbändeanhörung befindet und anschließend am 17. Juli zur Beschlussfassung ins Kabinett soll, hat in letzter Sekunde noch einen richtigen Wermutstropfen mitbekommen. Zur Finanzierung der Mehrausgaben hieß es plötzlich:
„Mehrbedarfe im Bereich des Bundes sollen finanziell und (plan-)stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan gegenfinanziert werden. Über die Einzelheiten zur Deckung der Mehrbedarfe wird im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden sein.“
Es geht dabei um 19,3 Mio. Euro einmalige Investitionskosten und 30 Mio. Euro jährliche Kosten. Das sind, wie es in Finanzmagnatendeutsch so schön heißt, Peanuts. Die Regelung bedeutet, dass Christian Lindner aus dem Schneider ist und das Gesetz nicht blockieren wird und Karl Lauterbach die Mittel, zunächst die für 2025, aus dem eigenen Haushalt aufbringen muss. Womöglich durch Kürzungen beim RKI, das man aber eigentlich stärken wollte. Und was danach kommt, steht in den Sternen, sprich „im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungen“.
Derzeit ist beispielsweise offen, ob die im Aufbau befindliche Mental Health-Surveillance am RKI eine solide Finanzierung für die nächsten Jahre bekommen wird. Obwohl doch die psychische Gesundheit der WHO zufolge „ganz oben auf der politischen Tagesordnung“ stehen sollte. Kurioserweise zweifelt Karl Lauterbach auch nicht daran, dass das Geld kostet – in der Ukraine:
„Putins mörderischer Angriffskrieg fordert nicht nur viele Menschenleben und unzählige Verletzte. Das andauernde Leid, der Verlust von Angehörigen und die dramatischen Erfahrungen traumatisieren ganze Generationen. Es gibt Kinder in der Ukraine, deren erste Erinnerung das Einschlagen von Bomben ist. Deshalb unterstützen wir als Bundesregierung das ukrainische Gesundheitswesen stark in allen Bereichen, aber insbesondere auch bei der mentalen Gesundheit.“
Dafür gibt es 100 Mio. Euro. Das ist sicher gut investiertes Geld. Das Land will schließlich eines Tages wieder aufgebaut werden und gesunde Menschen sind die besseren Arbeitskräfte. Nur, gilt das nicht auch in Deutschland? Interessanterweise wird die Prävention hierzulande, wie das Gesundheitswesen insgesamt, meist nicht unter Investitionsaspekten betrachtet. In den Medien liest man eher von der Kostenexplosion bei den Gesundheitsausgaben, die man sich nicht mehr leisten könne.
In Heft 4/2024 der Hauszeitschrift des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat dessen Präsident, Moritz Schularick, einen Artikel unter der Überschrift „Aufrüsten für den Wohlstand“ veröffentlicht. Er plädiert darin für höhere Rüstungsausgaben, um das Wirtschaftswachstum in Deutschland anzukurbeln. Der Ökonom Günther Grunert hat dazu in Makroskop gerade eine bissige Kritik veröffentlicht. Wer sich für die ökonomischen Argumente interessiert, mag es dort nachlesen. Nur nebenbei, eigentlich argumentiert Schularick wie Putin. Putin zufolge stärken die Rüstungsausgaben für den Ukrainekrieg die russische Wirtschaft und steigern den Wohlstand der Russen. Nun denn, dem widersprechen sonst westliche Ökonomen gerne.
Dagegen ist unstrittig, dass Gesundheitsausgaben, richtig eingesetzt natürlich, die Gesundheit und damit die Leistungsfähigkeit der Menschen erhalten, auch die der Beschäftigten. Das gilt ganz besonders für die Prävention.
Gestern ist bei der 10. kbo-Fachtagung in München eindrucksvoll herausgestellt worden, wie wichtig eine gute und umfassend angelegte Prävention psychischer Störungen wäre und wie erfolgreich Präventionsmaßnahmen z.B. zur Unterstützung belasteter Eltern durch die „Frühen Hilfen“ oder Projekte der gesunden Schule sind.

Sollten wir also nicht auch im Gesundheitsbereich „aufrüsten für den Wohlstand“? Zumal hier wirklich gesellschaftliche Werte geschaffen werden, volkswirtschaftlich sogar reproduktive, nämlich Humankapital. Es müssen ja nicht gleich 100 Mio. Euro für’s BIPAM sein, man könnte mit 50 Mio. anfangen und alles Weitere „im Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren entscheiden“. Herr Schularick, was meinen Sie?
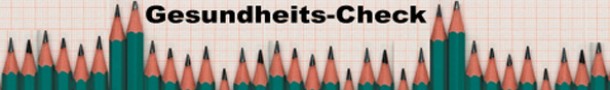



Kommentare (11)