1. Delegieren Sie unangenehme Aufgaben an junge Mitarbeiter:innen, bevorzugt Frauen. Die wollen sich bewähren.
2. Oder lassen Sie Unangenehmes für Ihre Urlaubsvertretung liegen. Sie haben es einfach nicht mehr geschafft, weil Sie so viel erledigen mussten, was Sie, fürsorglich wie Sie sind, der Vertretung nicht aufbürden wollten.
3. Unerwünschte Vorschläge wiegeln Sie zunächst in bewährter Weise ab: „Das haben wir hier in der Abteilung noch nie so gemacht.“ Das zeigt Ihre Erfahrung und die Unerfahrenheit der Anderen.
4. Wenn jemand hartnäckiger mit seinem Vorschlag ist: Loben Sie ihn und verweisen Sie darauf, dass man das grundsätzlicher angehen muss, fordern Sie ein Konzept ein, geben Sie es in die Gruppe. In der Regel wird es da zerredet. Wenn das nicht hilft: Lassen Sie es von externen Fachleuten bewerten (die natürlich Sie ausgesucht haben).
5. Alternativ können Sie auch dem Vorschlagenden die Umsetzung übertragen, aber ohne ausreichende Ressourcen. Er wird Ihnen beweisen wollen, dass es geht und sein Scheitern wird ihn lehren, keine Vorschläge mehr zu machen.
6. Wenn von den Mitarbeiter:innen jemand Ihre Autorität infragestellt: Warten Sie, bis er oder sie einen Vorschlag macht. Dann nach Nr. 5 vorgehen.
7. Teilen Sie nie alle Informationen. Wissen ist Macht. Wer nicht alles weiß, ist bei Bedarf mit dem Hinweis „was Sie nicht wissen konnten“ leicht einzuschüchtern.
8. Fassen Sie Anweisungen unklar ab. Die Mitarbeiter:innen müssen dann selbst überlegen, was Sie gemeint haben könnten. Wenn es schiefgeht: Sie haben es anders gemeint.
9. Zeigen Sie Ihre strategische Weitsicht. Wenn man auf Ihre Vorschläge mit detaillierten Einwänden reagiert, stellen Sie es als Petitessen und kleinkariert hin.
10. Sie können Petitessen aber auch selbst einsetzen. Zeigen Sie damit den anderen, dass diese die Komplexität eines Vorhabens nicht durchschaut haben und Sie in der Sache einfach kompetenter sind. Das funktioniert auch dann gut, wenn Sie selbst die Komplexität eines Vorhabens nicht durchschauen.
11. Wenn alles nichts hilft: Der Satz „Ich bin der Chef hier“ hilft immer. Aber Ihr Ansehen ist danach ruiniert. Den Satz „Bin ich nur von Idioten umgeben“ sollten Sie dagegen meiden, man könnte leicht „Primus inter Pares“ dazudenken.
12. Widersprechen Sie nie Ihren Vorgesetzten. Die kennen die Spielregeln auch und können Sie noch effektiver einsetzen als Sie.
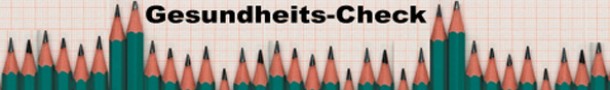



Kommentare (8)