Man kann sich über Karl Lauterbachs Gesetzentwürfe und Politikstil die Haare raufen, aber er hat Recht, wenn er sagt, wir geben viel Geld für vergleichsweise wenig Nutzen aus.
In der Süddeutschen Zeitung (online gestern, Printausgabe heute) schreibt Werner Bartens:
„Wer sich den Zustand des deutschen Gesundheitswesens in allen seinen miserablen Details vergegenwärtigt, könnte permanent den Kopf auf den Tisch hauen – wäre man nur anschließend nicht auf eben jenes Gesundheitswesen angewiesen. Dabei hätte es eigentlich ideale Voraussetzungen: Es gibt ein dichtes Netz an Krankenhäusern im Land. Es gibt eine Vielzahl Haus- und Facharztpraxen. Vor allem aber gibt es Tausende hingebungsvoller Ärzte und Pflegekräfte.“
Bartens verweist wie Lauterbach auf internationale Vergleichsdaten. Internationale Vergleiche hinken zwar oft mit allen Beinen, die sie haben, aber in der Tat, ein richtig gutes Bild gibt Deutschland dabei nicht ab.
Im September erst ist eine Studie von Blumenthal et al. erschienen, basierend auf 70 Indikatoren in 5 Themenbereichen zur Beschreibung des Gesundheitswesens. Die Studie zielt zwar eigentlich auf das amerikanische Gesundheitssystem ab, stellt dazu aber einige Ländervergleiche an. Deutschland ist auch darunter und bekommt nach den USA die zweitschlechteste Note:

Die Autor:innen attestieren Deutschland eine gute Zugänglichkeit des Gesundheitswesens und wenig soziale Unterschiede in der Versorgung, aber miserable Abläufe und Outcomes. Diese Situation spiegelt sich auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung wider: Das Vertrauen in das Gesundheitssystem sinkt.
Werner Bartens beklagt in seinem SZ-Kommentar vor allem ökonomische Fehlanreize. Hier wird man sicher einen Teil der Probleme festmachen können. Natürlich gibt es massive ökonomische Fehlanreize im Gesundheitswesen: Die berüchtigten Knieimplantate und andere Operationen, deren wirtschaftliche Co-Indikation manchmal schon an der regionalen Verteilung ablesbar ist, sind nur eines von vielen Beispielen, Bartens nennt weitere und hat sich in seinen Büchern die Finger zu dem Thema wund geschrieben.
Aber auch im Gesundheitswesen ist nicht der ökonomische Blick an sich falsch, sondern der ökonomische Blick in die falsche Ecke. Ohne ökonomische Verantwortung würde es im Gesundheitswesen ganz sicher nicht gehen. Geld soll schließlich möglichst da eingesetzt werden, wo es den meisten Nutzen bringt und nicht da, wo man es aus irgendwelchen Gründen gerne ausgeben würde.
Es gibt keine evidenzbasierte Medizin ohne Ökonomie. An vielen Stellen braucht es sogar mehr Ökonomie, aber eben an den richtigen Stellen. Die Vorstellung einer „Entökonomisierung“ des Gesundheitswesen, wie sie Lauterbach beim Ärztetag 2023 propagiert hat, ist ebenso realitätsfremd wie unethisch, weil ineffiziente Strukturen und Abläufe Geld verbrennen, das für eine gute Versorgung gebraucht wird. Auch hier geht es um Ideologiekosten im Gesundheitswesen.
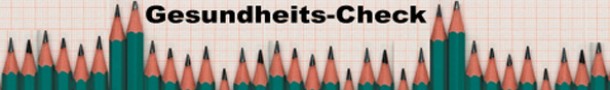



Kommentare (3)