Verbindliche Regeln sind im Moment etwas außer Mode geraten, weltweit, aber auch in Europa und Deutschland. Es gilt statt dessen immer öfter der Grundsatz, jeder macht, was er für richtig hält. Der homo oeconomicus hält gewissermaßen Einzug in den Umgang mit Recht und Ordnung. Trendsetter ist Donald Trump.
In diesem Punkt auf der Höhe der Zeit hat die Union mit Friedrich Merz an der Spitze gerade einen voluntaristischen Umgang mit dem Recht in der Migrationspolitik propagiert: Da die europäischen Regeln ohnehin nicht funktionieren, müsse man sich darüber hinwegsetzen und tun, was Deutschland nütze. Die anderen würden das schließlich auch so machen.
Franz Josef Strauß, der Säulenheilige der CSU, hat zwar selbst gelegentlich einen flexiblen Umgang mit dem Recht gepflegt, aber im internationalen Geschäft hat er Wert auf Vertragstreue gelegt, ihm waren die Konsequenzen bewusst, wenn man sich um Vereinbarungen nicht mehr schert. So hat er selbst die von der Union abgelehnten Ostverträge der sozialliberalen Koalition unter Brandt nicht infrage gestellt. Im Gegenteil: Mit der Formel „pacta sunt servanda“ hat er die Notwendigkeit ihrer Anerkennung betont und in der Union zustimmungsfähig gemacht.
Die Formel bringt eine sich über Jahrhunderte vollziehende Entwicklung der Verbindlichkeit von Verträgen auf den Punkt und gilt inzwischen auch im Völkerrecht. Internationale Verträge stehen grundsätzlich über nationalen Gesetzen. Wenn Verträge nicht eingehalten werden, aber im Prinzip die Dinge vernünftig regeln, muss die Nichteinhaltung sanktioniert werden. Wenn Verträge schlicht nicht funktionieren, müssen sie geändert werden. Darauf verweist Ronen Steinke heute in der Süddeutschen Zeitung und so würde ich das auch sehen, aber ich bin kein Jurist.
Das “Dublin-Verfahren“, nach dem Flüchtlinge dort registriert werden sollten, wo sie europäischen Boden betreten, also vor allem in Griechenland, Italien und Spanien, hat nicht funktioniert. Seine Nichteinhaltung hat die EU nicht ernsthaft sanktioniert und die Ratio dieses Systems, das die Lasten unter den europäischen Staaten höchst ungleich verteilt, habe ich ohnehin nie verstanden. Aber ich bin, wie gesagt, kein Jurist. Aus meiner Sicht war es, dem Grundsatz pacta sunt servanda folgend, richtig, das nicht funktionierende System neu zu verhandeln. Ergebnis ist das „Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS)“.
Ob man jetzt trotzdem einfach machen soll, was man selbst für richtig hält? Was wohl Franz Josef Strauß dazu sagen würde? Auch er war kein Jurist. Friedrich Merz ist Jurist. Vielleicht entdeckt er gerade seine Sponti-Seite: „Legal, illegal, scheißegal“?
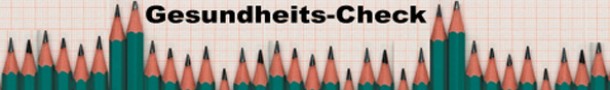



Kommentare (3)