Wissen
Vor wenigen Jahren ist das Buch „Die Epistemisierung des Politischen“ des Soziologen Alexander Bogner erschienen. Der Untertitel lautet „Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet“. Dieser Untertitel mag irritieren, schließlich wünschen wir uns angesichts von Klimawandel, Artenschwund, weltweitem Hunger und anderen globalen Problemen, die Politik möge doch mehr auf die Wissenschaft hören und Vernunft annehmen, statt der Zerstörung der Welt zuzusehen oder sie gar noch zu voranzutreiben.
Mehr Evidenzbasierung des politischen Handelns wäre natürlich gut, aber Bogner weist zurecht darauf hin, dass die Politik Interessenkonflikte nicht als Wissensfragen präsentieren darf und Lösungen als scheinbar alternativlos, weil wissenschaftlich geboten, ausgeben. Die Datenlage determiniert nie das, was zu tun ist, das wäre schlicht ein Sein-Sollen-Fehlschluss und Handlungsalternativen sind meist nicht neutral im Hinblick auf die damit verbundenen Interessen.
Macht
In der Tech-Szene setzt man dagegen ganz bewusst darauf, dass alle Probleme, die wir haben, als technische Probleme zu formulieren und zu lösen sind. Es ist kein Zufall, dass viele Tech-Milliardäre an diesem „Solutionismus“ Gefallen finden. Sie würden gerne die Lösungen anbieten, vielleicht auf dem Mars, wenn man sie doch nur ließe und nicht durch demokratische Fesseln behindern würde. Sie stehen nicht für die antiautoritäre Nerdkultur des frühen Internets, sondern für einen egomanen autoritären Libertarismus. Das geht daher einher mit einem anderen modernen Schlagwort, der „Disruption“. Damit wird der radikale Bruch mit bisherigen Verfahren und Institutionen bezeichnet, um durch Zerstörung etwas Neues entstehen zu lassen, aus der Hand der Visionäre, die dazu das Geld und den Mut haben, sozusagen Schumpeter für Reiche. Der frühere FPD-Chef Christian Lindner war ein Fan disruptiver Politik, er wollte etwas „mehr Musk und Milei“ wagen, formuliert wie eine Gegenthese zu Brandts „Wir wollen mehr Demokratie wagen“. Wobei das damals auch „disruptiv“ war, nur nicht technokratisch elitär verstanden.
Das technokratisch-disruptive Denken ist erkennbar anschlussfähig an die Begriffswelt des frühen Faschismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dort gab es ebenfalls eine Verherrlichung der Tat, der Entscheidung, der Beschleunigung und der Technik. Das Alte sollte dem Neuen Platz machen. Was dem im Wege stand, wurde nach Carl Schmitts Politikverständnis als „Feind“ identifiziert und aus dem Weg geräumt, im deutschen Nationalsozialismus auch alles, was „schwach“ war, was nicht folgen konnte oder wollte oder was nicht zum Bild des arischen Übermenschen gepasst hat.
Technik
Diesen Parallelen geht der Osnabrücker Philosoph und Mathematiker Rainer Mühlhoff in seinem vor kurzem veröffentlichten Buch „Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus“ nach. Er beschreibt das Mindset des neuen Futurismus, seine elitären und inhumanen Elemente, dazu die technischen Komplemente etwa bei der subsymbolischen KI. Und er beschreibt, was dabei die Tech-Szene mit den Protagonisten der „Dunklen Aufklärung“ um Leute wie Curtis Yarvin oder Hans-Hermann Hoppe verbindet. Demokratische Gesinnung ist es nicht.
Die deprimierenden Entwicklungen in der Welt – Klimawandel, Kriege, Hunger usw. – und dass das liberale Versprechen „Wohlstand für alle“ nicht eingelöst wird, die Globalisierungsgewinne nicht gerecht verteilt werden, lässt viele Menschen fragen, ob die liberale Demokratie nicht ein falsches Versprechen war und das Recht, zu wählen, nicht viel wert. Das macht Hoppes Forderung, die Demokratie, „den Gott, der keiner ist“, zu stürzen, kaputt zu machen, was einen kaputt macht, verführerisch.
Demokratie
Wer in dieser Situation Disruption als politische Reformstrategie empfiehlt, jenseits der banalen Tatsache, dass man manchmal bürokratisches Paragrafengestrüpp roden muss, wer also im politischen Fundament mehr Musk und Milei will, sollte Antworten mitliefern, wie das demokratisch gehen kann. Wie kann eine disruptive Politik aussehen, die nicht die Vorstellungen einer Elite gewaltsam durchsetzt, der es nicht gleichgültig ist, wenn Schwache dabei unter die Räder kommen, die darauf achtet, dass am Ende alle profitieren und nicht nur Auserwählte oder solche, die sich dafür halten.
Ohne gute Antworten sind vielleicht doch die langsameren, umständlicheren, partizipativeren, inklusiven Verfahren, die wir haben, vorzuziehen. Man kann sie ja verbessern. Autokratische Systeme sind zudem auch nicht per se „effizienter“, sie sind nur rücksichtsloser. Effizienz ist immer danach zu bemessen, welches Ziel verfolgt wird. Die Möglichkeit, dass sich alle in die demokratische Willensbildung einbringen können, sollte eines der politischen Ziele in Deutschland bleiben. Diese Möglichkeit musste historisch mühsam erkämpft werden, einmal verloren, wird sie nicht einfach wieder zurückzubekommen sein.
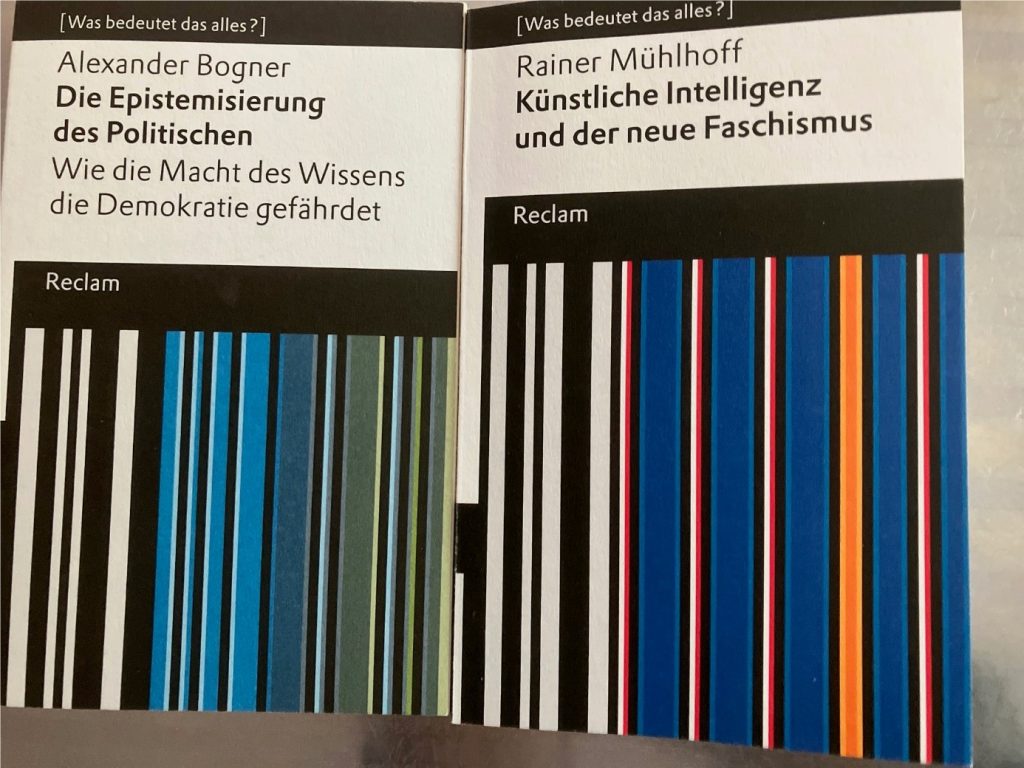
Zwei Bücher im stummem Dialog. Foto: JK




Kommentare (20)