Walohrschmalz.
Wer jemals einen eleganten Finnwal in seiner Anmut bewundert hat oder mit Staunen das Unterwasserballett eines Buckelwals betrachtete, wird sich normalerweise nicht fragen, ob diese wunderbaren Meereskreaturen über Ohrschmalz verfügen.
Aber ja, das haben sie.
In solcher Menge, dass es sogar regelrechte Pflöcke oder Pfropfen bildet. So fest und haltbar wie Knochen.
Pflöcke aus verfestigtem Walohrschmalz – earplugs) – davon hat das Smithsonian National Museum of Natural History in seinen Sammlungen etwa 1000 Stück. Der größte Teil der Sammlung stammt aus der Endzeit des kommerziellen Walfangs, einzelne Stücke sind auch älter, manche Exemplare kamen durch Walstrandungen in die Sammlung. Seit langem ist bekannt, dass diese Ohrpflöcke die Altersbestimmung von Bartenwalen ermöglichen.

Illustration of a blue whale earplug. (A) Schematic diagram showing the location of the earplug within the ear canal: (a) whale skull, (b) tympanic bulla, (c) pars flaccida/tympanic membrane (“glove finger”), (d) cerumen (earplug), (e) external auditory meatus, (f) auditory canal, (g) muscle tissue, (h) blubber tissue, and (i) epidermis. (B) Extracted blue whale earplug; total length 25.4 cm. (C) Earplug longitudinal cross-section. (D) View (20×) of earplug cross-section showing discrete laminae. (Trumble et al: “Blue whale earplug reveals lifetime contaminant exposure and hormone profiles”; 2013)
Wale besitzen zwar keine nach außen sichtbaren Ohrmuscheln, aber natürlich haben sie ein Gehör. Der Hörsinn ist bei Walen sogar hervorragend entwickelt, schließlich funktioniert dieser Sinn auch in trüben oder dunklen Gewässern mit geringer oder keiner Sicht. Die Waltiere haben das ohnehin leistungsstarke Säugetierohr noch weiter perfektioniert, durch ihre asymmetrischen Schädel können sie unter Wasser sogar hören, aus welcher Richtung Geräusche kommen.
Der äußere Gehörgang ist allerdings nach außen verschlossen, damit kein Wasser ins empfindliche Innenohr mit dem akustischen und Schweresinn eindringt. Ein Walohr sondert, vom Tag der Geburt des Tieres an, ein Gemisch aus Lipiden, Wachsen und Keratin in den äußeren Gehörgang ab, erklärt der Meeresbiologe Randall W. Davis (Texas A&M at Galveston), ein auf Meeressäuger spezialisierter Physiologe. „There’s a remnant of the external auditory canal, but it isn’t open to the environment. Oil is still secreted in the ear, but it accumulates in this marvelous organic matrix that has been laid down in very distinct layers.” Da der Gehörgang nach außen abgeschlossen ist, fließt das Öl-Sekret (Cerumen) nicht ab, sondern sedimentiert im Gehörgang. Die Sekrete härten nach und nach aus, und bilden so Schichten wie die Wachstumsringe eines Baumes.
Ohrpflöcke als Altersausweis
Um das Jahr 1900 hatten Wal-Experten herausgefunden, dass diese Schichten aus dem Ohr der Meeressäuger wirklich Wachstumsschichten sind und man aus ihnen das Alter des Wals recht genau bestimmen kann. Dickere Schichten erscheinen heller, sie entsprechen einem besseren Nahrungsangebot. Schmalere Schichten erscheinen dunkler, sie entsprechen einem schlechten Nahrungsangebot oder Stress. Die hellen und dunklen Schichten wechseln sich deutlich sichtbar ab, wie in der Biochronologie üblich. Genau wie bei Bäumen.
Diese Ohrpflöcke entstehen übrigens nur bei großen Walen, sie sind nachgewiesen bei Zwerg-, Sei-, Finn, Blauwalen und Glattwalen. Bei kleineren Cetaceen sind die Ohren anders aufgebaut, dort sedimentiert kein Ohrschmalz.
(Anmerkung meertext: Soweit ich das sehe, besteht der Unterschied in der unterschiedlichen Anatomie des Gehörs von Barten- und Zahnwalen, diese Aussage habe ich allerdings in der Literatur so nirgendwo bestätigt gefunden. Für Pottwale, also die einzigen großen Zahnwale, habe ich noch nie einen Hinweis auf Ohrpflöcke gefunden – und das Pottwal-Gehör ist wirklich gut untersucht.)
Vor etwa fünf Jahren kam der Biologe Stephen J. Trumble, der Tierphysiologie-Professur an der Baylor University und Experte für Physiologie von Meeressäugern ist, ins Gespräch mit seinem Kollegen Sascha Usenko. Der ist als Chemiker spezialisiert auf Luft- und Umweltchemie und leitet das Baylor’s Environmental Science Graduate Program. Ihr Gespräch drehte sich um die Ohrpflöcke der Wale. Usenko meinte, dass ihn das sehr an Sedimentbohrkerne mit ihren Schichtungen erinnern würde, die ja ein wichtiges Klima- und Umweltarchiv seien. Schließlich sind Bohrkerne aus dem Sediment, Eis oder Korallenriffen (oder andere Bohrkerne) längst wichtige Klima- und Umweltarchive. In ihren Schichten sind chemische Informationen aus ihrer Umgebung zum Zeitpunkt der Ablagerung eingefangen.
Irgenwann schauten sich die beiden Wissenschaftler an und ein neues Forschungsprojekt war “geboren“.
Was könnte ein „Bohrkern“ aus einem Walohr verraten?

A selection from the 400-sample-strong whale earplug collection at the National Museum (NBCNews)
Zunächst machten sich die beiden auf die Suche nach solchen Ohrpflöcken. Sie kontaktierten Charley Potter, der zu dem Zeitpunkt der Hüter (Collection Manager) der Wirbeltier-Sammlungen des Smithsonians war. Der freute sich natürlich über die Anfrage, denn: “It’s a good example of specimens which were collected for one purpose many, many years ago—the first ones were collected at the turn of the 20th century or so—and now as we find another way to interrogate these specimens, we’re able to discover that they have a whole other story to tell”. Das ist schließlich das wichtigste Anliegen eines Museumssammlungs-Managers, seine Objekte zum Sprechen zu bringen.
Natürlich hatte er Walohrpflöcke.
Sogar ziemlich viele. In den späten 1960-er Jahren, als der industrielle Walfang der USA zu Ende ging, hatte das Bureau of Fisheries (heute: National Marine Fisheries Service) in weiser Voraussicht noch eine große Menge von Gewebeproben der toten Wale gesammelt. Das Probenmaterial kam schließlich in die Sammlungen des Smithsonian, palettenweise.
Dann berieten Trumble, Usenko und Potter, wie man weiter vorgehen könne und was das Ohrschmalz aussagen könnte.
Dann suchten sie sich den Ohrpflock eines Blauwals heraus, der 2007 vor der kalifornischen Küste bei einem Umfall mit einem Schiff tödlich verletzt verstorben war, um daran exemplarisch eine solche Lebensgeschichte aus dem Ohrschmalz zu rekonstruieren. Der Blauwal war ein 21,2 Meter langes Männchen. Sein Ohrpflock war 25.4 Zentimeter lang, er enthielt 24 klar erkennbare Lagen, die einer Lebensspanne von 12 Jahren ± 6 Monaten entsprechen. Sein Skelett befindet sich heute im Santa Barbara Museum of Natural History.
Nach 18 Monaten hatten sie mit Daten aus dem Walblubber die Ohrpflöcke geeicht: Im Fettgewebe der Wale, dem Blubber, lagern sich Toxine besonders gut ab. Darum ist Walspeck ja auch so besonders hoch mit Schadstoffen belastet. Die im Fett abgelagerten Toxine wie Pestizide (DDT, DDE), verschiedene PCBs und andere Stoffe ließen sich im Ohrpflock wiederfinden.

Dead blue whale on Californian coast. (Credit: Photography by Jessica Waters, Santa Barbara Museum of Natural History)
Walblubber zeigt, welche Toxine ein Wal im Laufe seines Lebens aufgenommen hat.
Der Ohrpflock zeigt auch noch, wann der Wal welche Toxine aufgenommen hat.
Jede Schicht im Ohrpflock steht nämlich für einen Sechs-Monats-Intervall. Die kann man präzise auszählen, dadurch ergibt sich eine belastbare Baseline, von der aus messbar wird, zu welchen Zeiten der Wal welchen Umwelteinflüssen ausgesetzt war, etwa Pestiziden oder Quecksilber.
Der Wal ist also ein schwimmendes Archiv nicht nur für seine Lebensdaten, sondern darüber hinaus auch für die Daten der Ozeane, die er durchquerte.
Noch überraschender war, dass im Ohrschmalz sogar noch der Hormonpegel des Wals aufgezeichnet war. Denn, so Usenko, Hormone zerfallen in allen anderen Körpergeweben recht schnell.
Das ausgehärtete Ohrschmalz des Wals enthielt neben seinem Lebensalter nicht nur wichtige Aussagen zu Umweltparametern seiner Umgebung, sondern darüber hinaus auch noch ein Tagebuch der Physiologie dieses Wals, hormonelle Schwankungen und den Streß-Pegel. Die Wissenschaftler konnten das Alter, den Eintritt in die Pubertät (am Testosteron-Pegel des Blauwals klar erkennbar) sowie Zeiten der Eisprünge und Geburten (bei weiblichen Walen) herauslesen – lauter wichtige Informationen für ein besseres Bestandsmanagement und einen besseren Schutz dieser Meeresriesen (Usenko, Trumble, Potter et al: „Blue whale earplug reveals lifetime contaminant exposure and hormone profiles“ (Proceedings of the National Academy of Sciences)).

Barrow whalers haul in bonus bowhead killed by unknown causes (Alaska Dispatch News)
Ein anderer analysierter Ohrpflock stammte von einem Grönlandwal, der in Barrow, Alaska gestrandet war. Sie war 65 Jahre alt. Jede Schicht des Ohrpflocks zeigte klar die Unterteilung in hell und dunkel, wie bei Jahresringen eines Baumes.
Der Farbwechsel hängt mit der unterschiedlichen Ernährung des Wals zusammen, Grönlandwale – und die meisten anderen Großwale auch – wandern jedes Jahr zwischen zwei Meeresgebieten hin und her. Unterschiede in den Levels der Schwangerschaftshormone Progesteron und Estradiol zeigen, dass die Walin zwischen 11 und 14 Mal trächtig war, nach dem Erreichen der Geschlechtsreife etwa alle drei bis vier Jahre. Außerdem fand sich, so Trumble ein starker Anstieg des Streßhormons Cortisol während ihrer ersten Paarung und Trächtigkeit. Durch die Messung der Stickstoff-Isotope, die das Plankton-Futter in den Ohrpflöcken hinterlassen hatte, konnten die Wissenschaftler rekonstruieren, wann sie gefressen hat und wann sie gewandert ist. Diese Meeresriesin, so zeigte sich, bewegte sich den größten Teil ihres Lebens zwischen der Bering-See und der Tschuktschen-See.
Mit dieser neuen Methode kann man nun etwa den Ohrpflock eines Grauwals, der 1910 vor San Francisco im Pazifik erlegt worden ist und etwa um 1850 geboren worden war, mit dem eines Grauwals aus dem gleichen Meeresareal vergleichen, der etwa 1970 gestorben ist. Heute stammen die meisten Wal-Proben von gestrandeten Tieren und nicht mehr aus dem Walfang.
Die Wissenschaftler können mit dieser neuen Methode erstmals neben dem Lebensalter eines Individuums auch noch seine Lebensgeschichte – den Eintritt in die Pubertät (am Testosteron-Pegel des Blauwals klar erkennbar) sowie Zeiten der Eisprünge und Geburten (bei weiblichen Walen) – herauslesen. Lauter wichtige Informationen für ein besseres Bestandsmanagement und einen besseren Schutz dieser Meeresriesen.
Waren die Geburtsraten gleich hoch?
Welche Umweltgifte und andere Substanzen sind in den beiden Tieren zu finden? Waren die Stresslevel gleich hoch?
Diese und viele andere Fragen lassen sich so erstmals beantworten.
Die Analyse des sedimentierten Walohrschmalzes öffnet also vollkommen neue Möglichkeiten, mehr über die Lebensgeschichte eines individuellen Wals zu erfahren.
Der Umfang der Informationen ergibt sogar eine ziemlich vollständige „Krankenakte“.
Einen Hormonwert findet Trumble besonders interessant: das Stress-Hormon Cortisol.
Der 2007 von einem Schiff gerammte und verstorbene Blauwal hatte einen durchgehend hohen Cortisol-Spiegel, das spricht für dauerhaften Stress. Und warum gehen sie bei dem kürzlich in Barrow, Alaska, verstorbenen Grönlandwal auf und ab? Lag es an diesem Blauwal persönlich oder hat ihn der starke Schiffsverkehr unter Dauerstress gesetzt wurde.
Leiden Wale heute stärker unter Stress als in früheren Zeiten?
Wodurch entsteht der Stress – durch Lärm, Umweltgifte oder Nahrungsmangel?
Bis jetzt haben die Wissenschaftler etwa zwei Dutzend Ohrpflöcke analysiert, aus unterschiedlichen Museumssammlungen der Welt, einige sogar aus der heutigen Waljagd von Inuit-Völkern. Rahmen des „Aboriginal Whaling“ bejagen manche Inuit-Völker eine kleine Wal-Quote. Mit dieser Auswahl decken die Walforscher eine große zeitliche und geographische Spanne und Artenvielfalt ab.

The Smithsonian’s enormous Paul E. Garber storage facility in Suitland, Maryland, is where museum scientists store the marine mammal collection. (Donald E. Hurlbert)
Walohrschmalz als Ausstellungsexponat
Das Smithsonian-Museum in Washington präsentiert ab dem 10. März eine neue Ausstellung: “Objects of Wonder: From the Collections of the National museum of Natural History”. Sie wird bis 2019 zu sehen sein.
Der Ohrpflock aus Ohrschmalz eines Wals ist dann eine der ausgestellten Preziosen.
So kam es zu diesem aktuellen Artikel von Wendy Mitman Clarke auf dem Smithsonian-Blog vom January 25, 2017.
Ein schöner Anlass, um mal wieder auf die Bedeutung von Museumssammlungen hinzuweisen:
1. Museumssammlungen sind wertvolle Archive. Auch wenn sich der Wert mancher Objekte zum Zeitpunkt ihres Sammelns noch nicht klar ist, dauert es manchmal einige Zeit, bis mit neuen Methoden oder neuen Forschungsfragen diese bisher unwichtig erscheinenden Sammlungsstücke auf einmal eine neuartige, höchst aktuelle Bedeutung erlangen. In diesem Fall: Ein Klimaarchiv.
2. Neue Forschungsfragen ergeben sich, wenn sich Wissenschaftler verschiedener Disziplinen treffen und ins Plaudern kommen. Darum brauchen wir Tagungen, Meetings und Kommunikation über Wissenschaft.
3. Im Walohr sedimentiert Ohrschmalz zu geschichteten Ohrpflöcken (earplugs), in sechs Monaten lagert sich eine Schicht ab.
4. Diese Ohrpflöcke sind Archive der Physiologie des individuellen Wals und gleichzeitig Klimaarchive der Umgebung des Tieres.
Quellen und zum Weiterlesen:
Wendy Mitman Clarke: „For Scientists, Chunks of Whale Earwax Can Be Biological Treasure Troves” (Smithsonian, January 25, 2017)
Stephen J. Trumble; Eleanor M. Robinson; Michelle Berman-Kowalewski; Charles W. Potter and Sascha Usenko: “Blue whale earplug reveals lifetime contaminant exposure and hormone profiles” (Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Oct 15; 110(42): 16922–16926. Published online 2013 Sep 16. doi: 10.1073/pnas.1311418110
Ed Yong: “Biography Of A Blue Whale, Told Through Ear Wax“ (National Geographic-Blog “Not exactly Rocket Science”, 09/16/2013)
Christina Lockyer: “Age determination by means of the ear plug in baleen whales” · January 1984
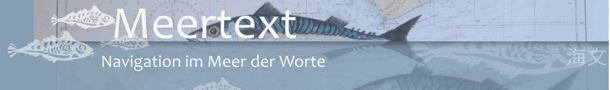
Kommentare (37)