
Matthias Maurer (ESA)
Der neu ernannte ESA-Astronaut Dr. Matthias Maurer war am 09.02.2017 als Gast der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim und hatte einen wunderbaren Vortrag im Gepäck. Ich fand den Vortrag interessant genug, um darüber einen Beitrag zu schreiben. Keine wörtliche Mitschrift, sondern eher Notizen in meinen eigenen Worten.
Dr. Matthias Maurer hat Physik und Chemie studiert, in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und in Spanien, seine Schwerpunkte sind Materialwissenschaften und Werkstofftechnik.
Bei der Auswahl für die neuen Astronauten 2008/2009 war er unter den besten zehn Kandidaten. Von denen wurden aber nur sechs auch offiziell zu Astronauten ernannt, da die ESA nur so vielen Personen einen Raumflug garantieren konnte. Dennoch ist Matthias Maurer ins ESA-Team gekommen, schließlich brauchen die Kameraden im Weltall kompetente Unterstützung auf der Erde – so wurde er zunächst Support-Ingenieur. Als EuroCom war er für die Kommunikation mit der Besatzung der ISS verantwortlich und hat dabei natürlich den besten Einblick in die Arbeit der Kollegen im Weltraum bekommen.
Mit der neuen Planung für die nächsten Jahre änderte sich alles! Und Matthias Maurer konnte ins aktive Astronauten-Korps nachrücken und trainiert jetzt offiziell für einen Raumflug.
„Was ist ESA?“ – „Wir sind die europäische NASA“, so erklärt Matthias Maurer zurzeit vielen Menschen seinen Arbeitgeber.
Das findet er schade.
Ich auch.
Schließlich führt die ESA mit 8 Standorten in Europa, etwa 2.200 Mitarbeitern und einem Etat von 5,2 Milliarden € (Stand: 2016) ein erstklassiges und umfangreiches Raumfahrtprogramm durch.
Raumfahrt kann nur in Kooperation funktionieren, darum arbeitet ESA eng mit NASA, Roskosmos, JAXA und CSA (Canadian Space Agency bzw. Agence spatiale canadienne) zusammen, vor allem in der bemannten Raumfahrt wie dem Betrieb der Internationalen Raumstation ISS. Schließlich ist keine europäische Rakete für den Transport von Astronauten zertifizierte, nur die NASA und Roskosmos können Astronauten zur ISS bringen und abholen.
Zurzeit geht es in der bemannten Raumfahrt um Einsätze auf der ISS. Die ISS ist eine multinationale Space Community, mit einem „Westlichen Abschnitt“, einem „Östlichen Abschnitt“, dem europäischen Columbus-Labormodul und einigen weiteren Sektionen.

A test version of the interim cryogenic propulsion stage (ICPS) for NASA’s Space Launch System rocket is loaded into the test stand at the agency’s Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. (NASA)
Für mich eine der wichtigsten News des Abends: Die ISS-Besatzung wird demnächst von sechs auf sieben Astronauten aufgestockt.
Diese Aufstockung wird dank kommerzieller Kapseln wie SpaceX Dragon und Boeing Spaceliner möglich (Korrektur dieses Abschnitts am 26.02.2017 – meertext).
Die neue NASA Schwerlastrakete Space Launch System – SLS – soll voraussichtlich 2018 ihren ersten Flug absolvieren, natürlich noch unbemannt. Sie wird eine ähnliche Schubkraft haben wie die gewaltige Saturn V, die einst die Apollo-Astronauten ins Weltall brachte.
Genügend Schubkraft, um das neue Orion-Raumschiff in den Orbit bringen, das vier Astronauten Platz bietet. Die Orion besteht aus zwei Komponenten, einem Mannschaftsmodul und dem Servicemodul. Das Mannschaftsmodul (Crew module) ist eine NASA-Entwicklung, die ESA steuert das Servicemodul bei. Das basiert übrigens auf dem bewährten ATV, dem europäischen ISS-Versorger. Sie ist nicht für Transporte zur ISS vorgesehen, sondern für Deepa Space Missionen . Dabei sind Missionen zum Mond oder zu einem Asteroiden (Asteroid Redirect Mission) angedacht, allerdings nicht vor 2023 bzw. 2026 (Korrektur dieses Abschnitts am 26.02.2017 – meertext).
Auch wenn ab 2018 erste Probeflüge stattfinden und der erste bemannte Flug nach derzeitiger Planung nicht vor 2020 geplant ist, wird auf jeden Fall demnächst ein größerer Bedarf an Astronauten für die ISS bestehen – und Matthias Maurer trainiert dafür.
(Anmerkung: Die Orion ist nicht nach dem gleichnamigen schnellen Raumkreuzer der deutschen SF-Legende benannt, sondern nach dem Sternbild, das über Jahrhunderte von Seeleuten zur Navigation benutzt wurde).
Zum Termin in Heppenheim konnte Matthias Maurer übrigens nur kommen, weil dafür das für den Nachmittag angesetzte Tauchtraining „abgekürzt“ wurde – mit der Simulation eines Notfalls. Er musste in seinen „verunglückten“ Kollegen „retten“ und ihn in die Luftschleuse zurückschleppen. Alles in 10 Metern Tiefe.
Im Pool des Astronautenzentrums in Köln trainieren die ESA-Astronauten für die Außeneinsätze im All die sogenannten „Weltraumspaziergänge“. Die natürlich alles andere als Spaziergänge sind, sondern extrem anstrengend. Ein Unterwasser-Szenario kommt einem Einsatz im Weltall so nahe, wie man es auf der Erde nur simulieren kann.
Feueralarm im Weltraum!
Die Simulation von Notfällen nimmt einen sehr wichtigen Platz im Astronautentraining ein. Auf der ISS gibt es drei Arten von Notfällen:
1. Feuer
Bei Feueralarm werden die Belüftung und der Strom des betreffenden Moduls abgestellt. Ohne Sauerstoffzufuhr erstickt das Feuer von selbst.
Feuer im Weltraum gab es bisher nur ein einziges Mal, 1997 auf der MIR

The International Space Station orbiting the Earth has been under construction since 1998. Contributions from the US, Russia, Japan and Europe will continue to be added before its completion sometime after 2010 (BBC).
2. Druckverlust
Zum Druckverlust kann es etwa durch den Einschlag eines Mikro-Meteoriten oder bei der Kollision mit Space debris (Weltraummüll) kommen. In dem Fall muss das Loch gefunden und repariert werden. Gegebenenfalls muss das Modul isoliert und das Loch später repariert werden.
3. Luftkontamination mit Ammoniakgas
Die Radiatoren auf der westlichen Seite der ISS enthalten Ammoniak. Effizient in der Kühlung, allerdings hochgiftig in der Atemluft. Gerät es durch ein Leck in die Station, müssten sich die Astronauten in den russischen Teil der ISS zurückzuziehen. Dort sind die Wärmeaustauscher weniger effizient, laufen allerdings auch ohne Ammonium.
Forschung auf der ISS
Die ISS bietet als einziges Labor überhaupt die Möglichkeit, Versuche unter Schwerelosigkeit durchzuführen. Bisher hat sich herausgestellt, dass viele Materialien und organische Strukturen wie Gewebe oder Organismen unter Schwerelosigkeit offensichtlich anders reagieren und neuartige, bisher unbekannte Eigenheiten entwickeln.
Gravitation sorgt für eine spezifische Anordnung innerhalb von Mischungen, natürlich haben schwerere Anteile die Tendenz, sich aufgrund der Gravitation nach unten zu bewegen. Flüssigkeiten haben dadurch die Tendenz, sich zu entmischen. In Legierungen bedeutet das, dass sich das schwere Metall unten sammelt und die Legierung keinesfalls gleichmäßig durchmischt ist. Das bedeutet für die daraus produzierten Teile, dass sie an verschiedenen Stellen leicht unterschiedliche Materialeigenschaften haben.
Für die Materialwissenschaft bedeutet Schwerelosigkeit, dass sich etwa Metalle in Legierungen wesentlich gleichmäßiger mischen, das hatte Alexander Gersts Experiment 2014 während seiner Mission “Blue Dot” auf der ISS gezeigt.
Für mich als Biologin ist vor allem die Gravitationsbiologie interessant:
Experimente mit Pflanzen auf der ISS haben ergeben, dass sich unter dem Einfluss der Schwerelosigkeit Gene aktivieren, die normalerweise inaktiv sind.

The study of Arabidopsis thaliana, pictured here, will be a continuation of previous research to understand how the effects of hypobaric environments on the International Space Station determine plant growth in microgravity for long-duration space missions. Image: NASA
Experimente mit der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana), einer auch auf der Erde beliebten Experimentier-Pflanze, hatten gezeigt, dass in dem Kreuzblütler-Genom bestimmte Gene aktiviert werden, die der Pflanze zu einer höheren Stress-Resistenz verhelfen. Etwa eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit. Das ist keinesfalls trivial, sondern kann wichtige Hinweise für die Zucht von Pflanzen, die mit weniger Wasser auskommen, geben. Eine wertvolle Eigenschaft in Zeiten des Klimawandels, der für große Gebiete der Erde aller Voraussicht nach mehr und längere Trockenperioden bedeuten wird.
Die verringerte Gravitation hat offenbar auch signifikante Auswirkungen auf das menschliche Genom. Eine Zwillingsstudie der NASA hatte das kürzlich an den beiden Astronauten Mark und Scott Kelly nachgewiesen.
Beide Zwillingsbrüder haben das gleiche Astronautentraining absolviert und waren in vergleichbarem Gesundheitszustand. Dann lebte und arbeitete Scott Kelly gemeinsam mit dem Kosmonauten Mikhail Kornienko ein Jahr lang auf der ISS – dies war der erste so lange Aufenthalt von Menschen im Weltall! Sein Bruder Mark blieb auf der Erde und fungierte als Kontrollgruppe des Experiments. Erste Untersuchungen stellten erhebliche genetische Veränderungen bei Scott fest, die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen.
Reiseziel Mond. Oder Mars?
Den größten Teil des Vortrags machte natürlich das Astronautentraining aus, vor allem die Vorbereitung auf die Exploration in der Zeit nach der ISS. Matthias Maurer hatte sich schon in seiner Zeit vor der offiziellen Ernennung zum Astronauten mit dieser Zukunftsforschung beschäftigt.
Wohin geht es nach der ISS?
Das nächste Ziel ist der Mond!
Er ist nicht nur das nächstgelegene Ziel, sondern auch ein wichtiger Trittstein für alles, was dahinterliegen könnte, angefangen beim Mars.
Vor dem nächsten Mondflug und der weiteren Exploration des Mondes gibt es noch viel zu erproben und zu entwickeln. In den Laboren und Werkstätten geht es um die Erarbeitung von Lösungen für das Überleben außerhalb der Erde. Mittlerweile stehen nicht mehr tage-, wochen- oder monatelange Raumflüge im Fokus, sondern die Einrichtung und der Betrieb außerirdischer Stationen. Eine solche Station – etwa auf dem Mond – müsste über eine wesentlich stärkere Autarkie verfügen und viele Substanzen vor Ort erzeugen. Ein Transport irdischer Ressourcen bis zum Mond wäre nicht finanzierbar. Darum müssen ESA und NASA u. a. zuverlässige Maschinen zur H20- und 02-Erzeugung entwickeln. An solchen Entwicklungen war Matthias Maurer beteiligt.
Wie kann man für den Aufenthalt im Weltall und auf dem Mond trainieren?
ESA und NASA haben zurzeit verschiedene Analogszenarien für den Mond als laufen: CAVES (ESA), NEEMO (NASA) und LUNA.
(Was sich hinter CAVES, NEEMO und LUNA verbirgt und was Raumfahrt mit Korallen zu tun hat, das gibt es am Montag zu lesen)
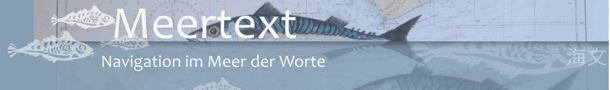
Kommentare (32)