Die Wissenschaftler fanden klare Hinweise auf eine laufende natürliche Auslese. Es war erkennbar, dass zwei extremere Formen (Ökotypen) der Rundnasen-Grenadierfische bevorzugt auftraten, auf Kosten der intermediären Form. Das ist eine disruptive Selektion. Bei der disruptiven (=aufspaltenden) Selektion werden Extreme verstärkt – „durch bspw. Parasiten, Krankheitserreger und Fressfeinde spaltet sich ein Merkmalsmaximum auf. Randbereiche der Verteilung treten als neue Maxima hervor.“
Sowie klare Unterschiede wie Körpergröße oder –form, Färbung, Verhaltensweisen, Kommunikation oder anderes innerhalb einer Art oder eines Bestandes auftreten, kann es dazu kommen, das sich Individuen des gleichen Typus bevorzugt paaren. Das kann ein besonders prachtvoller Farbfleck sein, eine auffallende Färbung oder ein akustisches Signal wie ein Balzruf. So kommt es zu einer Bevorzugung bestimmter Merkmale bei der Paarung, was dann relative schnell innerhalb einiger Generationen zu einer Aufspaltung in unterschiedliche Typen führen kann.
Im vorliegenden Fall gab es keinen klaren Hinweis auf die bevorzugte Paarung innerhalb eines Typus. Fest steht: Junge Rundnasen-Grenadierfische leben und schwimmen gemeinsam in einer Tiefe um annähernd 1000 Meter. Erst mit dem Eintritt der Geschlechtsreife ziehen sie dann in die bevorzugte Meeresetage um, die ihrem Genom entspricht.
Ein klarer Fall, wie sich innerhalb eines einzigen Fischbestands zwei Gruppen von „Experten“ herausbilden können, die im gleichen Meeresgebiet einfach in unterschiedlichen Tiefen leben. Solche unterschiedlichen Anpassungen innerhalb eines Bestands können bei plötzlichen ökologischen Veränderungen – wie sie etwa der Klimawandel mit sich bringt – von erheblichem Vorteil sein, in Ausnahmefällen sogar das Überleben einer Population sichern.
In diesem Fall kann die Differenzierung in die beiden Ökotypen etwa durch das bessere Nahrungsangebot im Mesopelagial, das aber gleichzeitig auch einen höheren Feinddruck und ein wechselhafteres Ökosystem bedeutet und ein stabileres tieferes Ökosystem im Bathypelagial, das allerdings auch weniger Nahrung bedeutet, erklärt werden.
Besonders wichtig finde ich Rus Hoelzels Schlussfolgerung zum Meer als komplexem Lebensraum: “The oceans represent vast expanses across which there are few obvious barriers to movement. As in the environment above the sea, we tend to think about movement in a horizontal dimension, across the breadth of the oceans, but at sea there are perhaps even greater habitat boundaries and gradients as species move vertically with depth. Our research shows that these fish have adapted to life at different depths, and that they segregate by depth as they mature, based on their genetic makeup.”
Das Meer ist eben nicht einfach eine Wassermasse, sondern bietet im für uns scheinbar gleichförmigen Wasserkörper eine Vielzahl von verschiedenen Ökosystemen an. Die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Lebensräumen sind für Menschen oft unsichtbar, sie können durch Strömungen, Licht, Temperatur, Salzgehalt oder anderes induziert werden. Bei der Bewirtschaftung mariner Ressourcen sollte man diese Diversität von Ökosystemen immer im Hinterkopf haben, denn sie ist eine Dimension der Biodiversität. Die biologische Vielfalt besteht aus der Vielzahl der Arten, der Genome und der Lebensräume. Nur wenn wir alle drei Komponenten berücksichtigen, können wir die Biodiversität verstehen und erhalten. Wie bereits gesagt: Gerade im Zuge der schnellen Veränderungen im Zuge des Klimawandels ist diese Diversität für viele Arten eine Überlebensversicherung.
Reference:
Michelle R. Gaither, Georgios A. Gkafas, Menno de Jong, Fatih Sarigol, Francis Neat, Thomas Regnier, Daniel Moore, Darren R. Grӧcke, Neil Hall, Xuan Liu, John Kenny, Anita Lucaci, Margaret Hughes, Sam Haldenby, A. Rus Hoelzel. Genomics of habitat choice and adaptive evolution in a deep-sea fish. Nature Ecology & Evolution, 2018; DOI: 10.1038/s41559-018-0482-x
https://natureecoevocommunity.nature.com/posts/30893-adapting-to-habitat-depth-in-the-deep-sea
Deep-sea fish choose habitat according to genotype, new research says
Grenadierfisch als Speisefisch
Diesen Fisch habe ich bewußt noch nie probiert. Fast alle Dorschartigen fand ich mit ihrem festen Fleisch bisher aber sehr lecker – bis auf Schellfisch, der auch “Stinkefisch” genannt wird, wegen seiner unnachahmlichen Schmodder-Note. Beim Grenadierfisch ist allerdings anzuraten, das Tier zu filetieren. Zart besaitete Gäste könnten sonst möglicherweise schreiend vom Tisch aufspringen. Rezepte für die Verarbeitung der Filets sind im Internet genug zu finden.
Im Japanischen werden Grenadierfische Hoki genannt – dort sind natürlich pazifische Grenadier-Arten gemeint – und geben u. a. eine gute Sushi-Zutat ab.
Das Alter von Grenadierfischen wird, je nach Quelle, mit 25 bis maximal 54 Jahre angegeben. Fische, die ein so hohes Alter erreichen können, sind kaum nachhaltig zu bewirtschaften, so gelten auch die Rundnasen-Grenadierfische als überfischt.
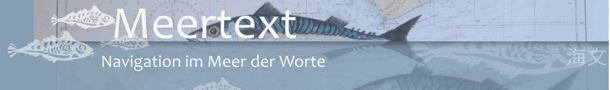
Kommentare (15)